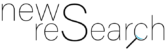Außerdem macht Wolf Spillner in Wort und Bild mit den natürlichen „Schätzen der Heimat“ bekannt, und Bernd Wolff entführt uns in den sagenhaften Harz, der auch keinen Geringeren als Goethe zum Dichten anstiftete. Ein besonders willkommener Anlass war ihm das Hexentreiben zur Walpurgisnacht, wie wir aus einer der berühmtesten Szenen seines „Faust“ wissen. Aber wem verdankt diese Walpurgisnacht eigentlich ihren Namen? Und was steckt sonst noch dahinter? Warten Sie es ab, und begeben wir uns zunächst zurück in das Jahr 1968 und in eine 7. Klasse.
Erstmals vor einem halben Jahrhundert, also 1968, veröffentlichten Hildegard und Siegfried Schumacher im Kinderbuchverlag Berlin ihre Mädchen-und-Jungen-Fußballgeschichte „Entscheidung in der Schlangenbucht“: Hauruck ist der Kapitän der erfolgreichen Fußballmannschaft der 7. Klasse von Wummersdorf. Die Mädchen aus der Klasse spielen sehr gut Handball, aber die Patenbrigade hat der Klasse einen sehr teuren Fußball geschenkt. Um den auszuprobieren, schwänzten die Jungen die Musikstunde. Und damit begann das Unglück. Der Klassenlehrer Herr Renner und die Mädchen wollen den Fußball verwahren und entscheiden, wann die Jungen damit trainieren dürfen. Das wollen die Jungen auf keinen Fall zulassen und Hauruck hat eine Idee, wie sie den Ball für immer bekommen können. Es klappt wunderbar, auf der Rückfahrt von einem Spiel im 15 Kilometer entfernten Bollenstädt verliert Hauruck den Ball. Nun aber gehen die Probleme erst richtig los. Wo sollen die Jungen heimlich mit dem Ball trainieren? Sollen sie zulassen, dass die Brigade und alle Schüler der Klasse den Erlös einer Sonderschicht für den Kauf eines neuen Balles einsetzen? Hauruck hat immer neue Einfälle zur Vertuschung des Balldiebstahls, die zu großen, lobenswerten Projekten führen. Sogar in der „Trommel“, der Kinderzeitung der DDR, soll er als Vorbild herausgestrichen werden. Wenn nur das schlechte Gewissen nicht wäre … Außerdem hat Hauruck den anderen Jungen geschworen, niemandem von dem Ball zu erzählen. Der Graue muss spurlos verschwinden. Noch aber sind wir ganz am Anfang der Geschichte und mitten in einer heftig geführten Auseinandersetzung zwischen Mädchen und Jungen der 7. Klasse, zwischen Handballerinnen und den Fußballern:
„Mit schnellen Schritten kommt Herr Renner in die Klasse, knallt seine Aktentasche auf den Tisch und stützt sich mit beiden Fäusten darauf. „Was habt ihr euch dabei gedacht?“ — Falsch war es, die Musikstunde bei Herrn Summer zu schwänzen. Das hat Hauruck schon gestern gewusst. Aber die dicke Wolkenhenne brütete ein Gewitter aus. Sie mussten den neuen Fußball ausprobieren, bevor der Regen herabstürzte. Kann Herr Renner das nicht verstehen?
„Denkt ihr, die Brigade hat der Klasse den Ball geschenkt, damit ihr Dummheiten anstellt? Erst zankt ihr euch seinetwegen mit den Mädchen, danach verschwindet ihr heimlich mit ihm.“
Hauruck ärgert sich. Glatter Unsinn ist das! Die Jungen haben nicht gezankt, sondern ihr Recht verteidigt. Was haben schließlich Mädchen mit einem Fußball zu schaffen? Dazu mit diesem: zweiunddreißigteilig, mausegrau. Für vierundsiebzig Mark fünfzig! Papa Wühle hat es extra betont, als er den Ball dem Gruppenrat übergab. Deutlich war zu sehen, es hat ihm nicht gepasst, dass er den Mausegrauen in Mädchenhände legen musste, weil kein Junge im Gruppenrat sitzt. Außerdem: Wer hat für den Ball gesorgt? Er, Hauruck, und sein Freund Feger, der Mittelstürmer der Klassenelf. Sie haben ihre Väter, die in der Baubrigade der Genossenschaft arbeiten, von der Notwendigkeit eines solchen Freundschaftsgeschenks überzeugt.
„Peter Stein!“
Hauruck schiebt das linke Bein in den Seitengang, stemmt seine Handballen auf und drückt sich langsam hoch. Er mustert beharrlich den Fußboden. Immer muss Herr Renner ihn, den Kapitän, fragen. Warum fragt er nicht Feger oder Hechter, den Torwart? Sie gehören auch in den Mannschaftsvorstand.
„Nun?“
„Sag doch einen Ton“, flüstert Bärbel neben ihm. Hauruck schielt seitwärts. Sie dreht an ihren Ponyfransen und nickt ihm zu. Gestern war sie ganz Gruppenratsvorsitzende und tat, als haben die Mädchen mitzubestimmen über den Ball. Heute ist sie wieder vernünftig. Es gibt Hauruck Mut, dass seine Freundschaft mit Bärbel keinen Knacks bekommen hat. „Das … das in Musik … war … war nicht richtig.“
„Ist das alles?“
Krampfhaft überlegt Hauruck, was Herr Renner noch will. „Entschuldigen“, haucht Bärbel.
Richtig. „Ent… entschuldigen Sie, Herr Renner, bitte!“ So, nun soll er sagen, wie sie die Schwänzerei auslöffeln sollen. Hauruck ist bereit zu löffeln. Wenn es nur nicht so viel wird! Dass ihnen gestern die Zehen nach dem Mausegrauen gejuckt haben, müsste ein Fußballer wie ihr Klassenlehrer doch begreifen. Rackert er nicht selbst Sonntag für Sonntag im Wummersdorfer Traktor mit?
„Entschuldigen müsst ihr euch bei Herrn Summer.“
Hauruck nickt.
„Und dann?“
„Wir … wir holen die Stunde nach.“
„In Ordnung. Weiter.“
Weiter? Genügt das nicht? Hauruck guckt Bärbel an. Auch sie weiß keinen Rat.
„Ich glaube, wir müssen mit dem Ball etwas verändern.“
Hauruck wird misstrauisch. Was hat Herr Renner vor? Wie von einer Schnur gezogen, heben alle Jungen ihren Blick.
„Vielleicht schwänzt ihr deshalb morgen wieder oder übermorgen oder …“
„Bestimmt nicht! Nein, nein, bestimmt nicht! Nie wieder!“, ruft Hauruck schnell.
„Das sagst du so einfach! Wenn es brennt, verspricht man leicht, was gewünscht wird. Erst musst du, müssen alle Jungen beweisen, dass ihr es ehrlich meint. Die Mädchen durften den Klassenball gestern nicht einmal anfassen. Ich bin dafür, dass sie ihn bis auf Weiteres kontrollieren, auch eurer Hausaufgaben wegen.“
Hauruck brennt das Gesicht. „Herr Renner, lassen Sie uns den Ball, bitte! Sie werden sehen, wir halten mein Wort.“
Petra meldet sich. Hauruck kennt seine Schwester. Sicher ist sie für Herrn Renners Vorschlag. „Du“, schreit er los, „misch dich nicht ein! In Fußballfragen seid ihr Mädchen völlig Luft! Der Ball gehört uns! Verstanden?“ Die Jungen nicken. Hauruck reckt sich, die Mannschaft steht zu ihm.
Bärbel springt auf. „Luft sollen wir sein? Wenn es so ist, Herr Renner, dann bin ich für Ihren Vorschlag!“
Hauruck starrt sie an. Tiefschlag! Nie hätte er das von ihr erwartet. Er beißt sich auf die Lippen. Wie durch Watte dringt Häschens hohe Stimme an sein Ohr: „Ich stelle den Antrag, dass Sie den Ball verwalten, Herr Renner. Die Jungen luchsen ihn uns doch gleich ab.“
„Stimm ab, Bärbel!“, ruft Petra. „Wer dafür ist, steht auf.“ Bärbel, Petra und Häschen, das ist der Gruppenrat. Sie haben sich gegen die Jungen verschworen, reißen die anderen Mädchen mit, natürlich. Da stehen sie: dreizehn Stück, die Mehrheit. Was können die Jungen dafür, dass sie nur zwölf sind? Aber sie sind einstimmig dagegen, keiner steht. Sie halten zusammen, eisenfest wie …
„… zwölf, dreizehn, vierzehn“, zählt Bärbel.
Vierzehn? Einmal lässt Hauruck den Blick über der Klasse kreisen, sucht den Verräter. Erschrocken fällt Hauruck auf seinen Platz, schreit: „Ich bin dagegen!“
„Trotzdem dreizehn.“
„Die Mehrheit!“
Einen ironischen Roman aus dem alten Berlin hat Maria Seidemann ihr erstmals 1986 – also nur drei Jahre vor der friedlichen Revolution in der DDR – im Eulenspiegel Verlag Berlin erschienenes Buch „Das geschminkte Chamäleon“ genannt: Was wird aus einer Revolution, wenn die Menschen, die sie gemacht haben, zu saturierten Kleinbürgern entarten, ihre Ideale vergessen und nur noch auf Ruhm, Reichtum, Karriere bedacht sind oder sich anarchisch gebärden? Ironisch distanziert, fordert die Autorin in diesem Zeitgemälde der Jahre 1848 bis 1871 den Leser heraus, die Antwort auf diese Frage zu finden. Das Chamäleon, literarisches Symbol der Anpassung schlechthin, kommt zu allem Überfluss geschminkt daher: höchste Perfektion oder Anachronismus in Natur und Gesellschaft? Dieser erste Roman Maria Seidemanns schildert fiktiv die Entstehung und Wandlung des ehemaligen Friedrich-Wilhelm-Städtischen Theaters in der Berliner Schumannstraße. So hätten die Geschichten der Leute, die mit diesem Theater, jeder auf eine andere tragikomische Weise, verbunden waren, sein können. Es ist kein Roman von historischer Authentizität, aber so die Autorin: „Es ist eine Geschichte von Aufstieg und Niedergang, sie ist traurig und komisch, außerdem ist sie wahr.“ Vorangestellt hat die Autorin einen nachdenklich stimmenden Gedanken von Heinrich Heine, der wohl für fast alle Revolutionen und deren nachrevolutionären Zeiten gelten kann, oder?: „Manche Leute, die keine geborenen Narren und einst mit Vernunft begabt gewesen, sind solcher Vorteile wegen zu den Narren übergegangen, leben bei ihnen ein wahres Schlaraffenleben, die Torheiten, die ihnen anfänglich noch immer einige Übenwindung gekostet, sind ihnen jetzt schon zur zweiten Haut geworden, ja sie sind nicht mehr als Heuchler, sondern als wahre Gläubige zu betrachten.“
Nun aber wollen wir uns dem Anfang des ersten Kapitels widmen, in dem drei Briefe aus Berlin geschickt werden. Der erste von ihnen stammt vom „4ten September 1847“:
„Meine liebe Schwester Charlotte!
Zum Ersten muss ich Dich dringend bitten, dass Du vom Inhalt dieses Briefes unserem Vater nichts mitteilst. Aber auch nicht Deinem Mann, den ich schon immer (verzeih!) mehr für einen heimlichen Gendarmen als für einen Pastor gehalten habe. Von allen meinen Schwestern bist Du diejenige, die mir am meisten die Mutter vertrat. Deshalb will ich Dir jetzt getreulich alles berichten, was mir seit meiner Ankunft in der großen Stadt widerfahren ist.
Charlotte, ich bin ein glücklicher Mensch! Ich bin voller Begeisterung! Aber ich habe große Angst, weil ich dem Vater nicht gehorcht und alles anders gemacht habe, als er angeordnet und erwartet hat. Lies geduldig bis zu Ende und hilf mir! Schon die Fahrt mit der Dampfbahn von Potsdam aus war ein aufregendes Erlebnis, obgleich ich angenommen hatte, sie führe mit größerer Geschwindigkeit. Sie brauchte aber fast dreißig Minuten. Halte es meiner Unerfahrenheit zugute, dass ich mich im Coupé von einer jungen Weibsperson ansprechen ließ. Sie sah mir vom Gesicht ab, dass ich ein Student sei, der noch kein Zimmer habe, und pries mir ein sauberes, billiges Chambre garnie im Hause ihres Vaters an. Mein Zimmernachbar würde ein wirklicher Universitätsprofessor sein, und die Hörsäle lägen ganz in der Nähe. Ich war so glücklich über diese Fügung! Zumal die Mamsell mit einem Wagen vom Bahnhof abgeholt und ich samt meinem Reisekorb hinten aufgeladen wurde, was für mich doch sehr bequem war!
Liebe Charlotte! Du wärest wie ich überwältigt von der Größe und Pracht der Stadt Berlin, welche die Erzählungen unseres Vaters bei Weitem übertrifft. Alle Straßen sind mit Steinen gepflastert, manche sind mit Bäumen bepflanzt, genauso wie die Auffahrt zum Gut von Tripperow. Wir sind eine geschlagene Stunde durch die Stadt gefahren, und nirgends war ein Ende zu erblicken. Die Häuser sind mit prächtigen Simsen verziert, oft auch mit Figuren und steinernen Medaillons, und die Fenster mögen so groß sein wie die in unseres Vaters Kirche. Die Menschen in Berlin scheinen wenig zu arbeiten, denn sie spazierten am hellen Tage auf den Straßen herum, sogar einzelne Frauen, und allesamt besser gekleidet als die Frau Major von Tripperow.
Der Wagen, auf dessen Ladefläche ich hockte, ratterte endlich über die Weidendammer Brücke und in ein Stadtviertel hinein, das aus lauter neuen Häusern besteht. Du wirst es nicht glauben, doch zu der Zeit, als unser Vater in Berlin Student war, soll hier noch freies Feld gewesen sein. Dieses Viertel zwischen Oranienburger Tor, Monbijou und Schiffbauerdamm heißt Friedrich-Wilhelm-Stadt, aber man nennt es das Quartier Latin von Berlin. Hier wohnt ein sehr gemischtes Völkchen: ehrbare Handwerkerfamilien, Beamtenwitwen, welche vom Vermieten leben, Arbeiter von der besser verdienenden Sorte, Künstler, Studenten, Nähmädchen, Kleiderverleiher. Auch Ganoven trifft man und sogar Dirnen. Doch nicht aus dieser Richtung kam das Ereignis, das mich in eine andere Bahn warf als die vom Vater bestimmte.
Die Mamsell aus der Dampfbahn nahm mich mit in das Haus ihres Vaters, eines Tischlermeisters mit Namen Magnus. Sie allein kommandiert das gesamte Hauswesen, weil sie — wie wir! — die Mutter früh verlor. Also machte ihr Vater mit mir den Kontrakt, wie sie es wollte, und ich musste die Miete für ein Quartal vorauszahlen. Der Hausherr bestand darauf, mit mir ein Glas scharfen Branntwein zu trinken, der in Kehle, Brust und Hirn brannte, sodass ich Mühe hatte, der Mamsell Marie die Treppe hinauf zu folgen, wo ich endlich mein Zimmer sehen konnte. Dieses Zimmer sei früher ihrs gewesen, sagte Marie, und das Bett auch, ich sollte es gleich probieren, es sei gut. Kichernd ließ sie sich auf die Matratze plumpsen und wippte darauf hoch und nieder. Ich begann mich über die Sitten der städtischen Jungfrauen zu wundern!
„Versuchen Sie es auch!“, rief sie aber, packte mich und zerrte mich zu sich herab, dass mir ganz schwindlig wurde. So kam es, dass ich — kaum eine Stunde, nachdem ich in Berlin angekommen — meine Unschuld verlor. Ach, wüsste ich nur, dass Du mir verzeihst! Denn ich kann nicht behaupten, dass ich danach unglücklich gewesen bin. Außerdem ist dieses Ereignis auch nicht das Eigentliche, das ich Dir mitzuteilen habe. Also fahre ich fort in meinem wahrhaftigen Bericht.
Ich wollte frische Luft atmen und öffnete das Fenster, nachdem Marie entsprungen war, weil unten im Hause nach ihr gerufen wurde. Da ich meinen Kopf aus dem Fenster steckte, hörte ich nicht, wie das Schicksal an meine Türe klopfte. Ich sah unten auf dem Hofe etwas, das ich als böses Omen nehmen wollte. Auf zwei schwarz verhängten Wagen, die mit schwarzen Pferden bespannt waren, standen zwei schwarze Särge, bei deren Anblick ich natürlich an unseren Vater denken musste, und mein Gewissen regte sich. „Ein Unglückstag“, flüsterte ich vor mich hin.
„Ein Glückstag“, sprach eine trockene Stimme hinter mir. Ich fuhr herum und erblickte in meinem Zimmer einen etwa vierzigjährigen rothaarigen Mann. Dieser stellte sich als mein Zimmernachbar Professor Blindow vor und bat, sein Eindringen zu verzeihen. Bis vor einigen Minuten habe er aus meinem Zimmer lautes Stöhnen vernommen, das plötzlich verstummt sei. „Kann ich Ihnen helfen?“, fragte er.
Was sollte ich antworten? Ich konnte nicht entscheiden, ob das Blitzen seiner Augen hinter den Brillengläsern wissend war oder nur freundlich. „Ein Glückstag?“, fragte ich also zurück und deutete auf die abfahrenden Totenwagen.
Mein Nachbar erklärte, dass der Tod nicht nur Kummer und Schmerz, sondern auch Gewinn bringen kann, vor allem in der Stadt Berlin, wo die Bürger ein Leben lang sparen, um nach ihrem Tode mit einem teueren und prächtigen Leichenbegängnis prahlen zu können; und vor allem, wenn man wie unser gemeinsamer Hauswirt sich auf die Sargproduktion umgestellt habe, um dem Würgegriff der großen Möbelhandlungen zu entrinnen. Der Tischler Magnus, liebe Schwester, soll sehr schnell wohlhabend geworden sein während der Cholera-Epidemie im letzten Jahr. Aber danach konnte ihm auch die Missernte mit der folgenden Hungersnot nicht helfen, es wurden nicht genug Särge gekauft. Magnus hat bereits mehr als hundert davon im Lager. Man muss sich das vorstellen, Charlotte, Dein Bruder schläft unter einem Dache mit hundert Särgen. Der Hausherr hofft auf eine neue Seuche. „Und ich kämpfe mit meinen Mitteln dagegen an“, sagte mein Nachbar.
Da ich ihn mit einfältiger Selbstverständlichkeit für einen Theologieprofessor hielt, nahm ich an, seine Mittel gegen Missernten und Krankheiten seien Gebete und gelehrte Dispute mit dem Herrgott. Ich fasste sofort Vertrauen in Blindows ruhige, feste Art und vergaß fast, in welcher Verfassung er mich angetroffen. Ja, ich könnte sogar sagen, ich fiel ihm augenblicklich und vollständig anheim, denn ich war erstmals ohne eine starke leitende Hand und außerdem verwirrt.
Mein Professor erwies sich als hilfreicher Mann. Er begleitete mich, ohne dass ich darum bat, zum Polizeipräsidium am Spittelmarkt. Zu meiner Verwunderung merkte ich, dass der Professor ebenso gern zu Fuß geht wie ich. Wir erledigten diesen Gang ohne Droschke. So nennt man hier die Mietwagen, von denen es Hunderte zu geben scheint, und die Kutscher sehen alle gleich aus. Zunächst gingen wir die Friedrichstraße hinunter, die so lang ist, dass auf ihr wohl drei oder vier Dörfer Platz fänden! Und dann, liebe Charlotte, bogen wir in die Straße ein, die man die schönste von Berlin nennt und Unter den Linden heißt. Diese Straße ist mit vier Reihen Linden besetzt, schon daran siehst Du, wie breit sie sein muss. Und wenn ich nicht endlich zum wichtigsten Punkt meines Berichts gelangen müsste, so würde ich Dir viele Einzelheiten über die Kleider und Sonnenschirme der Damen, die Uniformen, die herrlichen Kutschwagen, über Männer mit Drehorgeln und Guckkästen mit Kuriositäten, über Speisehäuser, Kaufläden, die Oper, die Universität und am Ende das Königliche Schloss berichten — was alles man beim Spazieren unter den Linden erblicken kann.
Mein Professor führte mich in ein feines Kaffeehaus, wo man nicht einmal sprechen, nur flüstern durfte, denn dort saßen viele Herren und lasen in ausländischen Zeitungen. Der Kaffee, zu dem mich Blindow einlud, kam von Brasilien. Das liegt zwar in Amerika, aber er war bitter und schmeckte lang nicht so gut wie unsere gebrannte Gerste. Gleichwohl fühlte ich mich trunken von der Pracht der Berliner Straßen, und in meinem Kopfe kreiste es wie damals vor einem Dutzend Jahren, als ich heimlich vom Messwein getrunken hatte und der Vater mich zwei Tage lang ohne Brot in den Keller sperrte zur Strafe.
Nachdem ich auf dem Polizeipräsidium meine Aufenthaltskarte gegen eine Gebühr von siebeneinhalb Silbergroschen erhalten, wofür ich meinen Pass hinterlegen musste, bat mich Blindow, ihn nun seinerseits auf ein paar Gänge zu begleiten, was ich dankbar zusagte. Schicksal, nimm deinen Lauf!
Wir gingen miteinander am Sonntagmorgen vor das Hamburger Tor hinaus. Ich habe dort Dinge gesehen, die der Herrgott nicht auf seiner Erde dulden würde, wenn er davon wüsste! Dort stehen auf einem kahlen Felde, welches man Voigtland nennt, die elendesten Katen, die Du Dir vorstellen kannst. Und mitten dazwischen erheben sich sieben (!) düstere, große Gebäude. Mein Professor bezeichnete sie als die Familienhäuser. Er nahm mich in eines mit hinein, wobei er mich aufforderte, auf alles genauestens zu achten.
Ich wagte nicht, mein Schnupftuch vor die Nase zu halten, weil ich mich vor Blindow schämte. Es stank in diesem Hause wie in einer Jauchenkute. Aber dort lebten keine Rinder und Schweine, sondern Menschen. In diesen sieben Häusern gibt es insgesamt vierhundert Zimmer, halb so groß wie das meine bei Tischler Magnus, in denen zweieinhalb Tausend Leute hausen, die zu arm sind, irgendwo anders zur Miete zu wohnen. Hier kostet eine Kammer zwei Taler im Monat. Oft teilen sich noch zwei Familien einen Raum, indem sie ein Seil durch die Mitte spannen! In jedem Hause gibt es einen Inspektor, der Zucht und Ordnung hält und die Miete eintreibt.
Wer nicht bezahlen kann, landet unweigerlich im Arbeitshaus. Dabei sind die meisten unverschuldet im Elend, vor allem die Kinder. Mein Professor sagte mir, er schriebe ein Buch über die Kinder in den Familienhäusern, die oft die einzigen Ernährer ihrer Familien sind. Sie arbeiten in den Fabriken von fünf Uhr morgens bis neun Uhr abends und verdienen 3 sgr am Tage. Diese Kinder haben Lungenhusten und verkrümmte Beine, viele sind durch Unfälle verkrüppelt oder siech von giftigen Dämpfen.
Da ich in meiner Einfalt nicht daran gedacht hatte, obgleich ich es eigentlich wusste, dass es an der Universität noch mehrere andere Richtungen gibt als die Theologie, war ich überrascht, als ich merkte, dass mein Professor ein berühmter Arzt ist. Er unterrichtet in der Charité Anatomie, aber sein eigentliches Fach sind die Krankheiten, welche die Gesellschaft erzeugt. Er ist unter den Voigtländern bereits wohlbekannt, und die Leute erzählen ihm bereitwillig ihre Lebensläufe, Unfälle und Krankheiten.“
Erstmals 1986 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Schätze der Heimat. In Naturschutzgebieten entdeckt und fotografiert“ von dem Schriftsteller und großartigen Fotografen Wolf Spillner: Große und kleine Naturschutzgebiete von der Kreideküste der Insel Rügen bis zu den Höhen des Thüringer Waldes, von den Wiesensteppen im Odertal bis zum Lindenwald in der Altmark sind die Schatzkammern unserer Heimat. Sie bewahren den Reichtum der Natur. Aus der Fülle von über siebenhundert Reservaten stellt Wolf Spillner jeweils ein Naturschutzgebiet aus jedem Bezirk der DDR in anschaulichen Texten und beeindruckenden Farbfotos vor. Der erste Besuch gilt dem …
„Tanzplatz der Kollerhähne
Bezirk Rostock: Das Naturschutzgebiet „Inseln Oie und Kirr“
Größe: 450 Hektar
Hochzeit im Salzrasen. Die auffälligen Austernfischer sind in allen Seevogelgebieten zu Hause. Es gibt Worte, die haben einen geheimnisvollen Klang. Mit ihnen verbinden unsere Gedanken etwas Besonderes, etwas Einmaliges und vielleicht auch sehr Fernes.
Was ist eine Insel? Sicher doch dieses: ein Stück Land, auf allen Seiten von Wasser umgeben und nicht durch Land mit anderem Land verbunden. Und eine Insel, mag sie groß sein oder klein, von viel oder wenig Wasser umspült, von süßem oder salzigem, zu ihr sollte auch keine Brücke führen. Eine Brücke nähme der Insel schon etwas von ihrem Geheimnis.
Rügen ist die größte Insel an unserer Küste. Zu ihr kommt man auf einem Damm und über eine breite Brücke. Mit der Eisenbahn oder mit dem Auto. Kaum ist zu spüren, dass man zu einer Insel fährt. Anders ist es mit dem Eiland Hiddensee. Dorthin kann man nur mit dem Schiff gelangen, und die Insel taucht über dem Wasser wie ein dünner Strich auf. Sie scheint sehr fern im Meer zu schwimmen.
Andere Inseln unserer Küste sind weniger bekannt und kaum als Inseln kenntlich. Keine Brücke führt zu ihnen, und kein Schiff fährt dorthin. Sie sind ohne Häuser und – bis auf eine kurze Zeit des Jahres – auch ohne Menschen. Das sind die Inseln der Vögel, zwischen der Wismarbucht im Westen und der Oderbucht im Osten unseres Landes. Diese Inseln sind meist recht klein. Sie heißen Walfisch oder Langenwerder, Libitz, Gänsewerder oder Heuwiese oder Beuchel, und sie sind unter Naturschutz gestellt. Mit ihnen sollen einmalig wertvolle Lebensgemeinschaften unserer Küste, Landschaft, Pflanzen und Tiere erhalten werden. Jede dieser kleinen Inseln gleicht einer Perle von unverwechselbarem Glanz in der Kette von Naturschutzgebieten, die den natürlichen Reichtum unserer Heimat bewahren helfen.
Das ist die Heimat der Kollerhähne, Strandläufer und Uferschnepfen, die Insel Großer Kirr Wo sich das Fischland mit dem Haken der Halbinsel Zingst an der Küste ins Meer streckt, liegen dicht beieinander drei solcher Eilande im flachen Boddenwasser. Urlauber, die vom Binnenland über die Brücke zum Ostseestrand von Zingst oder Prerow fahren, rollen daran vorüber. Sie sehen nur ein ebenes, von Gräben und Tümpeln zerrissenes Wiesenland im Bodden unter sich. Das ist die westlichste und größte der Inseln, der Große Kirr. Möwen segeln darüber hin, Schilf wogt im seichten Wasser zwischen Brücke und Wiesengrün, auf dem schwarzbunte Jungrinder als lustige Tupfer erscheinen. Wie kleine Segelboote gleiten viele blendend weiße Höckerschwäne über das Wasser, und vielleicht erkennt man im Vorbeifahren sogar ein paar Vögel, die auf langen Beinen und mit langen Schnäbeln ihre Nahrung an den Schlickkanten und im Flachwasser heraufstochern. Kaum jemand nimmt sich aber Zeit, vor oder hinter der Brücke nach den seltsamen Langschnäbeln zu schauen. Ihretwegen vor allem sind die drei Inseln im Boddenwasser unter Naturschutz gestellt worden.
Man darf die Inseln nicht betreten. Kleiner Kirr und Großer Kirr und die Barther Oie sind Inseln der Vögel und – Inseln der Rinder! Auch wenn es zunächst merkwürdig klingt, die schwarz-weißen Rinder – auf der Oie auch Schafe – sorgen dafür, dass viele sehr seltene Vogelarten dort leben und nisten können.
Schon seit vielen Jahrhunderten sind die Inseln im Bodden vom Menschen genutzt worden. Ihr Gesicht, ihr Pflanzenhaar ist durch Weidewirtschaft, durch den jährlichen Auftrieb von Vieh auf den Salzwiesenrasen, geprägt. In früheren Zeiten gab es ein paar Bauernhöfe auf den Inseln, deren Besitzer im oftmals aussichtslosen Kampf gegen die Unbilden der Natur, gegen Wasser und Sturm, mit Schafen, Jungrindern und Milchkühen ihr Auskommen suchten.
Heute weiden auf dem Salzrasen der nierenförmigen Insel Kirr, die etwa zwei Kilometer breit und vier Kilometer lang ist, bis zu tausend Jungrinder des Volkseigenen Gutes Zingst. Sie werden im Juni auf die Insel übergesetzt und grasen dort bis zum Herbst. Während dieser Zeit wachsen sie zu gesunden, leistungsstarken Tieren heran. Sie fressen und halten die Pflanzen kurz. So kann sich kein Schilf oder gar Busch- oder Baumwerk auf der Insel entwickeln. Die einmalige Salzbinsengesellschaft, die unter menschlichem Einfluss über Hunderte von Jahren entstanden ist, bleibt erhalten, mit Strand-Dreizack und Grasnelke. Solch eine Pflanzendecke auf flachen, ungestörten Inseln, in der Hunderte von Gräben und Tümpeln mit ihren Schlammufern einen reich gedeckten Tisch für die Stocherschnäbel bieten, ist bei Schnepfenvögeln wie bei Möwen und Seeschwalben zum Nestbau sehr beliebt. So sind die Inseln im Bodden, zwischen Land und Meer, zu einem besonders wertvollen Brutgebiet für Sumpf- und Wasservögel geworden. Nirgends sonst finden die Langschnäbel und die Enten solch gute Bedingungen.“
Erstmals 1970 legte der damalige VEB Hinstorff Verlag Rostock den Roman „Eine Chance für Biggers“ von Heinz-Jürgen Zierke vor: Ich bins, sagt Martin ganz unbefangen, als der alte Latotzki ihn fragt, ob er denn der Mann sei, der einen ganzen Betrieb auf den Kopf stellen könne. Der Alte hat sich neben ihn gesetzt, obwohl noch genug andere Plätze frei sind. Martin ist der Neuling in dem alten Bus, der über Land durch den Kiefernwald fährt. Er kennt Latotzki nicht und auch nicht das hübsche Mädchen Doris, das seine eigenen Absichten verfolgen wird. Er kennt hier niemanden, jedoch werden sie alle ihn kennenlernen. In seiner Aktentasche steckt mit dem Diplom der in den Umrissen vollendete Plan eines Umbaus: er will das alte, aber fehlerfrei funktionierende Werk automatisieren. Es ist sein Lebensplan. Er kennt das Leben noch nicht, wie es ist und sein soll. In seiner Tasche steckt aber auch noch ein Schnitzmesser, das er immer dann hervorholen wird, wenn er sich nicht zu helfen weiß. Mit dem Bären aus Pappelholz, der dabei entsteht, hat es seine besondere Bewandtnis. Nach Jahr und Tag wird Martin in seiner Kate Besuch bekommen. Der Werkleiter wird den Bären sehen, aber auch schon das Modell eines modernen Betriebes. Er ist nachdenklich geworden wie so mancher in diesem Werk hinter dem Walde. Aber ehe alles das hier Beschriebene passiert oder passieren kann, da muss unser Martin überhaupt erst mal ankommen am Ort der künftigen Handlung. Und das geht so:
„1. Kapitel
Pünktlich um halb eins traf der Triebwagen in Stecklin ein. Martin hob den Koffer aus dem Gepäcknetz, schlenderte pfeifend über den Bahnsteig, wartete geduldig, bis sich die Menge durch die Sperre gedrängt hatte, sah sich in der niedrigen Halle nach den Fahrplänen des Kraftverkehrs um und trat auf den Bahnhofsvorplatz hinaus, von wo der Werkbus nach Pötterdiek fahren sollte.
Pötterdiek, der entscheidende Schritt! dachte er, und gleich darauf: Unsinn, drei Stufen Bahnhofstreppe und zwölf Meter Kopfsteinpflaster! Er hasste große Worte. Das Spannbetonwerk Pötterdiek kannte er vom Papier her genau, in der Praxis aber nicht besser, als man es nach einer zweistündigen Betriebsbesichtigung kennen kann, von der zudem vierzig Minuten einem Referat über die Bedeutung der Spannbetonmastenherstellung für die Beleuchtung sozialistischer Verkehrswege gehört haben.
Exkursion hatte Esebeck, der Direktor der Fachschule, diese Veranstaltung genannt, derselbe Esebeck, der laut auflachte, als er ihm mitteilte, nicht nach Berndshof werde er gehen, sondern nach Pötterdiek.
„Das konnte ich mir denken, Biggers. Das modernste Werk der Republik, eine Freude, dort zu arbeiten. Aber nicht Sie! Sie waren in Berndshof im Praktikum, Sie schreiben Ihre Abschlussarbeit über Berndshof; übermorgen in vierzehn Tagen kommt der Direktor und bringt die Vorverträge mit. Jetzt können Sie gehen.“
Martin hatte nach Pötterdiek geschrieben und nach einer Woche eine Zusage erhalten. Was Berndshof betraf, so kam ihm der Zufall zu Hilfe: Berndshof stellte die Produktion von Schwerbetonfertigteilen ein. Esebeck trommelte mit den Fingerknöcheln auf die Schreibtischplatte, als er Martins Vorvertrag mit Pötterdiek gegenzeichnete. „Verdient haben Sie’s ja eigentlich nicht!“ Und er schrieb in Martins Abschlusszeugnis: „Biggers kann bei seinen Fähigkeiten noch mehr leisten, wenn er bestimmte, sich nachteilig auf sein Gesamtverhalten auswirkende charakterliche Mängel überwindet.“
„Der soll noch an mich denken!“, sagte Martin, als er in den Bus kletterte. „Recht so, lass dich nur nicht unterkriegen!“ Der Mann mit dem Rucksack, der mit ihm an der Haltestelle gewartet hatte, setzte sich an seine Seite. Martin sah mit einem kurzen Blick das braungraue dünne Haar des Nachbarn, der Mützenrand hatte sich in die Stirn eingedrückt, eine gerade fleischige Nase, einen etwas eingefallenen Mund, ein rasiertes, aber bartdunkles Kinn. Er sah die Hände, die den Rucksack auf den Knien hielten, kurze, kräftige Finger mit breiten Kuppen und horniger Haut, Maurerhände.
Martin, der nicht zu einem Gespräch aufgelegt war, nickte nur kurz, dann sah er aus dem Fenster: So hatte er sich die Taiga vorgestellt, damals. Die letzten Häuser der Kreisstadt, flachdachige Einzelhäuser, standen schon verloren zwischen hohen kahlen Stämmen, die dürre Kronen trugen. Und dann begann der Wald, Kiefernwald, märkische Heide, märkischer Sand, ein paar Birken am Wegesrand, hin und wieder verkrüppeltes Unterholz, zur Abwechslung eine Sumpfwiese mit einem schwarzen Graben.
„Es ist einsam bei uns“, sagte der Nachbar und rückte den Rucksack auf den Knien zurecht, „aber nicht das Dorf, das ist wie eine kleine Stadt, es ist alles da, was wir brauchen, mehr noch: jede Woche Kino im Kulturhaus. Aber wer geht da schon hin, du weißt ja, das Fernsehen. Freilich, ihr jungen Leute … Wenn du ins Theater willst, fährst du in die Kreisstadt, jeden vierten Donnerstag im Monat. Tanzen kannst du im Herbst auf dem Betriebsfest und im Februar auf dem Feuerwehrball. Öfter lohnt es sich auch nicht; junge Leute halten sich nicht bei uns. Hast du Kinder?“
„Ich bin allein.“
Die Straße trat aus dem Wald hervor. Die Felder waren weit wie eine Steppe.
„Lässt sich denn hier kein Fenster aufmachen?“ Martin sah sich um. Zwei Bänke zurück saß ein Mädchen mit kurzem dunklem Haar und einem rundlichen Gesicht. Es blies den Atem gegen die Augenbrauen und tupfte sich mit einem Taschentuch die Stirn. Ihre Hand war ungewöhnlich groß, es sah aus, als flüstere sie hinter ihr mit geschlossenen Lippen. Martin drehte sich wieder um.
„In welcher Abteilung fängst du an?“
Er musste antworten, der Alte würde doch keine Ruhe geben. „Mal sehen!“
„Kannst dir wohl den Arbeitsplatz aussuchen? Hast gute Freunde, wie?“
„Ach was, ich habe mir da nur so einiges ausgedacht für die Technologie – ich gehe natürlich in die Technologie.“
„Soso, hast also studiert, bist ein unruhiger Kopf, wie? Unser Werk – na, das wirst du schon wissen, die nehmen nämlich nicht jeden bei uns.“
Martin blies gegen die Scheibe, die sofort beschlug, und wischte sie wieder blank. Draußen war nichts zu sehen als Kiefernwald, einmal eine Lichtung und hinter einem Gartenzaun aus Reisiggeflecht ein schilfgedecktes Häuschen, dann wieder hohe borkige Stämme und am Boden Blaubeersträucher. Er war neugierig auf das Werk, nicht wegen des Kulturhauses oder wegen der fast städtischen Einrichtungen, er freute sich auf die Arbeit. Endlich durfte er zeigen, dass er etwas leisten konnte, mit eigener Kraft. „Gesamtverhalten …, charakterliche Mängel …“, ach was, in der Praxis hatte allein die Leistung zu gelten. Der Wald lichtete sich und gab den Blick frei auf einen blassblauen See.
„Kann man baden in Pötterdiek?“
„Bis zum See gehst du vom Dorf aus eine halbe Stunde. Oder hast du ein Auto?“
„Na, so hoch ist das Stipendium ja auch wieder nicht gewesen.“
„Du bist doch nicht von der Schulbank zum Studium gegangen?“
„War zwei Jahre beim Industriebau.“
„Hast also Geld verdient.“
„Für Unterkunft, Essen, Wäsche und Bücher. Die Bücher liegen noch bei den Wirtsleuten in der Bodenkammer.“
„Hast du keine – ach ja, du bist allein. Der Wald ist das Schönste hier. Ohne den Wald würden wir umkommen vor Staub und Sand. Und jetzt schlagen wir ihn Morgen für Morgen, denn er steht auf Kies. Wir könnten ja tiefer gehen, aber da ist der Sand zu fein. Schade! Die ausgebeuteten Flächen forsten wir natürlich wieder auf. Aber bis so ein Baum heranwächst! Das geht nicht so schnell wie beim Menschen. Oder man pflanzt Pappeln. Doch die geben keinen Wald. Übrigens brauchst du nicht zum See zu gehn, wenn du baden willst. Wir haben ein Schwimmbecken gebaut, wo früher die alte Lehmgrube war, der Pötterdiek. Für mich wäre das freilich nichts, man hockt da zu eng aneinander. Ich an deiner Stelle ginge zum See. Man legt sich ins Gras oder unter die Bäume und schaut auf das dunkelgrüne Wasser, sieht den Haubentauchern zu, den Blesshühnern, Libellen stehen überm Schilf, Störche treiben über die Wiese, der Rohrspatz schimpft, und hoch oben kreist die Gabelweihe. Du kannst auch in den Wald gehn, schmale Pfade zwischen Moos und Farnkraut. Hast du mal ’ne Eule aus dem Tagschlaf aufgeschreckt? Wie sie sich duckt und die Flügel spreizt, als wollte sie sich auf dich stürzen! Ach, was weißt du schon, du Stadtmensch!“
Das Mädchen mit dem rundlichen Gesicht beugte sich vor. „Sie sieht man aber niemals am See, Herr Latotzki. Und ich würde so gern mal mit Ihnen um die Wette schwimmen!“
„Als ich noch ’n Junge war, Doris, und auch später noch, als junger Mensch, da hatte ich keine Zeit, am Wasser rumzuliegen. Mein Vater war Pferdeknecht und ich der einzige Junge unter den fünf Kindern. Aber wir hatten einen wunderschönen See, dicht am Dorf, und mittendrin ’ne Insel aus Mummeln, am Ufer Kalmus und Binsen. Wisst ihr, wie Kalmus riecht? Ist auch gut gegen Krankheiten. Nachts, wenn der Pächter schlief, hab ich manchmal geangelt. Bei Vollmond waren auf der Mummelinsel Jungfrauen, aber ich konnte doch nicht schwimmen, ich hab’s auch später nicht gelernt. Was soll ich da jetzt am Badestrand? Soll ich mich mit den Dreijährigen im Flachen balgen? Ich geh in den Wald, da merk ich nichts von euerm Lärm.“
Martin hörte nicht mehr zu. In der Kurve sah er hinter einer Schonung die graue Esse eines Heizhauses aufragen. Er beugte sich vor und legte sein Gesicht an die Scheibe, als käme er so schneller an das Werk heran. Aber die Straße wandte sich wieder nach der anderen Seite, und sein Blick traf nur noch Schafgarbe und Disteln im Graben, ein bleiches Roggenfeld und einen schwarzblauen Wald am Horizont. Fast am Ziel, dachte er, und es befiel ihn eine seltsame Unruhe. Er streckte die Hand nach dem Koffer aus, um den Heftdeckel herauszunehmen, der ganz oben lag; er hatte Lust, mit den Fingern über die Zeichnung zu streichen und die Vertiefungen zu betasten, die seine Hand in das Papier gedrückt hatte.
Latotzki legte ihm die Hand auf den Arm. „Nächste Haltestelle erst!“ Das Mädchen stieg am Dorfanger aus. Das Werk lag seitab.“
1997 druckte Jüttners Verlagsbuchhandlung Wernigerode den „Sagenspiegel des Harzes. Von Geisterspuk und Hexenflug“ von Bernd Wolff: Teufelsmauer, Roßtrappe, Hübichenstein, Brocken, so vielfältig wie die Landschaft des Harzgebirges sind seine Sagen, in denen sich Denken und Hoffen, Freude und Schrecken, Leid und Zuversicht widerspiegeln. Dieses Sagenbuch, in dem Bernd Wolff die alten Begebenheiten auf eigene poetische Weise und mit der nötigen Portion hintergründigen Humors nacherzählt, hilft dem Leser über das Vergnügen am Text hinaus, die mündlichen Überlieferungen in ihrem historischen Zusammenhang zu begreifen. Dazu werden auch mitunter schriftliche Quellen herangezogen. Deshalb sind die Sagen nicht wie üblich nach Ortschaften, sondern nach Themenkreisen geordnet. Hüttenkobolde und Zwerge, Götter und Riesen, Hexen und der in diesen Bergen besonders präsente Teufel, Bergleute, Schatzsucher, Reiche, Arme und Geprellte sowie gruselige Nachtgeister bevölkern die Seiten. Jedes der übergeordneten Kapitel wird eingeleitet durch ein Zitat aus Goethes „Faust“, das zeigt, wie dieses Nationalepos unserem Gebirge besonders verbunden ist. So stellt sich unschwer die Verbindung von Volksdichtung und klassischer deutscher Literatur her, die beide aus einem Born geschöpft sind.
Und natürlich bietet der Harzer Sagenspiegel an der einen oder anderen Stelle auch Wissenswertes zur Walpurgisnacht, die besonders im Harz und auf dem Brocken alljährlich in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai gefeiert wird – und wie gefeiert und gefeuert! Der ungewöhnliche Name Walpurgisnacht leitet sich übrigens von der heiligen Walburga (auch Walpurga oder Walpurgis) ab, einer Äbtissin aus England, die von 710 bis 779 lebte. Traditionell gilt die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai als die Nacht, in der die Hexen insbesondere auf dem Blocksberg (eigentlich „Brocken“), aber auch an anderen erhöhten Orten, ein großes Fest abhielten. Diese Vorstellung ist beeinflusst von den Beschreibungen des Hexensabbat in der Literatur des 15. und 16. Jahrhunderts. Der Name Walpurgisnacht wurde insbesondere durch Goethes Faust (Teil I, 1808) popularisiert; frühere Belege sind aus dem 18. Jahrhundert nachweisbar. So heißt es in Adelungs Wörterbuch (1774–1786) unter Walpurgis: „der Walpurgisabend, die Walpurgis-Nacht u. s. f. im gemeinen Leben, der Walper-Abend, die Walper-Nacht. Da sich das Jahr bey den Deutschen so wohl, als den übrigen Europäischen Völkern, in den ältesten Zeiten mit dem ersten May anfing, so ist der in Ansehung der Walpurgis-Nacht bey dem großen Haufen noch herrschende Aberglaube vermuthlich ein Überrest davon, und der bey dem Jahreswechsel ehedem üblichem Gebräuche.“ Im 17. Jahrhundert erscheint bei Johannes Praetorius (Blockes-Berges Verrichtung, Leipzig 1668): „Ausführlicher Geographischer Bericht / von den hohen trefflich alt- und berühmten Blockes-Berge: ingleichen von der Hexenfahrt / und Zauber-Sabbathe / so auff solchen Berge die Unholden aus gantz Teutschland / Jährlich den 1. Maij in Sanct-Walpurgis Nachte anstellen sollen.“ Und was schreibt nun Bernd Wolff in seinem Buch „Sagenspiegel des Harzes. Von Geisterspuk und Hexenflug“?
Direkt unter dem Stichwort „Walpurgisnacht“ zum Beispiel dieses hier: „Brennen nicht Feuer auf den Höhen? Was für ein verbotenes Fest wird da gefeiert? Der Frühling kollert und rumort im Blut. Was für eine unheilige Brunst ist dort oben im Gange? Walpurgisnacht, das ist nicht der Defekt der alten Leute, sondern der der jungen, ihre groteske Vorstellungskraft, ihre abartige Fantasie. Und der Defekt der geschlechtslosen Männer – monachos: allein lebend – männiche, Mönche, die jedes Weib als die Pforte zur Hölle verfluchen, die die Konkurrenz der Naturgötter fürchten, die ihre eigenen unterdrückten Triebe in Perversionen ausleben. Ihre Verachtung der alten Bräuche und der alten Leute. Von da ist es nicht weit zur Verteufelung all dessen, was anders ist in Aussehen, Glauben, Wesen. Der Fremde mit fremder Lebensart. Das Kind mit dem Muttermal. Die ungewöhnlich schöne rothaarige Jungsche, die so unzüchtig blickt. Die über die Maßen erfolgreiche Nachbarin, der alles gedeiht, was ja wohl mit dem Teufel zugehen muss! Das undurchschaubare Treiben in ablegenen Mühlen. Hexen und Hexenmeister überall. Brennen! Brennen! Brennen! Hunderte? Tausende?
Manche sprechen von achttausend im Harz auf dem Scheiterhaufen verbrannter Menschen. Die Einwohnerzahl einer kleinen Stadt. Brockenhexen, das beliebte Souvenir.“ Und man spürt beim Lesen dieses aufklärenden und aufklärerischen Artikels zum Thema „Walpurgisnacht“, da steckt offenbar nicht nur Harmloses dahinter …
Zum Superpreis von nur 99 Cents gibt es diesmal noch etwas sehr Spannendes obendrauf: Als Eigenproduktion edierte EDITION digital im vergangenen Jahr sowohl als gedrucktes Buch wie auch als E-Book den Schwerin-Krimi „Die Tote im Pfaffenteich“ von Christiane Baumann, dem die Autorin eine wichtige Erklärung beigefügt hat, die allerdings ganz ehrlich gesagt, erst recht neugierig macht: „Alle handelnden Personen und ihre Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.“ Und wer sind die handelnden Personen?
Kommissarin Nora Graf ist die Hauptperson des im August 2016 spielenden Kriminalromans. Sie wird aus Berlin in ihren Geburtsort Schwerin strafversetzt. An ihrem ersten Abend entdeckt sie beim Spazierengehen die Leiche einer älteren Frau im Pfaffenteich. Tage später führt ihr untrüglicher Geruchssinn Nora in einer leer stehenden Wohnung zum Leichnam eines jungen Mannes. Besteht eine Verbindung zwischen beiden Morden? Oder zur Serie von Vergewaltigungen, von der die Stadt seit Monaten in Atem gehalten wird? Plötzlich taucht ein traumatisches Erlebnis aus Noras Schweriner Kindheit wieder auf. Ein Klassenkamerad starb. Wurde die Frau aus dem Pfaffenteich Opfer einer späten Rache? Nora sucht Kontakt zu ihrer früheren Schulfreundin Tamara und beginnt, sich in Schwerin einzuleben. Einen weiteren Mord kann Nora nicht verhindern. Sie muss ihre Angst vor offenem Wasser überwinden, um das Leben ihrer Tochter zu retten. Aber damit Kommissarin Nora Graf in ihrer früheren Heimatstadt überhaupt wieder aktiv werden kann, muss sie in Schwerin im doppelten Sinne des Wortes ankommen – seelisch und verkehrstechnisch, wobei schwer zu sagen ist, was schwerer ist:
„Sonntag, 31. 7. Ankunft
Nora Graf fuhr von der Autobahn ab. Auf einem Schild stand ‚Schwerin, 8 Kilometer‘. Ihr wurde etwas mulmig zumute. Die Würfel waren gefallen; es wurde wahr, was sie vor Wochen noch für unmöglich gehalten hätte: irgendwo anders als in Berlin leben und arbeiten. Sie hatte die Wahl gehabt: entweder ab ersten August die Stelle in Schwerin oder das war’s erst mal mit ihrem Job bei der Kripo.
Wenig später passierte Nora das Ortseingangsschild. Nur einzelne Fahrzeuge waren an diesem frühen Sonntagabend Richtung Zentrum unterwegs. Robert hatte ihr die Strecke vorgebetet, weil er wusste, dass sie aufs Navi verzichten würde. Der Gedanke an ihn war tröstlich. Wie rührend ihr Mann sie in den letzten Tagen betuttelt hatte; als träte sie eine Reise in die mongolische Steppe an. Dabei ging ihre Fahrt in die Stadt, in der sie vor siebenundvierzig Jahren zur Welt gekommen war und ihre ersten acht Lebensjahre verbracht hatte. Nach dem Umzug ihrer Familie nach Berlin war der Kontakt zu den Schweriner Familienangehörigen bald eingeschlafen. Nora hatte längst aufgehört, sich und ihre Geburtsstadt in irgendeiner Weise miteinander zu verbinden. Auch als feststand, dass sie hierhin strafversetzt werden würde, hatte sie nicht nach Kindheitserinnerungen gekramt.
Nora registrierte die vielen Wahlplakate am Straßenrand. Ah ja, sie hatte irgendwas von Landtagswahlen in Meck-Pomm gehört. An Laternenmasten hingen bis zu fünf Plakate übereinander. Wer sollte die denn beim Vorbeifahren lesen können! Dann ein Umleitungsschild. Noch eins. Betraf sie das etwa? Das hätte Robert wissen müssen! Nora beschloss, die Schilder zu ignorieren. Weil auf einmal der Wunsch in ihr aufkam, das Schloss zu sehen. Und da war es schon. Eingetaucht in die letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Ein Märchenschloss! Na ja, bis auf den Baukran. Der trübte den Schlossblick und half Nora, ein aufsteigendes Tränchen der Rührung zu unterdrücken.
Aber irgendwas stimmte nicht. Offensichtlich hatten die Umleitungsschilder einen Sinn gehabt. Sackgasse war angezeigt. Sie war falsch. Nora bog nach links ab und hielt. Wieso denn Sackgasse! Sie nahm den Stadtplan zur Hand und suchte ihr Ziel, den Pfaffenteich. Der würde wohl immer noch an seinem Platz sein. Nun gut, das müsste zu packen sein, umkehren, immer den Obotritenring lang, dann rechts halten … okay. Nora folgte den Hinweisen und landete schließlich in der Alexandrinenstraße. Links lag der Pfaffenteich. Es war fast geschafft, den Teich einmal umkurven, und sie wäre am Ziel. Nein, unmöglich. Was war das denn für eine Verkehrsführung!
Sie wollte unbedingt im Hellen ankommen; viel Zeit blieb nicht mehr. Rechts von ihr ein mächtiges, ocker angestrichenes Gebäude mit Zinnen und Türmchen. Das erkannte sie, aber der Name war weg. Nora wendete das Auto. Die Alexandrinenstraße zurück und rechts rum. In die Schelfstraße. Auch gesperrt. Mann oh Mann! Halt weiter geradeaus bis zur Werderstraße. Die durfte befahren werden.
In der Ferne erschien der große Turm des Schlosses. Nora konzentrierte sich auf die rechts liegenden Seitenstraßen. Sie fuhr die Amtstraße runter, an einer Kirche vorbei, und Nora war endgültig überzeugt, verkehrt zu sein. Sie konnte nur noch abwärts fahren. Gott sei Dank, am Ende einer abschüssigen Straße schimmerte der Pfaffenteich.“
Und eben dort am und im Schweriner Pfaffenteich, den nicht wenige Einheimische, vor allem aber Urlauber und Touristen gern mit der Hamburger Binnenalster vergleichen oder auch verwechseln, macht die Schwerin-Rückkehrerin ausgerechnet gleich am ersten Abend in ihrer alten-neuen Heimat eine Entdeckung, eine grausige Entdeckung. Aber die Kriminalkommissarin wäre keine Kriminalkommissarin, wenn sie nicht gleich die Spur aufnehmen würde – die Spur der „Toten im Pfaffenteich“. Und vielleicht wollen Sie Nora Graf bei ihren nicht ganz einfachen Ermittlungen und Schweriner Erkundungen begleiten?
Viel Spaß beim Lesen, entwickeln Sie Ihren eigenen kriminalistischen Spürsinn und bis demnächst. Und vielleicht sehen wir uns ja beim diesjährigen „Tanz in den Mai“? Walburga oder Walpurga würde sich bestimmt freuen. Ganz bestimmt.
EDITION digital wurde 1994 gegründet und gibt neben E-Books (vorwiegend von ehemaligen DDR-Autoren) Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern.
Insgesamt umfasst das Verlagsangebot derzeit fast 900 Titel (Stand April 2018)
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de