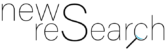Weit, weit in die Zukunft entführt uns Alexander Kröger mit seinem SF-Roman „Die Telesaltmission“.
Von der lebensgefährlichen Suche einer Expedition der spanischen Eroberer nach dem sagenhaften Goldland El Dorado handelt „Strom ohne Brücke“ von Otto Emersleben. Sein Roman spielt im 16. Jahrhundert n den Urwäldern des Amazonasgebietes.
Um den Kampf eines jungen Arztes um die medizinische Wahrheit geht es in „Wider die kleinen Mörder“ von Brigitte Birnbaum.
Außerdem bringt dieser Newsletter am Schluss ein Sonderangebot zum Super-Sonderpreis von 99 Cents. Worum es sich dabei handelt, das ist am Ende dieser Ausgabe zu erfahren. Aber zumindest alle Schwerin-Freunde dürfen jetzt mal ausnahmsweise – aber wirklich nur ausnahmsweise – schon mal kurz vorblättern …
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. Auch heute geht es noch einmal um den Zweiten Weltkrieg – und um das sich langsam wandelnde Verhältnis zwischen Menschen, die sich damals in der Sowjetunion als Gegner gegenübergestanden hatten, als Eindringlinge und als Überfallene. Würde es jemals gelingen, Feindschaft und Hass zu überwinden? Und das ist doch ein ebenso großes wie wichtiges Thema, das auch in der Gegenwart eine große Rolle spielt. Ist es tatsächlich möglich, Feindschaft und Hass zu überwinden? Bleibt zumindest ein Rest von Menschlichkeit? Hier eine literarische Antwort.
Erstmals 1983 erschien im Verlag Neues Leben Berlin „Auf Liebe stand Tod“ von Max Walter Schulz: Drei Novellen über deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg und ihre sich allmählich ändernde Einstellung zu den Menschen in dem Land, das sie überfallen haben. Ihre Liebe zu einer sowjetischen Frau spielt dabei keine unwesentliche Rolle. Ljuba ist tot. Dass Hellriegel es durch Gitta, seine geschiedene Frau, erfährt, hat Ljuba selbst so gewollt. Und auch, dass er nach Moskau zu ihrem Begräbnis kommt, wo er Andrej, ihrem und seinem Sohn, begegnen wird. Drei Jahrzehnte sind vergangen. Doch was im Jahr 1944 an der belorussischen Front mit Hellriegel und Ljuba geschah, rückt plötzlich wieder sehr nah. Ein Tag, fast schon Legende, kettete sie auf Tod und Leben aneinander, zwang sie gemeinsam zum Widerstand, erzwang ihre Kraft, Trennendes zu überwinden. „Mich interessiert die Möglichkeit des Menschseins mitten im Hass“, sagt Max Walter Schulz. In seiner neuen Novelle gestaltet er die ungewöhnliche Liebe zwischen einer sowjetischen Fliegerin und einem einstigen faschistischen Soldaten, der sein Vaterland verliert und sich selber gewinnt. Welcher Anstrengung bedarf es für Gitta, die Bedeutung jenes einzigen fernen Tages im Leben Hellriegels zu verstehen, und welch langen Weges bedarf es für ihn, sich ganz zu befreien? Tief in der Steppe, mitten im Zweiten Weltkrieg, begibt sich eine außergewöhnliche Geschichte: Der Soldat Röder, der als Gefangener mit einem Kommando die gefallenen Soldaten begräbt, wird von dieser Gruppe getrennt, und er findet sich wieder allein in der Nähe eines Dorfes, nunmehr als Gefangener von Frauen, die beginnen, ihre Häuser und Höfe wieder aufzubauen. Was erwartet ihn, was kann er erwarten? Er erwartet Hass und erfährt zunächst Hass. Aber im Verlauf des Geschehens verwandelt sich der Hass, und auch er selbst gewinnt neue Erfahrungen, und er wird nicht nur überleben, sondern eigentlich erst wirklich zu leben beginnen. Hier ein Auszug aus der ersten der drei Novellen von Max Walter Schulz, die den Titel trägt „Der Soldat und die Frau“. Er zeigt, wie sich die kriegsgefangenen Deutschen und ihre sowjetischen Bewacher zunächst gegenüberstanden:
„Im Kommando des Starschina wurde ordentlich gearbeitet, die tägliche Streckennorm, ein Dutzend und drei Kilometer, unabhängig vom Wetter wie von der Häufigkeit oder Seltenheit der aufgefundenen „Objekte“ streng eingehalten, alles Abzuliefernde abgeliefert, alles Teilbare genau geteilt. Der Starschina, ein Mann von vierzig Jahren, gedrungene Statur, beweglich wie ein Junger: das Gesicht sibirisch gegerbt, war schon ein Gerechter. Nur ein Vorrecht beanspruchte er: sich täglich sorgfältig zu rasieren. Sein Stellvertreter und einziger Soldat, ein blutjunger, lang aufgeschossener Bursche, verehrte den Starschina wie einen Vater und hasste die vier Kriegsgefangenen, über die das Kommando verfügte, obgleich sich diese arbeitswillig zeigten, als verkappte, der Not gehorchende Faschisten. Der Starschina schor die Deutschen nicht alle über einen Kamm. Sein instinktiver Argwohn galt den Offizieren und solchen Leuten, denen er den Studierten oder den „Meister“ ansah, mochten die Studierten hilflos und erbarmungswürdig aussehen oder die „Meister“ arbeitermäßig. Sie hätten es nach seiner Meinung besser wissen, hätten anders handeln, gegen den Krieg handeln müssen. Wissen ist doch auch Macht über sich selbst. Die vier Obergefreiten, die er für sein Kommando nach Augenschein ausgewählt hatte, besaßen seines Glaubens unstudierte, unmeisterliche deutsche Gesichter, möglicherweise noch menschliche Seelen. Wenn nicht – der Teufel soll sie holen.
Zur Ausrüstung des Kommandos gehörten Pferd und Karren. Der Karren, hochrädrig, mit einer langen Pritsche, von den Gefangenen „Eismann“ genannt, trug über der Achse eine aufgenagelte, verschließbare Bombenkiste. Unter der Achse hing ein Blecheimer. In der Kiste verwahrte der Starschina die Rationen: Brot, Salz, Tee, Graupen, Büchsenfleisch. Dazu die Sprengmittel für die Totengruben: Dynamitpatronen, Zündschnüre, gefundene Handgranaten. Dazu Grabgerät und Brecheisen. Dazu die gefundenen Waffen: Pistolen und Maschinenpistolen, von Karabinern nur die Schlösser. Und die Gasmaskenbüchse mit den abgenommenen Erkennungsmarken. Oben auf der Kiste lagen zwei Futtersäcke für das Pferd, zugedeckt mit den Schlafdecken und mit den steif gefrorenen Zeltbahnen, Stricke darübergezurrt.
Einer der Gefangenen verstand sich auf das Pferd, einen zottigen Panjehengst. Laut Starschina trug der Hengst den Namen „Arrestant“. Wohl weil er ein Ausbrecher war, wohl weil er eine sagenhaft-feine Witterung für alles Fressbare besaß und seinem Fresstrieb hemmungslos nachging, kilometerweit, wie sich eines Tages zeigte. Wenn er halbwegs satt war, bewies er Verstand, rückte mit der in ziemlicher Breite vorgehenden Suchkolonne ohne Kutscher und Anruf vor, umging Verwehungen, blieb ohne Anruf wieder stehen, wenn er sah, dass die Männer zurückblieben. Der Gefangene, der sich auf ihn verstand, brauchte nur zu rufen, dann trottete Arrestant zu der Stelle, wo ein Objekt gefunden und auf den Karren zu befördern war. Eines Tages jedoch, genau genommen am neunten Tag des Einsatzes, am frühen Vormittag, als der Karren noch leer war, hatte sich der Hengst plötzlich in Trab gesetzt, hatte die Richtung verlassen, war querab mitsamt dem Karren davongetrabt. Der Starschina hatte dem pferdeverständigen Nemetz zugeschrien, er solle die Bestie zurückholen und ihr die Zügel kurz binden. Der Mann war dem Pferd schon nachgelaufen. Er lockte es mit Pfiffen. Einen Wettlauf hätte er hoffnungslos verloren, schon wegen des schweren Wachmantels, den er trug und wegen all der Wollfetzen und Lumpen unter Rock und Hose, um Leib und Glieder gewickelt, mit Telefonkabel überschnürt, statt Unterwäsche. Der Hengst gehorchte, blieb stehen, erwartete den Mann, ließ sich kurz am Zügel nehmen. Aber mehr nicht. Den Rückweg verweigerte er mit gegrätschten, vorgestemmten Vorderbeinen. Der Mann stieg auf den Karren, gab dem Pferd die Zügel frei, hoffend, es werde sich bald müde laufen und lenken lassen. Viel hatte es sowieso nicht auf den Rippen. Als der Wagen anruckte, der Hengst gleich wieder scharf anging, hörte der Mann die Knabenstimme des blutjungen Wachsoldaten. Er drehte sich um. Der Junge kam ihm nachgelaufen, schrie, gab wütende Zeichen, stehen zu bleiben. Der Gefangene beschrieb mit der Hand einen Kreis in die Luft. Da gab der junge Wachsoldat einen Warnschuss ab. Der Hengst stellte die Ohren auf. Nun war er überhaupt nicht mehr zu halten. Der Mann auf dem Karren kam aus dem Stand, musste sich des Kutschbocks bedienen, der hohen Kiste, halb sitzend, halb stehend. Der Junge schoss noch einmal. Wenn er hätte treffen wollen, hätte er treffen können. Das Ziel suchte keine Deckung. Und der Panjehengst zog mit hochgeworfenem Kopf unbeirrbar irgendwohin. Die Hufe klopften munter auf die steinhart gefrorene Erde. Dem Mann überkam es zu denken, er sei jetzt ganz frei, es sei alles sein Wille, was das Pferd tat, er würde nie mehr im Leben gnädigen Herrschaften die Pferde satteln und den Steigbügel halten, nie mehr den jungen feinen Schnöseln, die aufs Gut kamen und prahlten, das Glück der Erde läge auf dem Rücken der Pferde – würde denen nie mehr die Hintern und Dickbeine mit Wundsalben einreiben. Und meinem Jungen, dachte der Mann, wird das auch erspart bleiben, wenn er heil davonkommt. Der Ofen geht denen bald aus. Sie haben hier zu viel verheizt. Und wer weiß, wozu es gut ist, dass sich Maria nicht mehr um den Jungen bangen muss, weil der Junge im Feld steht und so ein Draufgänger ist. Sie hat’s hinter sich gebracht. Die giftigen Dämpfe in der Spritzerei. Der gnädige Herr hat’s doch gewusst, dass sie schon immer schwach auf der Lunge war, schon als junges Mädchen. Er hätte sie nicht freisteilen dürfen für die Rüstung. Ihre Brust ist immer knospig gewesen, hoch und fest. Die junge Gnädige hat sie drum beneidet. Wenn wir schliefen, wollte Maria, dass meine Hand auf ihrer Brust lag. Sie hat gesagt, da träumt sie von dem braunen Fohlen auf der Koppel. Das braune Fohlen käme zu ihr, an ihre Haut mit seinen weichen Lippen.“ Und damit zu ausführlicheren Vorstellungen der anderen Sonderangebote dieses Newsletters:
Erstmals 1989 veröffentlichte Alexander Kröger im Verlag Neues Leben Berlin als Band 220 der Reihe „Spannend erzählt“ seinen Science-Fiction-Roman „Der Untergang der Telesalt“. Dem E-Book liegt die überarbeitete Auflage zugrunde, die 2013 im Projekte-Verlag Cornelius erschienen. Und sein Titel lautet jetzt „Die Telesaltmission“: Irdische Raumfahrer, auf der Suche nach erdähnlichen Planeten, stoßen auf Spuren einer früheren Raumexpedition und auf Einheimische, die auf einer niedrigen Entwicklungsstufe stehen. Nach abenteuerlichen Ereignissen ergeben sich Schritt für Schritt Vermutungen, die in Sicht auf Zukunftsvisionen der Menschheit nachdenklich stimmen und sich auf überraschende Weise bestätigen. Wieder stellt Kröger dabei interessante, bedenkenswerte Bezüge zu irdischen Entwicklungen her. Hier der Anfang dieses spannenden Romans, in dem es anfangs originellerweise auch um das Schreiben utopischer Romane in Zeiten geht, die wir Heutigen als gegenwärtige verstehen können, zumindest fast gegenwärtige und auch schon ein bisschen historisch:
„Zu Zeiten, als sozusagen die Steinzeit der Raumfahrt anbrach, wurden Tausende und Abertausende sogenannter utopischer Romane geschrieben, die das, was noch nicht war, gleichsam einer fernen Zukunft vorwegnahmen, vorausfantasierten. Dem Leser mehr oder weniger geschickt die Welt von morgen, die Errungenschaften der weiteren Menschheitsevolution, vorzuspekulieren, war das geschworene Ziel. Natürlich spielte da eine perfekte Raumfahrt die große Rolle. Mit Geschwindigkeiten unterhalb der des Lichts gab man sich meist nicht mehr ab … Nun, auch heute werden solche Romane verfasst und nach wie vor gern gelesen. Sie gehen weiter, operieren mit Hyperräumen, Wurmlöchern, Verwandlungen von Raum in Zeit und umgekehrt, kurzum, prophezeien ebenfalls – genau wie jene früheren Schriften – die Welt von morgen. So wurden unsere heutigen Photonenschiffe, die ja in der Tat mit nahezu Lichtgeschwindigkeit fahren, im Prinzip schon im Jahre 1960 beschrieben, als ihre Verwirklichung in den Sternen stand. Würde ein damaliger Leser, gesetzt den Fall, es gäbe einen Zeitsprung, meinen Bericht – zumindest den ersten Teil desselben – lesen, er könnte schon glauben, an einen solchen Zukunftsroman geraten zu sein.
*
Die FOTRANS 12 war ein gewöhnliches Schiff der Großserie zwölf, und wir befanden uns mit ihm – wie viele andere Mannschaften vor uns – auf einer planmäßigen, einer Routine-Expedition. Weder die Computerauswahl der Mannschaft noch die paritätische Geschlechtermischung und erst recht nicht die Anabiose bedeuteten für uns etwas Neues. Das war Raumalltag, gehörte zu dem von uns gewählten Beruf. Ich führe das an, um daran zu erinnern, dass eben vor einigen hundert Jahren solche Dinge durchaus nicht selbstverständlich waren und wir auf unserer Reise, und das machte ihre Besonderheit aus, gleichsam aus heiterem Himmel mit diesem Althergebrachten konfrontiert wurden.
Unser Auftrag war simpel. Seit Jahrhunderten sucht die Menschheit Alternativplaneten. Das wissen viele Zeitgenossen nicht, und vielleicht wird dieser Passus aus meinem Bericht gestrichen.
Zu irgendeinem Zeitpunkt werden die Sonne und mit ihr unser Planetensystem aufhören zu existieren. Der Untergang wird ein Prozess sein, der Hunderttausende von Jahren dauern wird.
Alternativplaneten sind so reichlich nicht gesät. Man muss rechtzeitig nach ihnen suchen, muss sie orten, erkunden, eventuell für eine Urbarmachung und Renaturierung vorsehen, diese mit höchstem Aufwand beginnen, auf dem Reißbrett zunächst und zurückhaltend. Das ist vorerst Kalkül, das aufrechnet. So wie man früher sparte, immer eine bestimmte Summe Geldes mehr – von Jahr zu Jahr. Man kann ja nie wissen … Es aber nicht zu tun, wäre sträflich.
Ich bin überzeugt, das ist Grund genug, Schiffe auszusenden in Räume, die Erfolg versprechen, resultierend aus langjährigen Beobachtungen.
Es ging nicht – wie ebenfalls vor Hunderten von Jahren in glücklicherweise nur vereinzelten Fällen – um nimmerwiederkehrende Pioniertrupps, um Kolonisatoren, es ging um Augenscheinnahme, um Messungen, Kartierungen, Analysen, um eine Registrierung, um weiter nichts. Es handelt sich also um eine Vorschau über die bislang vorstellbaren Zeiträume hinaus.
Einen solchen Auftrag hatten wir.
Wir reisten vier Jahre mit über 250 000 Kilometern je Sekunde in Anabiose, hatten fünf Jahre für die Suche und wiederum vier Jahre für die Rückreise. So besagte es die Grobplanung.
*
Zwei irdische Jahre kreuzten wir im System des Doppelgestirns Alpha Centauri. In der uns angegebenen Position befand sich in der Tat ein Planet, der jedoch die geforderten Bedingungen nicht annähernd erfüllte. Wir maßen, was es zu messen galt, landeten in drei verschiedenen Breiten und erlangten so Gewissheit. Unser Schiff nahm eine planetstationäre Bahn ein.
*
Der Trupp mit Bruno, Lisa und Friedrun war vor Stunden von der letzten Landung zurückgekehrt. Sie bestätigten abermals: keine Bedingungen, die unserem Suchschema entsprachen.
Aber natürlich hatten wir alles auf das Sorgfältigste registriert, die Bahnparameter eingespeichert. Vielleicht würden andere zu anderen Zeiten unter anderen Bedingungen anders, endgültig entscheiden.
Jederzeit würde der Planet – wir nannten ihn seines Erscheinungsbildes wegen der Graue – dank unserer Tätigkeit wieder auffindbar sein, und man würde wissen, was man von ihm zu halten hatte.
Eine Entscheidung stand bevor. Sie lag einzig und allein bei Bruno – letztendlich. Die Frage lautete: den Auftrag als erfüllt zu betrachten und Richtung Heimat aufzubrechen oder weitere zwei Jahre eine nunmehr ungerichtete Suche aufzunehmen.
Nun, so etwas formuliert sich leicht.
Die FOTRANS-Schiffe sind geräumige Stätten mit guten Arbeitsbedingungen, allem Komfort und vielen Annehmlichkeiten. Aber jeder wird sich vorstellen können, wie arg der Einzelne belastet ist. Schließlich wollten wir fertige, anwendbare Analysen zur Erde mitbringen. Trotzdem diskutierten wir Varianten, ob wir nicht abwechselnd – auch während des Suchprogramms – in Anabiose gehen sollten, einfach um psychischen Druck wenigstens teilweise zu kompensieren.“
Ebenfalls im Verlag Neues Leben Berlin und ebenfalls in seiner Reihe „Spannend erzählt“ – als Band 164 – veröffentlichte Otto Emersleben erstmals 1980 seinen Roman „Strom ohne Brücke“: Unter wehenden Standarten, im Gepränge ihrer Rüstungen und begleitet von Fanfarenklängen, brechen Anfang des Jahres 1540 dreihundertfünfzig Spanier mit einem Tross von dreitausend indianischen Trägern im peruanischen Quito zu einer Expedition auf. Ziel ist das Traumland aller spanischen Eroberer, das Land der Schätze, reich an Gewürzen und Gold, das Land mit den Namen Canela, Eldorado, Curicuri. An der Spitze des Unternehmens steht Gonzalo Pizarro, der jüngste Bruder des berühmt-berüchtigten Konquistadors. Unter großen Entbehrungen und Verlusten gelangt der Zug über die östlichen Anden hinweg bis in die Urwälder des Amazonastieflandes. Hier, am Ufer des Rio Napo, einem Zufluss des Amazonas, lässt Pizarro ein Schiff bauen und schickt es unter dem Befehl seines Stellvertreters Orellana stromab. Es soll so schnell wie möglich mit Proviant für die Zurückbleibenden wiederkehren und sie nachholen. Damit fällt die Entscheidung über das Schicksal der Expedition. Hier der Anfang des zweiten Kapitels, in dem der Leser sehr schnell in die Handlung geradezu hineingezogen wird. Und man spürt die wachsende Angst von einem der Spanier mit Namen Sanchez:
„Fast ein Monat verging, ehe ausreichend Holz für den Brückenbau am Ufer bereitlag: Zurechtgestutzte armdicke Äste, angespitzte Stämme und lange Taue, gedreht aus Lianen und Wurzelenden.
Im Wasser stehend, gegen die Strömung gestemmt, trieben Indios mit schweren Holzhämmern Pfähle in den Uferschlamm. Das schnell fließende graubraune Wasser zog schwarze Fahnen mit sich.
Neben den ersten Pfeilern der Brücke, an der sie bauten, ragten Indiokörper über das Wasser. Bebende, von Wirbeln und Wellen bewegte Stützen, ohne die keine Brücke je den Fluss überspannen würde. Das Pochen und Hämmern war überlagert vom Geschrei am Ufer und dem Klatschen der Bretter beim Stapeln. Ein frisch zugesägter Stamm wurde herübergereicht. Und neues Hämmern …
Da plötzlich begann sich das Wasser neben einem der Pfähle rot zu färben, in einer kräftigen, wie Zunderbrand ausgreifenden Strähne. Der grelle Schrei, mit dem das Rot aufgetaucht war, erstickte sofort. Stumm gestikulierend sprangen die Indios auf die schmalen Plattformen zwischen den Pfählen, zogen den letzten hinauf. „Pirayas, Pirayas!“, schrien sie, ängstlich bemüht, ihr Gleichgewicht nicht zu verlieren.
Erst jetzt merkte Orellana, dass einer der indianischen Brückenarbeiter fehlte. Er ließ Felipillo holen.
Schnell war die Sache geklärt mit den kleinen, bluthungrigen Fischen, die im Zusehen jeden Knochen bloßlegten und den Mann, war er erst einmal verwundet, sofort zu Tode brachten.
So blieb keine andere Wahl, als die Pfähle nun von der Höhe des jeweiligen Vorpostens aus in den Grund zu treiben. Gleichzeitig wurde der bereits fertige Brückensteg, von dem aus der Bau der eigentlichen Brücke, der Hängebrücke, erfolgen sollte, mit einem am Ufer gezimmerten Laufrost belegt.
Nun zeigte sich, wie umsichtig es gewesen war, den unterwegs krepierten Pferden jeden Hufnagel zu ziehen und auch die Eisen nicht liegen zu lassen. Und da Andreas Durante – Zimmermann seines Standes und der einzige, der wirklich etwas von solch einem Bau verstand – gut bei Kraft und Gesundheit war, stockte die Arbeit auch nach diesem Zwischenfall nicht.
Umsichtsvoll hieß er die Anderen Holz zuschneiden, passte es selbst in die Laufbretter ein. Orellana ließ Andreas gewähren, wenn er auch in keiner Minute seinen Blick vom Fortgang der Arbeit abwandte. Denn dies würde seine Brücke werden.
Gonzalo hatte die restliche Verpflegung in seine Gewalt gegeben. Er ließ sie von Pluto bewachen, dem letzten am Leben gebliebenen Bluthund, und teilte sie denen zu, die am härtesten arbeiten mussten – auch den Indios.
Alle, für die es beim Brückenvortrieb nichts zu tun gab, schickte Orellana in den Urwald zur Jagd.
Zwischen den Hütten am gegenüberliegenden Ufer schien das Leben erstorben zu sein, seit die Spanier den Ort bei ihrer Ankunft vor einem Monat zum Brückenkopf bestimmt hatten.
Sanchez, dessen Jagdtrupp einem Sumpfhirsch nachstellte, entdeckte eines Abends den Grund dafür.
Er hatte das Tier an einem Wasserloch beobachtet und war entschlossen, in der Dämmerung endlich zum Schuss zu kommen. Die Armbrustschützen verteilte er hinter Bäumen und Bodenwellen rund um den Tümpel. Selbst kletterte er, die Waffe umgehängt, über Lianenstränge und Äste in einen hohen Baumwipfel. Er sah sich die Augen aus, solange das Licht noch reichte, aber das Tier zeigte sich nicht mehr.
Da wandte er den Kopf. Blickte hin, wo noch Helligkeit war, zum offenen Himmel über dem Fluss. Sah dann am anderen Ufer hinab und entdeckte Rauchwolken, die aus dem Blätterdach der Bäume stiegen. Dort also saßen sie – und sicher auch wie er in den Bäumen.
Schnell fiel die Nacht auf den Teppich der Baumkronen. Fraß das letzte Licht über dem Fluss, erdrückte die Schreie einiger später Waldvögel.
Sanchez ertastete seinen Weg hinab über die Astansätze, schwang sich, an einer Liane hängend, kräftig und doch behutsam nach allen Seiten aus, bis er einen glatten Baumstamm zu greifen bekam. Lautlos glitt er zur Erde.
„Hernando!“
Keine Antwort.
„Hernando!“
Hatte er nicht hier in der Nähe den Freund postiert? Und – warum schwiegen die anderen?
Er tastete sich von Stamm zu Stamm, kletterte über umgestürzte Bäume, die in der Dunkelheit das Ausmaß riesiger Felsbrocken annahmen. Zum Fluss … Er musste so schnell wie möglich die anderen finden. Zur Nacht war man in diesem feindlichen Wald nur am Feuer sicher – vor dem Würgegriff der riesigen Anakondaschlange, vor dem Biss der Insekten und Spinnen, vor den Krallen des Pumas und den scharf schneidenden Zähnen bluthungriger Vampire.
Er musste die anderen finden … die anderen oder das Lager am Fluss.
Sanchez vergaß seinen Hunger und auch die Müdigkeit. Als seine Augen sogar in der undurchdringlich scheinenden Waldnacht zu sehen begannen, wählte er sich einzelne Bäume als Richtpunkte. Nur schnell vor zum Ufer, damit er nicht im Kreis lief – alles andere würde sich finden.
O Santa Maria la Bianca, betete er. Heilige Muttergottes von Toledo, bitte für mich armen Sünder. Ich habe mich über die anderen zu erheben versucht als ihr Truppführer. Nun aber bin ich von ihnen verlassen. Und doch habe ich nicht aus Eitelkeit gehandelt, war nicht hoffärtig, denk das nicht von mir, o Santa Maria la Bianca … In der Dunkelheit begannen die Lianenschlangen zu kriechen und die Bäume auf ihren Luftwurzeln wie riesige Lamas einherzustelzen.
Er raffte sich auf, hastete weiter. Fühlte sich plötzlich mit beiden Füßen im Wasser stehen.
Ob das die Hirschtränke war? Oder – war er endlich in Ufernähe? Sanchez sah sich um, aber die schwarz ausladenden Baumkronen starrten so riesig und so drohend auf ihn herab, dass seine Erinnerung an den Ort, wie er ihn im Dämmer des Tages gesehen hatte, verblasste. Er trat zurück aufs Trockene, umging den Tümpel. Plötzlich wusste er, dass er den Sinn für die Richtung verloren hatte.
O Santa Maria la Bianca!
Er horchte ins Dunkel. Aber nichts war zu hören als das Flügelwischen eines Fledermausschwarms, der sich langsam entfernte.“
Erstmals 1994 erschien im KIRO Verlag Schwedt/Oder „Wider die kleinen Mörder“ von Brigitte Birnbaum: In der Zeit, als das Fieberthermometer und der Gipsverband eben erfunden waren, kommt der junge Dr. med. Jacob Wullwäwer nach beendetem Studium heim, um gegen seinen Willen die väterliche Arztpraxis zu übernehmen. Er möchte lieber wissenschaftlich arbeiten, im Labor forschen, um den kleinen Mördern, den Bazillen und Bakterien, die bisher noch kein Mensch gesehen hat, auf die Spur zu kommen. Einige Professoren glauben, dass es Bakterien gibt, andere – sehr berühmte – nennen sie reine Hirngespinste. Jacob Wullwäwer ist überzeugt, dass sie existieren, genauso wie er davon überzeugt ist, dass die kleinen Mörder seine beiden Schwestern umgebracht haben, wenn es auch hieß, sie wären an Halsbräune gestorben. Aber ehe Wullwäwer sein Elternhaus betritt, hat er seinen ersten Patienten, den zehnjährigen Ole, und kann nicht, wie heimlich geplant, an die Universität zurück und auch nicht zu Professor Lister nach London reisen. Und so trifft der junge Arzt auf seinen ersten Patienten:
„Nur noch vereinzelte Schneeflocken wirbelten durch die Luft, als sich am späten Sonnabendnachmittag die Postkutsche von Schwerin her Jacobs Heimatstädtchen näherte. Rechts auf der Anhöhe das unbewohnte Schloss, und vor dem Ankömmling hob sich, stolz auf sein Alter, aus der Senke der gedrungene Spitzturm der Kirche. Ob wieder ein Wetterhahn drauf hockte, konnte Jacob aus der Ferne nicht erkennen. Ein Blitz hatte den wendigen Gockel im Juni vor fünf Jahren heruntergeholt.
Durch das Fenster erblickte Jacob die vertrauten Scheunen, die sich vor der Stadt längs der Landstraße reihten. Und er sah die Kinder. Ihn wunderte, dass sie nicht der Postkutsche entgegengerannt kamen. Im Vorbeifahren erkannte er, dass sie einen am Boden Liegenden umstanden, wie erstarrt und mit erschrockenen Gesichtern. Nur einer löste sich aus der Gruppe und lief, mit erhobenen Armen fuchtelnd und etwas schreiend, hinter der Kutsche her. Bei jedem Schritt über seine zu großen Schuhe stolpernd.
„Bettelpack!“, sagte die Dame neben dem jungen Arzt, „soll’n sich man bloß nicht vom Gendarm erwischen lassen.“
„Anzeigen müsste man so was!“, wurde sie von gegenüber unterstützt. „Ist ja Belästigung für unsereins.“
Dr. Wullwäwer ließ anhalten, sehr zum Unmut des Kutschers und der Mitreisenden.
Kaum war er samt seiner Tasche abgesprungen, rollte das Gefährt weiter.
Nach einigen hastigen, langen Schritten erreichte er die Kinder am Straßenrand, die vor ihm zurückwichen. Im zerwühlten, mit Blut bespritzten Schnee krümmte sich ein etwa Zehnjähriger. Seine blaugefrorenen Finger verkrampften sich oberhalb des rechten Knies im Stoff der Hose.
Der mit den großen Schuhen sagte: „Das Bein ist hin.“
„Nein! Ich brauch’s noch.“
Die Antwort gefiel Wullwäwer. Er zog seine Handschuhe aus und kniete sich zu dem Verunglückten. Durch die Wollfetzen des Strumpfes spießten die Knochenenden des gebrochenen Schienbeines. Drumherum klaffte eine grässliche Wunde, die stark blutete.
„Was ist denn passiert?“, wollte Wullwäwer wissen.
Sie waren auf Tonnenbrettern die Böschung heruntergerodelt. Er hatte dem Baum nicht ausweichen können.
„Den säg‘ ich ab!“, stieß der Verunglückte erbittert hervor. „Den säg‘ ich ab!“
Ein Bäumchen nur – und das einzige weit und breit.
Die Kinder wunderten sich, dass der Fremde nicht schimpfte. Er kniete noch immer, fasste mit drei Fingern das linke Handgelenk des Verletzten. Er schien auf etwas zu horchen. Dann fragte er freundlich: „Wer bist du?“
„Ole… einer von Flickschneider Schulten.“ Der Junge stöhnte und knirschte mit den Zähnen.
„Und ich bin Jacob Wullwäwer, der neue Doktor.“
„Ach…!“
Ungläubige Blicke fielen auf ihn aus der Runde.
„Ja. Wirklich.“ Wullwäwer richtete sich auf. „Du musst ins Hospital. Schnell!“
„Nein!“ Ole versuchte, sich zu wehren. Er spürte, wie ihm übel wurde. „Nein!“, schrie er. „Nein! Im Hospital sterben alle. Ich will nicht sterben! Ich will nicht!“ Er rollte sich zur Seite.
Wullwäwer blickte sich um.
„Nur dort kann ich dich behandeln.“ Amputieren würde er müssen. Was sonst? Das Bein abnehmen. Das konnte er nicht in der Schneiderstube erledigen. Auch nicht in der väterlichen Praxis. Er brauchte Hilfe dabei und im Hospital gab es einen Krankenwärter. Angestrengt überlegte Wullwäwer, was er zu tun hatte, Handgriff für Handgriff. Vor allem galt es, sich zu beeilen. Noch mehr Blut durfte der Junge nicht verlieren. Sein Puls wurde bereits flacher. Wullwäwer zerrte sich den Schal vom Hals und band ihn fest um Oles rechten Oberschenkel.
„Lauf zu Flickschneider Schulten!“, wandte sich Wullwäwer an den Großschuh. „Gib ihm Bescheid. Er soll ins Armenhospital kommen.“
„Wenn das man Vadding recht ist“, meinte der Angesprochene zögernd. „Von uns war noch niemals eins beim richtigen Doktor.“
Jaja, dachte Wullwäwer, während er sich weiter um Ole bemühte, von diesen Leuten wird die Hilfe des Arztes nicht gesucht. Fehlt den Kleinen etwas, ist es am besten, wenn sie sterben. Das gibt schöne Engel, und im nächsten Jahr wird wieder ein Kind geboren. Auch der alte Dr. Wullwäwer hatte selten Kinder kuriert. Für ein krankes Kind spannt kein Bauer sein Pferd an.
„Beeil dich!“, drängte Wullwäwer. „Und du, pack an! Soll er sich noch eine Lungenentzündung holen?“
Großschuh rannte los. Drei Jungen, einer kleiner als der andere, folgten ihm rutschend und schlitternd und sich immer wieder misstrauisch umwendend. Alles Brüder von Ole. Mit den restlichen Jungen bastelte Wullwäwer aus Tonnen- und Kistenbrettern ein schlittenähnliches Gefährt, um den Verletzten transportieren zu können.
Für Ole wurde es eine wahre Höllenfahrt. Das Armenhospital ZUM HEILIGEN GEIST, oder was davon noch übrig war, lag am westlichen Stadtende vor dem Lübschen Tor, auf dem Jarmstorf. Um den Weg abzukürzen, zogen sie über den Krähenort und die ungepflasterte Färberstraße. Aber viel machte das nicht.
Als die seltsame Karawane bei Bäcker Wanzenberg um die Ecke bog, trat der Meister, barfuß in Latschen und mit bemehlter Schürze, vor die Ladentür und rief erstaunt und zu einem Schwätzchen aufgelegt: „Nee, so was! Und die werte Frau Mutter glaubt, der junge Doktor sei gar nicht mitgekommen!“
Jacob Wullwäwer winkte ab, sicher, dass nun seine Mutter in spätestens zehn Minuten von seiner Ankunft wusste.
Die Bretter unter Ole verschoben sich. Er stöhnte vor Schmerzen. Wullwäwer fiel ein, dass er bisher noch nie eine Narkose eigenhändig gemacht hatte. Wie viel Chloroform würde er dem Jungen geben müssen? Dass in dem Hospital gar kein Chloroform vorhanden sein könnte, auf den Gedanken kam er gar nicht. Schließlich wurde die Anstalt einst von Nonnen nur für Pestkranke und Pockenfälle eingerichtet. Mitunter quartierte man auch auf der Wanderschaft erkrankte Handwerksburschen ein. Zu zweit in einem Bett, von denen es insgesamt fünf gab.“
Und damit sind wir bei dem anfangs angekündigten Sonderangebot zum Super-Sonderpreis von 99 Cents. Gerade eben hat die EDITION digital in einer Eigenproduktion die stadtgeschichtliche Publikation „Ernstes und Heiteres aus der Residenzstadt Schwerin“ von Detlev Dietze herausgebracht – und zwar sowohl als E-Book wie auch als geduckte Ausgabe: Die Zeit zwischen den Revolutionen 1848 und 1918 war einer der turbulentesten und aufregendsten Abschnitte in der deutschen Geschichte. Sie war geprägt von großen gesellschaftlichen Umbrüchen, der fortschreitenden Industrialisierung und dem Beginn und Ende der Wilhelminischen Epoche. Verfassungen wurden gegeben und wieder genommen. Kriege wurden gewonnen und verloren – und ein Kaiserreich wurde gegründet, das am Ende des Ersten Weltkrieges wieder zerbrach. Große Geschichte, die nicht vergessen wird. Aber Geschichte wird auch durch Geschichten geschrieben. Doch diese sind meist vergessen, obwohl sie den Alltag dieser Zeit prägten. Eine kleine Unachtsamkeit, welche mit einer Katastrophe enden kann, Zufälle, die große Pläne zerstören. Der Autor hat etliche Ereignisse, die sich im täglichen Leben der mecklenburgischen Residenzstadt Schwerin abspielten, recherchiert und in diesem Band gesammelt. 82 historische Ansichtskarten erleichtern dem Leser das Abtauchen in die Residenzstadt vor mehr als 100 Jahren. Unser Auszug ist der Beginn des Kapitels „Auf zwei Rädern“, der von einem auch heute wieder immer wieder beliebten Verkehrsmittel handelt, gewisse Abstimmungsschwierigkeiten mit Fußgängern eingeschlossen:
„Das Fahrrad beginnt seinen Siegeszug in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Als Verkehrsmittel gewinnt es schnell an Bedeutung, denn die Zahl der Fahrradfahrer wächst rasant. Überall in Deutschland werden Radsportvereine gegründet. Die Ersten in Schwerin sind der „Radfahrerverein von 1886“ und „Germania“, gegründet am 1. August 1895. Es folgen „Greif“ 1896 und „Wanderer“ am 9. Oktober 1899. Die beiden letztgenannten Vereine fusionierten miteinander und gelten als Vorläufer des heute in Schwerin bestehenden „Schweriner Radsport-Vereins“.
Damals wie heute organisieren sich Sportvereine in überregionalen Verbänden. Radfahrvereine der sozial schwächeren Schichten vereinigen sich im 1896 in Leipzig gegründeten Arbeiter-Radfahrer-Bund „Solidarität“. Der 1884 gegründete Deutsche Radfahrerbund, Vorläufer des heutigen Bundes Deutscher Radfahrer, gilt als Vertreter des bürgerlichen Lagers. Dem Verband, deutschlandweit in Gaue gegliedert, gehört auch der Schweriner Radfahrerverein „Germania“ an.
Der Verein ist Gastgeber und Ausrichter des Frühjahrsgautages des deutschen Radfahrerbundes, Gau 19 a, am Sonntag, dem 30. Mai 1897, in Schwerin. Die einheimischen Teilnehmer versammeln sich noch am Vorabend in Max Zanders Restauration Schlachterstraße 7 zu letzten Absprachen. Am nächsten Morgen treffen die auswärtigen Vereine ein. Sie werden von den „Germanen“ an den Toren der Stadt empfangen. Aus Lübeck kommen „Vorwärts“ und „Hansa“. „All Heil“ aus Wismar, „Schwalbe“ aus Parchim und ein Goldberger Verein treffen ein. Auch der Schweriner „Radfahrerverein von 1886“, der dem Radfahrerbund nicht angehört, ist eingeladen. Die Verhandlungen der Delegierten finden in Niendorffs Hotel in der Wilhelmstraße statt. Am Nachmittag soll den Schweriner Gastgebern auch etwas geboten werden. Auf dem Luisenplatz am Bahnhof haben sich 200 Radfahrer zur Teilnahme an einem Preiskorso aufgestellt. Korsowettbewerbe unter Radsportvereinen sind in jener Zeit sehr beliebt. Die Teilnehmer fahren zu festlichen Anlässen neben und hintereinander, geschmückt mit ihren Vereinsfarben, durch die Stadt. Eine Jury bewertet die Kleidung, die Ausschmückung der Räder und die mitgeführten Wimpel und Fahnen.
Angeführt von dem allgemein bewunderten Bannerträger von Lübeck auf seinem Hochrad, zieht der Korso vom Luisenplatz durch die Alexandrinenstraße, Kaiser-Wilhelm- und Schmiedestraße zum Markt, weiter über Königs- und Schloßstraße zum Alten Garten, wo der Korso endet. Teilnehmer und Publikum ziehen anschließend zu Krügers Restaurationsgarten nach Paulshöhe. Die Restauration gehört seit einem Jahr der Aktien-Gesellschaft-Paulshöhe. Beinahe täglich finden hier Konzerte statt. Heute spielt das von Otto Frommann geleitete Hoboistenkorps des Grenadierregiments.
Am Abend treffen sich Verbandsdelegierte und Korso-Teilnehmer wieder in Niendorffs Hotel, wo zu vorgerückter Stunde die Preisverleihung für die beim Korso erbrachten Darbietungen stattfindet. Der erste Preis, ein wertvolles Trinkhorn, geht an „Vorwärts Lübeck“. „Hansa Lübeck“ und der „Radfahrerverein Goldberg“ belegen die folgenden Plätze. Der mit 42 Punkten am höchsten gewertete „Radfahrverein Schwerin“ kommt nicht in die Wertung, da er kein Verbandsmitglied ist, erhält aber ein dekoratives Schreibservice als Ehrenpreis.
Dass die Schweriner auch Probleme mit den Radfahrern haben, zeigen zahlreiche Beschwerden in der Tagespresse. Besonders lästig fällt vielen Spaziergängern auf der Promenade nach Zippendorf das ständige Geklingel. „Hört man die Klingel, so muss man sich sofort umsehen, wie weit der betreffende Radfahrer von einem entfernt ist und wohin man ausweichen soll.“ Auch in der Stadt dieselben Klagen: „In rasendem Tempo geht es von der Münzstraße den Ziegenmarkt hinunter zur Amtsstraße, teilweise setzen die Radfahrer dabei sogar die Füße vorne aufs Rad, das ist doch gefährlich“, so ein empörter Leser.
Ludwig Davids, Buchhändler und Verleger von Rudolf Tarnows „Die Burrkäwers“, ist auf Radfahrer gar nicht gut zu sprechen. Regelmäßig stellt er sich ihnen in den Weg, um sie zum Absteigen zu zwingen. Solange, bis ihn einer eines Tages auf dem Arsenalberg über den Haufen fährt. Auch außerhalb wird mit Radfahrern nicht zimperlich umgegangen. Gelegentlich eines Radrennens im Juli 1897 auf der Strecke Schwerin–Ludwigslust wird „von böswilliger Hand die Fahrbahn der Chaussee in der Gegend des Ortkruges mit Schuhnägeln bestreut.“ Nicht wenige fahren sich einen Platten ein.“
Nun zumindest von solchen doch recht böswilligen Aktionen gegen Radfahrer hat man in heutigen Zeiten nichts gehört. Auch wenn sich Radfahrer, Autofahrer und nicht zuletzt Fußgänger auch 2019 nicht immer einig zu sein scheinen – wer denn nun Vorfahrt hat. Alles schon mal dagewesen, wie ein Blick in die informative Residenzgeschichte von Detlev Dietze beweist.
Spannende Lektüre versprechen aber auch die Suche nach Alternativplaneten und nach dem Goldland sowie der Kampf des jungen Arztes Dr. Dr. med. Jacob Wullwäwer um die medizinische Wahrheit und um das Leben des zehnjährigen Ole.
Viel Spaß beim Lesen, hoffentlich kommen Sie mit dem Folgen der Zeitumstellung vom letzten Sonntag einigermaßen zurecht, müssen nicht „in Anabiose“ gehen und bis demnächst. Ach, und wonach suchen Sie eigentlich?
EDITION digital wurde 1994 und damit vor nunmehr fast 25 Jahren gegründet und gibt neben E-Books (vorwiegend von DDR-Autoren) Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, derzeit fast 1.000 Titel (Stand November 2019).
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()