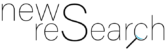In der Titelgeschichte war Lenny Frick, die Hauptfigur, schon immer in Autos vernarrt, doch seit er sein Cabrio „Sanfter Blitz“ besitzt, gehen bedrohliche Veränderungen in ihm vor. Er sieht die Welt mit den Augen der Fahrzeuge, wendet sich von seiner Frau und den Freunden ab, will mit den Menschen brechen. Wird er wirklich die besondere Lebensqualität erreichen, die er anstrebt?
Eine Liebesgeschichte jenseits aller Klischees erzählt Harry Schmidt in „Ein beschneites Feuerwerk. Sinnsuche und Liebesleben der Ulrike B. in zwei Systemen“. Im Mittelpunkt steht Industriegestalterin Rike. Sie ist keine Außenseiterin und auch nicht privilegiert. Sie muss als alleinerziehende Mutter Geld verdienen. Doch ihr Beruf wird nicht mehr benötigt. Und sie hat keine Schulter, um sich mal anzulehnen. Das Buch lotet Tiefen aus, ist sinnlich und pointiert geschrieben.
Mit einer auch in der DDR ungewöhnlichen Liebesbeziehung befasst sich Heinz Kruschel in seinem Roman „Meine doppelte Liebe“ aus dem Jahre 1983: die neunzehnjährige Erle, deren Freund Matti zur Armee einberufen wird, lernt einen kubanischen Studenten kennen. Sie will Matti nicht weh tun und führt ein Doppelleben, das sie in Konflikte bringt.
In „COWBOY Pitt“ erzählt Dietmar Beetz von Abenteuern einer Kindheit, zu der auch erstes Verliebtsein gehört – eine Geschichte, die in die Nachkriegszeit führt, doch nicht allein aus Nostalgie ihre Reize bezieht. Mysteriöses tut sich in und um Altenroda, einem Thüringer Dorf. So begegnen Pitt und Bernd, beide 12-jährig, im Wald einem rätselhaften Fremden, und Tage später stößt Pitt, der dem Dorfhirten beim Kühehüten zu helfen hat, auf Spuren, die zu einem verlassenen Bergbau-Stollen führen …
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Wie kann der Klimawandel gestoppt und unsere Erde, die Heimat der Menschen gerettet werden? Die heute vorgestellte Neuerscheinung zeigt, wie auch Kinder und Jugendliche dabei helfen können. Jeder kann helfen und etwas bewirken!
Ganz frisch aus den Druckmaschinen gekommen ist „Reise zum Schutz des Planeten. Von Eisbären, Bienen und Sonnenenergie“ von Gisela Pekrul, das bei EDITION digital sowohl als gedruckte Ausgabe wie als E-Book vorliegt: Tritt ein in eine Welt voller Abenteuer und Entdeckungen! Gemeinsam reisen wir von den schmelzenden Polkappen, über die Geheimnisse des Regenwaldes, bis hin zu deinem eigenen Zuhause, und erkunden, wie jeder von uns der Erde helfen kann.
Hast du dich jemals gefragt, warum Bäume so wichtig sind? Oder was genau in der gelben Tonne landet? In diesem Buch lernst du nicht nur viel über die großen Herausforderungen unserer Zeit, sondern auch, wie du selbst mit kleinen Taten Großes bewirken kannst. Mit spannenden Geschichten, kniffligen Rätseln und lustigen Spielen wirst du zum echten Umwelt-Entdecker!
Für alle kleinen Weltretter und die, die es noch werden wollen. Ein Buch, das inspiriert, motiviert und auf spielerische Weise zeigt: Jeder kann helfen und etwas bewirken!
Während des gesamten Monats Oktober preisgesenkt ist außerdem der erstmals 1967 im Verlag Neues Leben Berlin erschienene Utopische Roman „Als die Götter starben“ von Günther Krupkat, einem der wichtigsten und besten Autoren der frühen SF-Literatur der DDR: Fünf Jahre, bevor der Name von Däniken auf dem Büchermarkt erschien, veröffentlichte Günther Krupkat seinen Roman „Als die Götter starben“. Ausgehend von einer Hypothese des sowjetischen Wissenschaftlers Agrest, wonach die große Steinterrasse von Baalbek am Fuß des Antilibanongebirges als Start- und Landeplatz außerirdischer Raumschiffe gedeutet werden könne, bezog er astronomische Fakten und biblische Überlieferung in eine phantastische Handlung ein. Sie beginnt im Dämmerlicht der Frühgeschichte und endet in einer strahlenden Zukunftsvision.
Schauen Sie rein in das spannende Buch:
Der siebente Tag, Immer noch arbeiten die Roboter im Schacht; es ist nicht abzusehen, wann sie auf die Sohle treffen werden. Mit eingefallenen Gesichtern hocken Olden und Gombare vor dem Schutt, den die Förderkörbe auswerfen. Fast mechanisch greifen sie nach Steinen und Splittern. Die Lider ihrer Augen sind geschwollen, entzündet von der tagelangen Sichtarbeit.
Olden spricht selten ein Wort. Er braucht seine ganze Energie, um wach zu bleiben und die Aufmerksamkeit nicht erlahmen zu lassen. Es könnte ja doch … Stein um Stein fliegt zur Seite. Nichts … nichts!
„Die Stücke sind seit gestern wesentlich kleiner. Finden Sie nicht auch?“, sagt Gombare. „Schwerere Brocken kommen fast nicht mehr.“
Olden nickt, starrt auf das, was seine Hände erfassen. Steine, Steine, Steine …“
„Wera meint, dass wir spätestens …“ Gombare unterbricht sich. Er blickt auf Olden, der auf einmal unbeweglich dasitzt, so sonderbar still, dass es Gombare die Kehle zuschnürt. „He, Erik!“, ruft er mit heiserer Stimme.
„Percy!“, flüstert Olden, ohne den Kopf zu wenden.
Als Gombare zögernd herantritt, bemerkt er in Oldens Händen einen kleinen Gegenstand. „Was ist das?“, fragt er.
Olden reicht ihm das sonderbare rundliche Ding.
„Sie … fanden das … hier?“, stammelt Gombare. „Es könnte beinahe …“
„Es ist ein Mikrofon!“ Olden springt auf, packt den anderen und schüttelt ihn. „Ein Mikrofon!“
Gombare sieht Olden fassungslos an.
Der entreißt ihm den Fund, „Sehen Sie!“ Er löst mit zitternden Händen einen Teil der metallisch glänzenden Hülle. „Eine uns fremde Bauart und doch unverkennbar das Prinzip des Schallwandlers. Hier befanden sich Kontaktschrauben. Die Leitung ist herausgerissen. Und dort sind Spuren eines Bindemittels, so etwas wie Mörtel. Wahrscheinlich war das Mikrofon in eine Mauer eingelassen,“
„Technik unserer Entwicklungsperiode!“, murmelt Gombare verblüfft.
Die beiden wechseln einen Blick. Dann stürzen sie zu dem Trümmerhaufen, den ein Förderkorb gerade ausgeschüttet hat. Sie werfen sich auf den Boden, durchwühlen in fieberhafter Eile das Geröll.
Ein Stück Kabel kommt zum Vorschein, später verbogene Rohre, ein paar Schalthebel. Nun fällt den Männern ein Lukendeckel vor die Füße. Er ist aus unbekanntem, metallähnlichem Stoff gefertigt. Und Zeichen stehen darauf. Keilschriftartige Zeichen!
Mit einem erstickten Laut bricht Olden über dem Deckel zusammen.
Gombare ruft Wera.
„Stoppen Sie den Roboter!“
„Ist etwas passiert?“
„Funde, Wera! Funde!“
Am folgenden Morgen trifft Novak ein. Er umarmt Olden. Worte findet er vor Erregung nicht.
Bleich, aber mit leuchtenden Augen, führt Olden den Gast zum Bunker, wo die ersten Funde sorgsam verwahrt sind. Es ist inzwischen noch vielerlei hinzugekommen: Bruchstücke polierter Wände und Fußböden, Leitungsdrähte, automatische Türen. Bemerkenswert ist die sparsame Verwendung von Metall. Fast alles ist aus synthetischem Material hergestellt.
„Mir fällt auf, dass nicht ein einziger Einrichtungsgegenstand zutage gefordert wurde“, bemerkt Novak. „Alles, was Sie bisher sammeln konnten, sind Dinge, die sich im oder unterm Mauerwerk befunden haben mussten.“
„Wir nehmen an, dass die Fremden ihre Anlagen systematisch geräumt haben, als sie den Phobos verließen“, erklärt Olden. „Das ist natürlich schade. Aber wir hoffen, noch mehr zu entdecken“, setzt er hinzu.
Nach der Besichtigung des Schachts kehrt Novak zum Planeten zurück. Olden und Varkony begleiten ihn. Über das Videophon von Aeria meldet Olden dem Weltforschungsrat seine ersten Erfolge.
Konski winkt ihm zu. „Der Fehlschlag in den Mondalpen ist wettgemacht, lieber Olden. Nun haben wir Beweise! Ich danke Ihnen und Ihrer Gruppe und beglückwünsche Sie. Alf Curtius ist gerade auf der Erde. Auch er wird sich freuen. Was wir nach unserem besten Können vermögen, soll in den Dienst Ihrer großartigen Aufgabe gestellt werden. Ich bitte Sie, Stan Novak, als Leiter des Hauptstützpunktes Mars diesen Wunsch und Willen des Forschungsrats zur Kenntnis zu nehmen.“
Zwölfter Tag. Der Grund des Schachts liegt frei. Die Räumautomaten werden zurückgezogen. Olden, Wera und Gombare fahren mit dem Paternoster hinab. Oben warten die anderen, stumm, voll Spannung über den Rand gebeugt, bereit, sofort einzugreifen, falls Hilfe vonnöten ist.
Die Sohle besteht aus einem glatten Belag, der sehr massiv zu sein scheint. Immerhin hat er dem Einsturz standgehalten, ohne auch nur die geringsten Risse aufzuweisen.
Meter für Meter untersucht Olden den staubbedeckten Boden. „Glauben Sie wirklich, darunter noch mehr zu finden?“, fragt Gombare.
„Die Trümmer, die wir beseitigten, stammen zweifellos von irgendwelchen Nebenräumen. Das wenige, was wir geborgen haben, beweist nur, dass die Räume technischen Zwecken dienten. Es muss im Phobosinneren noch mehr geben, als wir bis jetzt wissen,“
„Erik, hier ist eine Luke!“, ruft Wera.
Überrascht stehen die drei vor einer Falltür.
„Da haben wir’s!“ Olden tastet die Platte ab. Sie lasst sich nach einigen Anstrengungen heben. Eine schmale Wendeltreppe wird – sichtbar. Zögernd setzt Olden den Fuß darauf. Er leuchtet mit der Handlampe hinab. Die Windungen der Treppe behindern jedoch den Blick nach unten.
„Vorsicht!“, mahnt Wera. „Was zeigt der Strahlenmesser?“ Olden wirft einen Blick auf sein Gerät. „Unbedeutende Aktivität.“
„Dann los!“, drängt Gombare.
Die Treppe will kein Ende nehmen. Die Lichtkegel der Lampen gleiten von Stufe zu Stufe voraus.
„Wir sind unten!“, flüstert Olden.
Am Fuße der Treppe bleiben sie wie angewurzelt stehen. „Unfassbar!“, stammelt Wera.
Im bleichen Lichtschein leuchten metallische Zylinder und große Aggregate auf. Rund um den Raum, der einer Maschinenhalle gleicht, läuft ein System mächtiger Rohre.
„Wie eine Anlage für Kernumwandlungen“, sagt Gombare. „Eine Art Synchrotron“, ergänzt Wera.
Olden schüttelt den Kopf. „Alles ist anders: die Maschinen, ihre Formen, bestimmt auch der Zweck der ganzen Einrichtung.“ „Da, sehen Sie!“ Wera deutet auf eine Schalttafel. „Wieder Keilschriftzeichen!“
„Sonderbar!“, sagt Olden. „Diese Schrift zeigt andere Züge als jene, die ich auf dem Trümmerstück in den Mondalpen fand. Ich kann sie nicht lesen. Li muss es versuchen.“
Sie durchschreiten vorsichtig die Halle.
„Man könnte meinen, dass diese Anlage vor kurzem noch in Betrieb war“, bemerkt Gombare, sich umsehend.
„Die seltsame Verwandlung des Lenny Frick“ von Klaus Möckel erschien erstmals 1985 im Verlag Das Neue Berlin. Lenny Frick war schon immer in Autos vernarrt, doch seit er sein Cabrio "Sanfter Blitz" besitzt, gehen bedrohliche Veränderungen in ihm vor. Er sieht die Welt mit den Augen der Fahrzeuge, wendet sich von seiner Frau und den Freunden ab, will mit den Menschen brechen. Wird er wirklich die besondere Lebensqualität erreichen, die er anstrebt?
Mit seinen fantasievollen Erzählungen schließt Möckel hintergründig-ironisch an die "Einladung" und den Band "Die Gläserne Stadt" an. Erneut werden zeitliche und räumliche Verschiebungen, der Kosmos, Utopie und Antiutopie benutzt, um menschliche Verhaltensweisen aufs Korn zu nehmen. Ein Wissenschaftler findet eine Methode, verlorenes Gewissen zurückzugeben, ein rechtschaffener Bürger wird von dem defekten Automaten eines Dienstleisters an den Rand des Ruins gebracht. Besuch aus einer Spiegelwelt trifft ein; ein Mann entdeckt die Fähigkeit in sich, ihm missliebige Personen ins Fernsehen zu verbannen, ein anderer vergeht sich an der Natur und muss erleben, wie sie zurückschlägt.
Ideenreichtum und stilistische Vielfalt zeichnen diese Storys aus, die direkt für die Auseinandersetzungen mit den Widersprüchen heutiger Zeit geschrieben scheinen. "Möckels phantastische Erzählungen sind köstlich. Es gibt Angebote zum Nachdenken. Er wandelt sicher vom skurrilen Humor zur bissigen Satire… Man wird angestachelt, sich und andere neu zu entdecken." (Christoph Hinrich in der "Jungen Welt" 10.02. 1984)
Und hier eine Leseprobe:
Um mobiler zu sein, lud er ein batteriebetriebenes tragbares Fernsehgerät in seinen PKW, das er überallhin mitschleppte. Man muss zugeben, dass er über die Stränge schlug, sich in Dinge mischte, die ihn nichts angingen. Wenn es noch richtig schien, dass er einen Spitzbuben ins Gefängnis schickte und einen Feigling zum Zahnziehen, so befremdete es doch, einen Verkehrspolizisten, der ihm wegen zu hoher Geschwindigkeit zwei Stempel verpasst hatte, dreimal durch die Fahrprüfung fallen zu sehn. Einen Journalisten, der ihn mit seinen eintönigen Artikeln ärgerte, ließ er als Zeitungsträger arbeiten und eine unhöfliche Serviererin als Dienstmagd bei einem geizigen Gutsherrn. Er begnügte sich manchmal auch nicht mehr mit nur einer Person, sondern schickte die Fußballnationalmannschaft, als sie zum dritten Mal ein wichtiges Spiel verlor, geschlossen zur Arbeit in eine Lederfabrik. Im Stadion kam es bei dieser Gelegenheit zu Tumulten, die lange im Gedächtnis blieben.
Rensch wurde übermütig und maßlos. Wenn ihm seine Frau das Essen nicht nach seinen Vorstellungen bereitete, musste sie einen Kochkurs besuchen, und wenn der Abteilungsleiter seine Arbeit kritisierte, wurde er zum Maschinenputzer degradiert. Es machte ihm gar nichts aus, Kollegen oder Bekannte mehrfach derselben demütigenden Behandlung zu unterziehen; eine Sekretärin, die ihm zu vorlaut war, wurde in "Alles Trick" zu Marmor, zwei Techniker, die einen Fehler in seinen Berechnungen entdeckt hatten, mussten in der "Artistenparade" aufs Hochseil. Ein paar Schulkinder, die sich über ihn lustig machten, wurden in Ferkel verwandelt, mehr als einmal starb sein unmittelbarer Vorgesetzter in einem Krimi einen abscheulichen Tod.
Rensch hatte die Fähigkeit, sich über alles und jedes zu ärgern, so weit entwickelt, dass er keine Zeit mehr fand, sich am Leben zu erfreuen. Jedes Hundekläffen, jedes Lachen in seinem Rücken brachte ihn in seinen "hypnotischen" Zustand. In den wenigen Augenblicken, die ihm das Suchen nach neuen Opfern ließ, dachte er mitunter sehnsüchtig an die Jahre zurück, da er sich noch nicht ständig hatte aufregen müssen. Manchen Fehler hatte er gar nicht bemerkt, anderes nicht so ernst genommen. Wenn ihm jemand zu dumm gekommen war, hatte er mit der Faust auf den Tisch geschlagen – gut. Man lebte, da gab es auch Unangenehmes. Jetzt war er stetig unzufrieden, wütend auf alle Welt. Die Arbeit litt darunter, das Familienleben; Karsten rannte auf sein Zimmer, wenn der Vater eintraf, die Frau ging ihm aus dem Weg. Und wenn ich einfach versuche, wie früher zu sein, überlegte der Technologe, geriet aber beim Nachsinnen schon wieder in Zorn. Und der Bengel nebenan, der immer so laut das Kofferradio aufdreht, der Busfahrer, der mir gestern vor der Nase wegfuhr? Rensch saß in seinem Sessel vor der Flimmerkiste, er fühlte sich vereinsamt. Frau, Sohn und selbst die Katze hatten sich verkrümelt, der Goldfisch war längst in Karstens Zimmer gebracht worden.
„Ein beschneites Feuerwerk. Sinnsuche und Liebesleben der Ulrike B. in zwei Systemen“ von Harry Schmidt erschien 2018 bei EDITION digital. Industriegestalterin Rike ist keine Außenseiterin und auch nicht privilegiert. Sie muss als allein erziehende Mutter Geld verdienen. Doch ihr Beruf wird nicht mehr benötigt. Und sie hat keine Schulter, um sich mal anzulehnen. Statt die neuen Freiheiten zu nutzen, arbeitet sie sich ab an deren Zwängen. Manchmal aber bricht sie aus. Da sprühen an ihrem Himmel die Funken. Eine tapfere, illusionslose Suche nach Sinnerfüllung im Leben, nach Schönheit und Glück. Eine Liebesgeschichte jenseits aller Klischees. Tiefen auslotend, sinnlich, pointiert.
Überzeugen Sie sich selbst:
Nach dem nächtlichen Plotten kamen Schlag auf Schlag neue Projekte. Einfamilienhäuser zumeist, die Rike versuchte, auseinander herzuleiten. Gestalterisch konnte sie nichts tun. Auch nicht beraten. Wenn der Chef mit dem Bauherrn zusammen saß, war sie gar nicht dabei.
Dann wollte er plötzlich eine Visualisierung. Drei der Häuser sollten einen Wohnpark bilden. Mit Rasenflächen, Wegen, Stellplätzen und ein paar Bäumen drum herum. Der Bauträger brauche es für die Bank, sagte der Chef. Und er selbst brauche es bis Mittwochfrüh. Ganz einfach! Keine detaillierte Konstruktion, nur Hüllen! Nur Klötze! Eine Darstellung in Baukasten-Optik reiche vollkommen.
Er habe das Rendering doch nicht gekauft, wagte Rike einzuwenden …
„Die Basisvariante natürlich! Ohne Lichtquellen und dem ganzen Pipapo!“
Rike schüttelte den Kopf. Beim besten Willen –, das sei nicht zu schaffen!
Er sah sie durchdringend an. „Versuchen Sie es doch erst mal!“ Und angewidert den Mund verziehend: Wenn er etwas nicht ausstehen könne, dann Leute, die keinen Kampfgeist hätten. Außerdem stehe ihr das Büro auch abends zur Verfügung. Da habe er volles Vertrauen zu seinen Mitarbeitern.
Sie versuchte es mit der Hüllenfunktion und anschließender Isometrie. Es funktionierte nicht. – Keine Chance!
Der nächste Tag dann wurde zum Fiasko. Rike war nachts schon dauernd aufgewacht; fühlte sich morgens schon zerschlagen. Die Wände der Häuser sahen noch ganz ordentlich aus. Mit den Fenstern, das ging auch noch an. Bis auf die Terrassentüren, die schwarze undurchsichtige Scheiben hatten. Aber die Dächer! Meistens brach der Befehl einfach ab. Wenn nicht, schwebten die Flächen mit den Ziegeln in der Luft oder durchbohrten die Wand. Rike versuchte es nicht zehn, nein, wohl an die hundert Mal.
Irgendwann ließ sich die Datei nicht mehr öffnen. Und Rike war um sechzehn Uhr wieder da, wo sie morgens angefangen hatte.
Sie rief Felix an. Der war sofort am Apparat. Aber bedrückt, wortkarg. So als habe er all seinen lässigen Optimismus verloren. Das sei doch nur eine Notvariante für ganz einfache Fälle, begann er die Programmfunktion zu erklären. Und siezte Rike sogar. Korrigierte sich dann mit einem kleinen, unfrohen Auflachen. Da funktioniere sicher einiges nicht, meinte er noch. Dazu gebe es auch eine lapidare Mitteilung, irgendwo im Benutzerhandbuch. Das sei wie Auto fahren mit dem Notrad. Man komme nur langsam vorwärts und habe immer ein ungutes Gefühl.
Rike fand seinen Vergleich nicht recht passend. Immerhin konnte man damit fahren! – Aber das war ja auch egal.
„Und jetzt?“
Ja, da könne er ihr auch nicht helfen, murmelte er kaum verständlich.
Rike sagte gar nichts mehr. Legte aber auch nicht auf. Sie hörte ihn atmen am anderen Ende der Leitung. Er schien noch zu überlegen, mit sich zu kämpfen.
„Und wenn du es – einfach mit der Hand zeichnest? Nach guter alter Designer-Tradition?“
Ja, meinte Rike resignierend, das müsse sie dann wohl. „Und du?“, fragt sie ihn noch. „IMPROVISIERT deine Frau wieder?“
Er murmelte etwas, das wie eine Bestätigung klang.
Rike folgte einem plötzlichen Impuls: „Soll ich sie einfach mal anrufen, mit ihr reden?“
„Nein, bloß das nicht!“, rief er ins Telefon. Er schien sehr erschrocken zu sein. Dann haben sie sich wohl verabschiedet. Es gab ja auch nichts mehr zu sagen.
Rike fuhr schnell nach Hause. Aß hastig. Hörte nur mit halbem Ohr, was Anne ihr von einem neu zugezogenen Jungen erzählte. Der in die Parallelklasse gehe. Der langsam wie eine Schildkröte sei. Und der rede wie ein alter Opa.
Rike fuhr zurück in die Firma.
Es war schon etwas unheimlich, abends so allein in der Mühle. Überall knarrte und schurrte es, obwohl doch ruhiges Herbstwetter war. Immer wieder meinte Rike, unten Schritte zu hören. Bis sie es nicht mehr aushielt und von innen abschloss.
Dann schrie eine Eule, ganz wie im klassischen Gruselfilm. Der Ton kam von oben, aus dem Gebälk. Da saß sie wirklich. Ziemlich klein, reglos, gelbäugig, nur manchmal den Kopf wie in Zeitlupe bis auf den Rücken drehend. Nun schien sie Rike entdeckt zu haben. Und machte artig einen Knicks. Es war ein Steinkauz. Rike sah es sofort: Waldkäuze hatten nicht so einen platten Kopf, so eine niedrige Stirn. Der Vogel rief erneut sein: „Qui–witt! – Komm mit!“ – Nein, so schnell gab sie nicht auf. Da konnte der lange schreien!
Sie hatte sich an den winzigen Arbeitsplatz des Lehrlings gesetzt. Sie räumte die Zeichenmaschine frei und begann, den Wohnpark zu skizzieren. Die Müdigkeit bröckelte langsam ab von ihr. Machte nach und nach einer leicht angespannten Befriedigung Platz. Rike fühlte sich auf sicherem Terrain. War nicht mehr abhängig von irgendwelchen unkalkulierbaren Reaktionen der Maschine. Sie sah mit Wohlgefallen, was da entstand unter ihren Händen. Zum Schluss setzte sie noch ein paar farbige Akzente. Und trällerte sogar dabei. Leise und etwas rasselnd. Kurz nach Mitternacht war sie fertig. Der Kauz hatte seinen Balken längst verlassen.
Am Mittwochmorgen dann kam sie später. Hatte aber einen Zettel hingelegt. Sie war immer noch stolz auf ihr nächtliches Werk. Allerdings auch ein bisschen besorgt. Schließlich hatte sie den teueren Arbeitsplatz einfach links liegen lassen.
Der Chef war noch nicht da. Frau Roth zuckte nur mit den Schultern. Erst als Rike mittags zurückkam von der Dönerbude am Markt, saß er mit einem weißhaarigen, langmähnigen Mann unten im Büro. Er nickte nur flüchtig. Sie diskutierten über Bankkredite und Fördermittel. Und plötzlich klappte die Tür, und beide waren verschwunden. Rikes kolorierte Isometrie lag noch auf dem Tisch.
Der Auftrag des Bauträgers mit den langen, weißen Haaren zerschlug sich wieder. Doch der Chef meinte zu Rikes Überraschung, er finde es gut, wenn sie ab und an die Computerzeichnungen händisch ergänze. Mit ihrer persönlicher Handschrift abrunde.
Der Roman „Meine doppelte Liebe“ von Heinz Kruschel erschien erstmals 1983 im Verlag Neues Leben, Berlin. Die neunzehnjährige Erle, deren Freund Matti zur Armee einberufen wird, lernt einen kubanischen Studenten kennen. Sie will Matti nicht weh tun und führt ein Doppelleben, das sie in Konflikte bringt. Als Orestes plötzlich nach Kuba zurückmuss, kümmert sich Erle nicht mehr um Studium und Prüfungen, dabei wäre sie gern Lehrerin geworden. Probleme über Probleme, aber Erle schlägt alle Hilfsangebote aus.
So fühlt sich Liebe an:
Das muss Liebe sein.
Mein Verstand macht mir Vorwürfe, aber ich komme mir schön und glücklich vor.
Ich werde an Matti schreiben: Du, ich habe jemanden kennengelernt und glaube, bisher gar nicht gewusst zu haben, was Liebe überhaupt ist.
Das kann man nicht schreiben.
Draußen ballt sich Schnee. Im All ziehen Gestirne ihre Bahn. Feuchtigkeit dringt in Poren und Kleider. Noch nie habe ich das Wort „ich“ so bewusst gedacht. Ich, ich bin mehr als eine Königin.
Oft wusste ich nicht, was ich von einem zum anderen Tag wollte. Heute weiß ich es: Ich will ihn wiedersehen.
Ist mein starkes Gefühl eine große Untugend?
Ich weiß: Das ziemt sich nicht, das ist frivol, du bist untreu, ein Luder, nicht verkommen, also noch zu retten; aber wenn du so weitermachen solltest, dann sieht man dich nicht mal mehr durch den Zaun an.
Das kann man von mir sagen. Die Leute können sich von mir aus die Finger steif zählen, wenn sie mir sagen wollen, was ich alles bin.
Es ist mir egal.
Über Nacht taut es. Der Boden verliert die schützende Schneedecke, aber dann setzt wieder Barfrost ein, der sich in die nackte Erde beißt.
Nun wird mir bange. Ich warte auf ein Zeichen. Hundertmal sehe ich sein Bild, in Straßen, an Haltestellen, hinter Fenstern, in unserem Zimmer. Ich werde noch tagblind.
Bang wird mir, weil ich denke: Ob er sich an mich erinnert? Ob er mich wiedersehen will? Da soll man heiter und festbleiben. Ich schreibe den Satz auf den Zettelblock in unserem Zimmer: Für mich gibt es nichts Schöneres auf der Welt als ein Liebespaar, und wenn ich jemanden sagen höre, lieben bedeutet, die eigene Freiheit und Integrität zu verlieren, frage ich, ob wir von demselben Gefühl sprechen. Der Satz stammt von Anne Philipe. Aber zur Zeit, da ich ihn noch nicht wiedergesehen habe, fühle ich mich unfrei.
Manchmal schreibt mir Mattis Mutter. Sie ist eine berühmte Briefschreiberin, sie schreibt täglich an irgendwen. Und immer steht in den Briefen an mich etwas über Matti. Matti ist ihr ein und alles. Sie tut so, als habe sie ihn persönlich aus ihrem Körper gemacht, als habe sie Lebenswichtiges geopfert, damit er entstehen konnte, Matti, ein Teil von mir, mein bestes Stück. Ich verstehe ihre Briefe, denn meine Briefe an Matti tragen zurzeit mehr Ballast als Ware.
Wie soll Frau Richards begreifen, was jetzt geschieht? Welche Kette von Gefühlen, die ich ahne: erst Überraschung, dann Schrecken, dann Verzweiflung, Vorwurf und vielleicht gar Abneigung und Hass.
Er kam, stand vor dem großen Hörsaal. Magnifizenz hatte den „Handschuh“ gesprochen. Den Dank, Dame, begehr ich nicht. Dieser Stolz des Ritters. Und verlässt sie zur selben Stunde. Stand mein Orestes also da, ein Ritter Delorges in Jeans und wildlederner Jacke, die schon abgeschabt war, ließ sich von vielen Studentinnen betrachten, nickte ihnen freundlich zu und küsste mir beide Hände, tatsächlich beide Hände. Es durchfuhr mich wie auf dem Fasching beim Tanzen. Ich musste lächeln, weil ich an den Eliza-Dünnhorn-Effekt denken musste. Mein Lächeln war sicher dumm. Aber mir wurde heiß, mir wurde kalt, ich stand unter Strom, alle Zonen meines Körpers.
Orestes sieht aus wie einer der Jungs aus „Blutige Erdbeeren“. Wir liefen los, redeten wenig, als könnte reden den Zauber zerreißen. Wohin wir liefen, ich weiß es nicht. Ob wir etwas aßen an einer Bockwurstbude, ob wir etwas tranken, heißen Tee oder Grog, ich habe keine Ahnung mehr. Wir liefen wie Traumtänzer.
Orestes studiert am Fremdspracheninstitut, und Mercedes ist keine Freundin, sondern eine Kommilitonin. Also eine gute Freundin und keine Geliebte.
Wir küssten uns und ließen uns anrempeln. Dreimal liefen wir zu meinem Internat und zurück. Er spricht gut deutsch. Aber wir schwiegen meistens, Reden hätte die unsichtbaren Fäden zerreißen können.
Wenn Orestes mich anfasst, durchzuckt es mich, ich möchte die Augen schließen und fliegen. Das ist der Eliza-Dünnhorn-Effekt. Das denke ich mir, Eliza Dünnhorn kann ich nicht mehr danach fragen, aber sie hatte es mir erklärt, diese schöne alte Dame, die immer ein weißes Häubchen und weiße Spitzenkragen trug und ihr Haar in ein Netz steckte. Ich musste auf meinen Klavierlehrer warten, da fragte sie mich nach Matti und ob ich unter Strom stünde, wenn er mich mit den Fingerspitzen berührte oder die Hand gäbe. Ich musste lachen, na, unter Strom nun gerade nicht. Da erzählte sie mir, dass diese Elektrizität, dieser unsichtbare Strom das einzige und untrügliche Zeichen von Liebe sei. Mit dem Menschen musst du leben, sagte sie, ein elektrischer Schlag, wenn solch ein Mann dich berührt, schon wenn er deinen Fuß unter dem Tisch unbeabsichtigt berührt. Du musst die Augen schließen wollen und alles vergessen, jede Etikette, das Benehmen und alles, was du gelernt hast an Moral. Es hatte einen jungen Freiwilligen in ihrem Leben gegeben, im Jahr 1918, er war neunzehn Jahre alt, vier Wochen hatte sie ihn gekannt, in den vier Wochen hätte sie nicht gewusst, ob sie überhaupt gegessen, getrunken, geschlafen habe. Er war gefallen und hatte von ihrer Zuneigung nie erfahren, aber sie liebte nur ihn, heute noch. Dünnhorn, mit dem sie über fünfundfünfzig Jahre verheiratet war: eine Ehe, die aus Gewöhnung, Anpassung und Verschweigen bestand. „Glauben Sie mir, Fräulein Erle, das gibt es nur einmal, der Mensch erlebt das nur ein einziges Mal, und wenn er ewig leben sollte. Wenn man das erlebt, dann weiß man erst, was Gott unter Liebe verstanden hat, als er sich dieses Gefühl ausdachte, dieser Effekt hat mit einem erogenen Stromkreis zu tun.“ Sie verdrehte die Augen, seufzte und dachte sicher an den jungen Freiwilligen des Jahres 1918.
„COWBOY Pitt“ von Dietmar Beetz erschien erstmals 2001 im Verlag Edition D.B. Mysteriöses tut sich in und um Altenroda, einem Thüringer Dorf. So begegnen Pitt und Bernd, beide 12-jährig, im Wald einem rätselhaften Fremden, und Tage später stößt Pitt, der dem Dorfhirten beim Kühehüten zu helfen hat, auf Spuren, die zu einem verlassenen Bergbau-Stollen führen … Beetz erzählt von Abenteuern einer Kindheit, zu der auch erstes Verliebtsein gehört – eine Geschichte, die in die Nachkriegszeit führt, doch nicht allein aus Nostalgie ihre Reize bezieht.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Kinderbuch:
Stunden später schleppte sich Pitt die Bergflanke von Altenroda hinauf. Jeder Schritt fiel ihm schwer; am liebsten hätte er sich überhaupt nicht mehr bewegt.
Er war allein und auf dem Weg nach Hause, doch wenn er an daheim dachte, an die Großeltern, an die Mutter, an Kurti, musste er sich zwingen, weiter zu gehen und nicht umzukehren.
Womöglich noch schlimmer – Gedanken an Bernd und an Tine, an sie hauptsächlich. Weniger auch an den Gangels-Siegfried und an die Schule, in die er übermorgen früh wieder würde gehen müssen.
Jetzt war Sonnabendnachmittag, kurz nach fünf – eigentlich eine der schönsten Stunden der Woche. Zu dieser Zeit herrschte daheim meist Feiertagsstimmung – mehr noch: Vorfreude auf den Sonntag, den Feiertag. Die Mutter und die Großmutter hatten saubergemacht und eingekauft, und nun duftete es in der Küche nach Bohnenwachs und manchmal nach Kuchen. Dazu las der Großvater aus seiner „Dorfzeitung“ vor oder aus einem Buch, falls er nicht in der Werkstatt saß und von der Hobelbank aus das Haus mit Zitherklängen erfüllte.
Erinnerungen, die Pitt die Kehle zuschnürten. Er schniefte. Und ging dann noch langsamer.
Es half nichts. Egal, wann er heimkommen würde, halb sechs, um sechs oder erst halb sieben, er würde sich stellen müssen, hintreten vor die Großmutter, die Mutter, den Großvater, vor Kurti, es ihnen sagen.
Sich ihre Gesichter vorzustellen, die Enttäuschung, den Kummer …
Pitt schluchzte. Die Augen blieben trocken. Zu viel hatte er schon geweint, geheult, seit er losgelaufen war, losgehetzt im Wolkenbruch, zunächst zu jenem dschungelartigen Wuchs, wo sich, wie er hoffte, Lissy verkrochen, vielleicht verirrt hatte, als sie, wie er annahm, geflohen war, geflüchtet vor dem Fauchen der Lüfte, dem Donnern und Krachen.
Fichtenwuchs, noch unberührt von Äxten und Sägen, noch ungelichtet; Zweige, die zuschlugen, zerkratzten, Wasser wie ein umgekippter Schirm schwallartig herabgossen; Durchgänge wie Tunnel neben dem Hauptdurchlass, der Fortsetzung jenes Weges, hier nicht nur überwachsen und nun in ein Bachbett verwandelt, sondern vermutlich unter der trüben, gurgelnden, talwärts schießenden Flut seit langem ein kaum begangener, alle Spuren verschlingender Streifen Morast.
Pitt kehrte um, schlug sich nach rechts, nach links ins Dickicht, durchquerte den Wuchs, suchte unten weiter, im Harzscharrersgrund.
Den Bach, der reißend geworden war, durchwatete er mehrfach, aber einen Aufstieg zum Höhenrücken über dem Pochwerksgrund und die Erkundung des oberen Berglochs unterließ er.
Lissy finden, sie wiederfinden!
Zu allem anderen war ihm die Lust vergangen.
Irgendwann hörte das Donnern, das Krachen auf, und dann hatten sich wohl die Wolken entleert. Die Düsternis wich dem üblichen Dämmer, der hier selbst bei Sonnenschein herrschte.
Unter den Bäumen troff und tropfte es noch lange, und nun bemerkte Pitt auch, wie nass er war.
Die Joppe im Rucksack, gewiss.
Als käme es jetzt noch darauf an!
Wahrscheinlich hätte Pitt schon zu diesem Zeitpunkt, halb drei etwa, aufgegeben. Da aber glaubte er, in der tropfenden, dampfenden Stille des Waldes Bläken zu hören, den angstvollen Schrei eines Kalbes.
Es wurde das Startsignal für weitere verzweifelte Vorstöße.
Auch sie lagen mittlerweile Stunden zurück.
Drei Viertel sechs hatte Pitt die Anhöhe des Dorfes erreicht, war er eingebogen auf den Feldweg, der zwischen abgeblühten, von den Wassermassen malträtierten Kartoffeläckern zum Gehöft der Großeltern führte.
Leute da vorn. Aber das waren doch die Mutter und die Großmutter! Und Kurti natürlich.
Zum Schluss noch ein Ausschnitt aus dem Buch für 6- 10-jährige Kinder „Reise zum Schutz des Planeten. Von Eisbären, Bienen und Sonnenenergie“ von Gisela Pekrul:
Die grünen Helden unserer Erde
Während die frisch gepflanzten Bäume noch klein und zerbrechlich waren, spürten die Kinder dennoch eine besondere Energie, die von ihnen ausging. Eines Abends, als die Dämmerung einbrach, saßen Ilijan, Noah und Joshua bei ihrem Lieblingsbaum und beobachteten die jungen Pflanzen. Zu ihrer Überraschung begannen die Bäume zart zu flüstern.
Ein besonders mutiger Setzling, der in der Nähe des großen Eichenbaums gepflanzt wurde, sprach leise zu den Jungs: "Vielen Dank, dass ihr uns hier gepflanzt habt. Wir werden groß und stark werden, um dem Planeten zu helfen. Doch wir brauchen die Hilfe aller."
Joshua schaute neugierig auf den Setzling. "Wie können wir dir noch helfen?"
Der Setzling antwortete: "Erzählt den Menschen die Geschichten des Waldes. Lasst sie wissen, dass jeder Baum, jeder Strauch, jedes Blatt wichtig ist. Erinnert sie daran, dass sie uns beschützen und pflegen müssen, so wie wir sie beschützen."
Ilijan sah zu seinen beiden Freunden und sagte: „Habt ihr euch jemals gefragt, warum Bäume so wichtig sind? Nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt?“
Joshua runzelte die Stirn. „Sie geben uns Schatten und sie sehen hübsch aus?“
Noah kicherte. „Das auch! Aber sie tun noch viel mehr. Bäume sind wie riesige Staubsauger für schlechte Luft. Sie nehmen das für das Klima schädliche Kohlendioxid, CO2, aus der Luft auf, das wir ausatmen und das durch Autos und Fabriken in die Luft gelangt. Dann verwandeln sie es mit Hilfe von Wasser und Sonnenlicht in Nahrung für die Bäume und geben dabei Sauerstoff ab, den wir zum Atmen benötigen. Das nennt man Fotosynthese, habe ich in einem Buch gelesen.“
Joshua staunte: "Das ist also, wie die Bäume wachsen! Indem sie das CO2 in Nahrung umwandeln! Aber was geschieht mit dem Kohlendioxid, auch CO2 genannt?"
Noah lächelte: "Ein Großteil des CO2 wird in den Stämmen, Ästen und Wurzeln gespeichert. Das heißt, je größer und älter die Bäume werden, desto mehr CO2 können sie aufnehmen und speichern. Sie sind wie Naturarchive, die Kohlendioxid lagern, damit es nicht in der Atmosphäre bleibt."
Ilijan fügte hinzu: „Genau! Und je mehr Bäume es gibt, desto mehr Kohlendioxid können sie aufnehmen. Das hilft, die Erderwärmung zu verlangsamen. Deshalb nennt man sie auch Klimaretter.“
Doch dann wurde Joshua nachdenklich. „Aber was ist mit all den Nachrichten über das Abholzen von Bäumen? Vor allem im Regenwald? Warum tun die Menschen das?“
Noah seufzte. „Der tropische Regenwald wird oft als Lunge der Erde bezeichnet, weil er so viel Sauerstoff abgibt und das schädliche Kohlendioxid aufnimmt. Aber viele Bäume werden abgeholzt, um Platz für Felder zu schaffen, auf denen Soja angebaut wird, oder um Weideland für Rinder zu haben. Auch werden viele Bäume für wertvolles Holz gefällt.“
Ilijan fügte hinzu: „Auch in unserer Heimat werden Bäume gefällt, manchmal um Platz für neue Gebäude zu schaffen oder weil das Holz für Möbel oder Papier gebraucht wird. Es ist wichtig, dass wir auf unsere Wälder aufpassen.“
Joshua hatte eine Idee: „Was, wenn wir im Dorf einen Tag des Baumpflanzens organisieren? Jeder könnte einen Baum pflanzen. Damit würden wir nicht nur unsere Umgebung verschönern, sondern auch etwas für das Klima tun!“
Die Kinder waren begeistert von der Idee und setzten ihren Plan in die Tat um. Am „Tag des Baumpflanzens“ kamen alle Dorfbewohner zusammen und pflanzten Hunderte von Bäumen.
Noahs Gedanken gingen noch weiter: "Wir könnten eine Waldschule gründen! Dort könnten die Dorfbewohner alles über den Wald, seine Bewohner und seine Bedeutung für die Erde lernen."
Die Jungs waren sofort dabei und planten eifrig. Sie bauten im Wald kleine Lernstationen auf, an denen die Dorfbewohner und vor allem die Kinder mehr über das Pflanzenwachstum, die Tierwelt und die Vorteile eines gesunden Waldes erfahren konnten.
Mit der Zeit entwickelte sich die Waldschule zu einem beliebten Treffpunkt. Die Dorfbewohner kamen regelmäßig, um die Bäume wachsen zu sehen, die Vögel zu beobachten und die Geheimnisse des Waldes zu entdecken.
Die Waldschule lehrte auch die Bedeutung des nachhaltigen Lebens. Familien begannen, weniger Plastik zu verwenden, recycelten mehr und verwendeten umweltfreundliche Produkte. Bauern achteten darauf, den Boden nicht zu überanspruchen und setzten auf biologische Anbaumethoden.
Jahre später, als die Bäume hoch und stark waren, erkannten die Dorfbewohner, wie wichtig diese grünen Helden für die Gesundheit des Planeten waren. Der Wald wurde zum Symbol des Dorfes und diente als ständige Erinnerung daran, wie jeder Einzelne zum Schutz der Erde beitragen kann.
Auch wenn die utopisch-satirische Lenny-Frick-Autonarr-Geschichte schon vor nunmehr fast vier Jahrzehnten geschrieben und veröffentlicht wurde und damit gewissermaßen Oldtimer-Qualitäten besitzt, könnte man sich fragen, ob es nicht auch als ein Beitrag zur aktuellen Debatte Auto versus Schiene oder Individualverkehr gegen Öffentlichen Personennaheverkehr (ÖPNV) gelesen werden kann? By the way: Sind Sie vielleicht auch Besitzer eines 49-Euro-Tickets?
Auch wenn zum Beispiel Bahnfahren unter diesen Bedingungen nicht nur Spaß macht, so kann man die Zeit dennoch zum Lesen nutzen – klassisch mit einem Buch oder mi einem E-Book-Reader. Genügend Stoff dafür hätten Sie ja auch mit der heutigen Post aus Pinnow dabei …
Viel Vergnügen beim Lesen, weiter einen schönen Herbst, bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.
Und in der nächsten Woche meldet sich nach längerer Pause wieder einmal „Friseur Kleinekorte“ von C.U. Wiesner zu Wort. Kleinekorte? Na, bestimmt erinnern Sie sich an seine berühmten Begrüßungssätze für seine Stammkunden: „Nehmse Platz, Herr Jeheimrat! Was gibsn Neues aufm Bau? Wieder Nachtschicht gehabt?“
EDITION digital war vor 29 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.300 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()