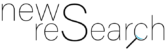In die Zeit nach dem Kennedy-Mord 1963 entführt uns wie gewohnt spannend Wolfgang Schreyer mit seinem Abenteuerroman „Der gelbe Hai“. Alles fängt in Miami an, wo abends Sprühregen aufkommt, die beleuchteten Palmen vor dem Hotel „Commodore“ im Wind tropften. Und irgendwo auf dem Weg durch die Stadt hatte sich ein Schatten an den Erzähler gehängt …
In „Der Lügner und die Bombe“ erzählt Egon Richter vier untypische Liebesgeschichten für Männer. Aber wieso untypisch?
„Schüsse im Hafen“ von Heiner Rank ist ein Zoll-Krimi, der in den frühen Jahren der DDR spielt.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Heute ist es eigentlich kein ganz so großes weltbewegendes Thema. Oder vielleicht doch? Es geht um Respekt gegenüber Menschen und Tieren und darum, wie Vertrauen produziert wird und welche Sprachen man lernen sollte.
Erstmals 1983 veröffentlichte Martin Meißner im Kinderbuchverlag Berlin „Manuel und der Waschbär“: Manuel wohnt in einem Kinderheim, umsorgt von verständnisvollen Erziehern. Und doch: Das Heim ist nicht sein Zuhause. Dort gibt es die lebenslustige Mutter. Besonders als ihr neuer Partner in der Familie lebt, fühlt sich der Junge geborgen. Mehr als es ein leiblicher Vater kann, kümmert er sich um den Jungen. Als der Mann eines Tages wortlos davon geht, versteht Manuel das nicht. Auf seine Weise versucht er mit den bitteren Erfahrungen fertig zu werden. Das geht nicht gut.
Aus Angst vor neuen Enttäuschungen wird er immer mehr zum Einzelgänger. Das ändert sich auch nicht, als er im Kinderheim lebt. Selbst dem freundlichen Sprachheillehrer gelingt es nicht, sein Vertrauen zu gewinnen, so sehr er sich auch bemüht. Manuel schwänzt den Unterricht. Sitzen sich Lehrer und Schüler einmal gegenüber, so schweigen sie meistens. Der Junge lässt sich kein Wort entlocken.
Doch eines Tages bricht er sein Schweigen und fragt den Lehrer, ob er auch die Sprache der Tiere beherrscht. Verblüfft rettet sich der Lehrer zunächst in eine Lüge. So erfährt er, warum Manuel unbedingt mit einem Tier sprechen muss. Aber kann ihm der Lehrer dabei wirklich helfen?
Hier die ersten drei Kapitel dieses berührenden Kinderbuches, wo gleich zu Beginn zwei Eier fehlen. Wer kann es gewesen sein?
„1. Kapitel
Ein Diebstahl war entdeckt.
Als Manuel die Treppe des Kinderheims hinaufging, drang Lärm aus der Küche. Die Tür stand offen. So breiteten sich die lauten Worte über das ganze Treppenhaus bis hinauf zum Obergeschoss aus. Der Junge blieb stehen.
Frau Bohndiek hielt einen Korb in der Hand und trug ihn von einer Frau zur anderen. Fast das ganze Personal hatte sich versammelt. „Zählt sie nach“, flehte sie. „Zwölf müssen es sein. Und wie viel sind es?“
Die anderen wussten es längst. Nur zehn Eier lagen in dem Korb. Aber die Erzieherin gab nicht eher Ruhe, bis jede gezählt hatte und bestätigte: Zehn Eier waren es und nicht zwölf.
„Es stiehlt einer die Hühnereier aus den Nestern“, schloss Frau Bohndiek. Dann setzte sie sich wie ein Wächter vor den Korb.
Manuel ging bis zum Treppenabsatz weiter und schaute aus dem Fenster. Unten sah er den Hof mit dem Holzschuppen und dem Hühnerstall. Hinter einem hohen Zaun aus Draht schloss sich der Garten an. Rechts Gemüsebeete und Obstbäume. Links der Rasen, wo die Schaukeln, Wippen und ein Karussell standen. Auch Autoreifen, die genauso bunt angemalt waren wie das übrige Spielgerät. Weiter hinten floss die Purnitz vorbei. Das war ein Bach, der sich bescheiden hinter dichtem Gebüsch verbarg.
[*] Kapitel
Am Abend konnte niemand einschlafen. Alle dachten an den Eierdieb.
„Ich habe mal einen fremden Mann gesehen, der kam aus dem Hühnerstall“, erzählte Kai, der für seine erfundenen Geschichten bekannt war. „Er trug etwas unter der Jacke. Sie beulte so aus.“
„Nun legen die Hühner bestimmt nicht mehr“, erklärte Ricardo.
„Warum?“
„Ich weiß nicht. Ich denke mir das.“
„Nein“, erwiderte Kai. „Hühner legen immer. Die können gar nicht anders. Wenn sie keine Eier legen, dann sterben sie.“
„Woher weiß Frau Bohndiek, dass Eier fehlen?“, fragte Manuel. „Es kommen immer welche dazu.“
„Sie weiß es eben“, antwortete Kai. „Es müssen jeden Tag zwölf sein. Das war schon immer so. Außerdem lagen Eierschalen herum. Wenn man sie zusammensetzt, werden zwei Eier daraus.“
„Es kann ein Tier gewesen sein“, vermutete Ricardo.
„Ein Tier?“, fragte Manuel.
„Ja. Es gibt Tiere, die nehmen gerne Nester aus.“
So ging es hin und her. Die Jungen erfanden die unmöglichsten Täter. Bis die Nachtwache hereinkam und endgültig für Ruhe sorgte.
[*] Kapitel
Am nächsten Morgen dachte kaum noch einer an den Eierdieb. Wie immer freitags kam Herr Lockstedt ins Kinderheim. Das war der Sprachheillehrer.
Manuel sah den Mann erst, als er den Flur bereits betreten hatte. So drückte er sich zwischen Topfpalme und Aquarium, um nicht gesehen zu werden.
Andere Kinder stürmten wie immer auf den Lehrer los. Eine ganze Traube umringte ihn.
„Lasst meine Jacke“, sagte er und lachte. Er bahnte sich einen Weg in den Unterrichtsraum.
Herr Lockstedt hatte eine Glatze und einen Bart wie ein Gebüsch. Er trug gelbliche warme Schuhe, mit denen er leise wie ein Elefant ging.
Seine Brille hing schief im Gesicht und sah aus, als hätte sie ein anderer weggeworfen.
Als erster war Kai mit dem Unterricht an der Reihe. Als er herauskam, schwenkte er stolz sein Arbeitsblatt in der Hand. Darauf waren einige Tiere gestempelt. Er ging an die Küchentür und rief hinein: „Hier. Das habe ich gelernt. Lauter Tiere. Elefanten und Kamele. Ich durfte sie selber stempeln.“
Kai sprach jetzt gut. Aber Herr Lockstedt unterrichtete ihn weiter, weil er eifrig bei der Sache war und solchen Spaß hatte.
Manuel hörte, wie Kai auf der Treppe sang:
„Affen, Esel, Elefanten,
diese lieben Anverwandten,
Schaf, Kamel und Känguru
und auch noch der Kai dazu.“
Manuel stand in dem dunklen Gang, der zur Schneiderstube führte. Hier waren die Wäschesäcke aufgestapelt und gaben diesem Teil des Hauses das Aussehen einer Höhle.
„Willst du dich wieder verstecken?“, fragte Kai.
„Ich verstecke mich nicht.“
„Und warum kriechst du zwischen die Säcke? Warum guckt nur noch dein Kopf hervor?“
„Ich suche was.“
„Du willst nicht zum Sprachunterricht. Das ist es. Du versteckst dich. Du kommst erst wieder hervor, wenn du das Auto von Herrn Lockstedt abfahren hörst.“
Kai ging fröhlich zum Gruppenraum hinüber, um sein Arbeitsblatt herumzuzeigen.
„Affen, Esel, Elefanten…“, sang er.
Nachdem Manuel über eine Stunde in seinem gemütlichen Versteck verbracht hatte, hörte er die dunkle Stimme des Sprachlehrers unten in der Küche. Herr Lockstedt aß an den Unterrichtstagen mit.
„Was gibt es denn heute?“, fragte er.
„Neugierde mit Soße und Topfguckerpudding“, antwortete die Köchin und stellte ihren kräftigen Rücken vor die Töpfe. So konnte der ungeduldige Gast keinen Blick hineinwerfen.
Der Lehrer trat langsam seinen Rückzug an. Er mochte die Frauen in der Küche. Er neckte sie so lange, bis sie ihn mit derben Worten aus ihrem Reich vertrieben.
„Haben Sie sich Ihr Essen schon verdient?“, fragte die Köchin und verfolgte ihn auf den Flur. „Um richtig sprechen zu lernen, braucht man dazu einen solchen dicken Mann? Sie sollten lieber unseren Garten umgraben.“
„Dass du immer den Lehrer beschimpfen musst, Elfriede“, nahm ihn Frau Bohndiek in Schutz. „Denke mal daran, wie gut der Kai jetzt spricht. Der könnte im Fernsehen die Nachrichten ansagen. Tegucigalpa und Kuala Lumpur, diese Namen machten dem nichts aus.“
„Schönen Dank, Frau Bohndiek“, sagte der Lehrer lächelnd, „wenigstens eine, die mir beisteht.“
„So geht es aber allen Gästen hier“, schloss die Frau. „Erst müssen sie sich was anhören. Beim Essen aber kriegen sie ein Stück Fleisch, so riesengroß, dass man das andere Ende nicht sieht.“
Herr Lockstedt ging langsam die Treppe hinauf. Die gackernde Lache der Köchin verfolgte ihn ein ganzes Stück.
Manuel sah, dass es der Lehrer nicht eilig hatte. Der Mann blieb am Fenster stehen und schaute auf den Hof. Dann besah er sich die Bilder an der Wand. Auf ihnen waren Begebenheiten verschiedener Märchen dargestellt.
Warum geht er denn nicht weiter, dachte Manuel.
Es gefiel ihm nicht, dass der Mann vor dem einen Bild etwas länger stehenblieb.
Es zeigte eine junge Frau mit einem schönen schillernden Tuch um den Hals.
Es störte den Jungen, dass der Lehrer das Bild so aufmerksam betrachtete. Es war, als würde dadurch etwas abgelöst.
„Na, Herr Lockstedt, alle durch?“, fragte Frau Herzog. Sie kam aus ihrem Büro.
„Bis auf Manuel“, sagte der Lehrer.
Die Leiterin ging mit schnellen Schritten auf die Tür des Gruppenraumes zu.
„Manuel, bitte zum Sprachunterricht!“, rief sie hinein.
„Wieso nicht da?“, fragte sie streng, nachdem drinnen jemand gesprochen hatte.
Nun lief Frau Herzog in alle Zimmer.
„Das gibt es doch gar nicht!“, rief sie von überallher. „Nicht da. Was soll denn das heißen?“
„Der hat sich wieder versteckt“, sagte Beatrix, die an die Tür gekommen war. „Der versteckt sich immer. Ob der Arzt kommt oder der Lehrer, meistens ist Manuel dann weg.“
„Er sollte heute gar nicht zum Unterricht“, sagte Herr Lockstedt, als Frau Herzog atemlos mit Manuel an der Hand erschien. „Er macht gute Fortschritte. Ich nehme ihn nicht mehr jedesmal dran.“
Er drehte sich um und lief schnell die Treppe zum Essenraum hinunter. „Ja, du bist das nächste Mal der erste. Auf jeden Fall!“, rief er Kai noch zu, der darum bangte, nicht mehr am Sprachunterricht teilnehmen zu dürfen.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.
Erstmals 1969 erschien im Verlag Das Neue Berlin der Abenteuerroman „Der gelbe Hai“ von Wolfgang Schreyer: Miami, November 1963. Nach dem Mord an Präsident Kennedy gerät ein kubanischer Funker aus dem Kreis der Verdächtigen in die Hand eines mächtigen Apparates und kann nicht mehr zurück. Tausend Meilen südostwärts von Florida sinkt er am Fallschirm auf ein fremdes Land herab und muss sich nun als Mensch und Kämpfer bewähren. Inmitten öder Berge, auf windgepeitschten Hochebenen, in zerklüfteten Tälern und Höhlen, vor einem einsamen Berghotel begegnet er aufrechten und listigen Männern, erfahrenen und romantischen Guerilleros, Revolutionären und einem schweigsamen Mädchen, das dem geliebten Mann gefolgt ist. Und immer umgibt ihn und seine Zufallsgefährten ein erbarmungsloser Feind – mit dem er täglich spricht. Seine Funksprüche beginnen: „Gelber Hai ruft …“
Dies ist – nach „Preludio 11“ und „Der grüne Papst“ – Schreyers dritter Roman aus dem karibischen Raum, der je weiter er in der Handlung voranschreitet immer spannender wird. Hören wir, was der Held zu erzählen hat:
„ERSTES KAPITEL
1
Abends kam Sprühregen auf, die beleuchteten Palmen vor dem Hotel „Commodore“ tropften im Wind. Irgendwo auf dem Weg durch die Stadt hatte sich ein Schatten an mich gehängt. Ich spürte ihn zum ersten Mal beim Überqueren der Patton Avenue, fünfzig Schritte vor meinem Stammlokal. Nicht, dass ich ihn gesehen hätte; die City war viel zu belebt. Wer immer es sein mochte, er schwamm im großen Strom hinter mir her. Als ich die Stufen zum „El Chico“ hinabstieg, glaubte ich es wieder zu fühlen… Aber warum? Ich tat ja nichts, hatte nichts in Aussicht – seit einem Dreivierteljahr lungerte ich in Miami herum. Sie hatten uns auf Eis gelegt, das war mein Kummer, darüber wollte ich nachher mit Lopez sprechen. Also warum?
Ich grübelte noch vor der Theke, wo man für neunzig Cents ein Sandwich mit Schinken und Käse, Muschelsuppe und Kaffee bekommt, meistens auch ein Doughnut. Die Warteschlangen sind entsprechend lang. Der Raum war wie immer laut und voll – ein Treffpunkt meiner Landsleute. Anscheinend redete alles von dem Mord an Kennedy. Aus dem Attentat von Dallas wurde allmählich ein amerikanischer Alptraum. Eben sagte der Fernsehsprecher, Johnson habe durch Verfügung Nr. 11 130 sieben prominente Bürger unter dem Vorsitz des Obersten Richters Warren beauftragt, Hergang und Hintergrund des Anschlags zu klären. Ich nickte Bekannten zu und beobachtete die Schwingtür. Doch es erschien kein fremdes Gesicht.
Eine Zeitlang hörte ich auf, mir Sorgen zu machen, blieb aber auf der Hut. Die allgemeine Nervosität hatte mich angesteckt. Eine Woche nach dem Attentat zog der Fall noch immer neue Kreise. Ich begann zu fürchten, sie könnten auch uns hier erreichen. Bis zum Sonntagvormittag waren die meisten bereit gewesen, in Lee Oswald einen Verrückten zu sehen, dem es durch Zufall gelungen war, seine Wahnidee in die Tat umzusetzen. Doch als man im Fernsehen den untersetzten Mann ins Bild stürzen und schießen sah, als Oswald unter Jack Rubys Kugel zusammenbrach, da regten sich Zweifel. Seitdem schien es mehr und mehr, als habe der Präsidentenmörder nicht allein gehandelt, als sei er bloß das einzig sichtbare Glied einer Kette von Verschwörern. Widerspruchsvolle Gerüchte kamen auf: Hinter Oswald stünden lateinamerikanische Anarchisten oder texanische Ölmillionäre, cubanische Revolutionäre oder Antikommunisten, Fidel Castro oder Lyndon B. Johnson. Unser spanischsprachiges Emigrantenblatt war instinktlos genug, die Wahrsagerin Jeane Dixon zu zitieren: „Castro glaubte, Kennedy und Chruschtschow wollten ihn stürzen…“
Ich sah von der Suppe auf und merkte, dass der Teint des Nachrichtensprechers sich gründlich färbte, sein Mund lief blau an wie der einer Wasserleiche. Das lag nicht an den Lügen, die er verbreitete, sondern an Mängeln des Farbfernsehens. Der Kellner korrigierte die Einstellung, er tat das immer im Vorübergehen, die Wasserleiche blühte rosig auf und sagte: „… vermutet, dass John F. Kennedys Tod in New Orleans geplant worden sei, und zwar von Antikommunisten, rechtsradikalen Amerikanern und Cubanern als Antwort auf die fehlgeschlagene Invasion in der Schweinebucht und die spätere Weigerung des US-Präsidenten, ähnliche Aktionen zu genehmigen.“
Dieser Satz hätte mich nicht stören müssen, doch soviel war klar: er zog die amtliche Aufmerksamkeit auf uns. Wir standen geradezu im Rampenlicht, nicht jeder konnte das vertragen. Würde das FBI nun die cubanische Kolonie überprüfen, besonders diejenigen, die irgendwann einmal Waffen besessen und an Aktionen teilgenommen hatten? Der Personenkreis war nicht so groß, wie es auf den ersten Blick scheinen mochte. Neunzigtausend Emigranten lebten in Florida, sechstausend davon hatten der Invasionsarmee angehört, aber nur ein paar hundert waren an den Unternehmungen dieses Jahres beteiligt. Uns Burschen von den Kommandos würden sie sich ansehen wollen.
Ich schob den Teller weg – plötzlich schwitzte ich; nicht von der Suppe. Auf dem Tablett lag ein Zettel, eben war er noch nicht da gewesen, wer hatte ihn unter den Teller geschoben? Ich las einen einzigen Satz und fühlte einen Schock.
Dringend an Tony: Erwarte Dich im Garten – Lopez
Die Mitteilung war ungewöhnlich nach Inhalt und Form. Ich wusste nicht einmal, ob es Lopez‘ Schrift war; er hatte mich niemals schriftlich benachrichtigt und auch nicht durch Vermittlung Dritter. Und weshalb wählte er für unseren Treff einen so auffälligen Ort? Er verkehrte kaum im „Garten“, ebenso wenig passte es zu mir. Er hatte mich heute bei sich erwartet, war sein Quartier nicht mehr sicher?
Ich merkte, dass ich den Maiskuchen zerkrümelte. Es war jetzt unerträglich heiß. Von dem Stimmengewirr ringsum dröhnte mir der Kopf. Wenn nun gar nicht die Yankees mich beschatteten, sondern die eigenen Leute? Das würde erklären, weshalb kein Fremder hinter mir hereingekommen war. Einer von Hectors oder Rafaels Vertrauten etwa? Ich sah mich um, ohne einen Mann des Alpha-Kommandos zu entdecken. Schließlich hatten die beiden mich nie gemocht, ihre letzte Aktion war fehlgeschlagen, vielleicht glaubten sie, ich hätte den Plan verraten. Und die Panne von Norman’s Key, wo die Briten das beste Boot von Alpha aufgebracht hatten… Aber wieso sollte man jetzt auf mich verfallen, nach reichlich einem halben Jahr?
Ich stand auf und schob mich zur Tür. Ich musste zu Lopez, sofort, doch auf Umwegen. Nicht zum ersten Mal war ich hier einen Schatten losgeworden.“
Erstmals 1979 veröffentlichte Egon Richter im damaligen VEB Hinstorff Verlag Rostock „Der Lügner und die Bombe. Vier untypische Liebesgeschichten für Männer“: Gemeinsam ist diesen vier sehr verschiedenen Geschichten, dass es um die Liebe geht – wie sie kommt und wie sie abhandenkommt. Spannend erzählt Egon Richter von den Konflikten im menschlichen Leben und davon, wie viel man investieren muss, damit die Liebe bleibt. Und wie viel Platz die Liebe im Leben braucht, damit sie nicht kaputtgeht zwischen Alltag und Anstrengungen für die Gesellschaft.
Ein unerhörtes Ereignis passiert, als jemand eine Baugrube für ein Einfamilienhaus ausheben will. Warum ist ein kleiner Junge dabei? Und warum denkt er, dass die Leute ausgerechnet diesem Jungen nicht glauben würden, wenn er Hilfe holen soll, weil jemand mit einem Bagger in einer Baugrube eine Bombe festhält, damit sie nicht explodiert. Und da ist noch die Sache mit Ostafrika.
Der Regisseur, der vorgibt, soviel von der Liebe zu verstehen, scheitert an die Liebe einer Frau, die ihn wirklich geliebt hat. Sie hat es ernst gemeint, viel ernster als er. Und während er denkt, es sei alles in Ordnung, schreibt sie eilig ein paar Zeilen auf den Kopfbogen der offiziellen Hotel-Post …
Immer wieder ist es das Werk, das wichtiger ist als alles andere. Wichtiger als das Zusammensein mit seiner Frau und mit seinen Kindern. Weiß er eigentlich noch etwas von ihnen? Noch vierzehn Tage, dann soll Schluss sein mit dieser ständigen Überforderung – gegen alle Signale seines Körpers. Da kommt die Havarie.
Dreizehn Flugstunden entfernt liegt das ferne Land, in dem er vieles nicht versteht und sich zugleich an manches in seiner Heimat erinnert fühlt. In dem fernen Land, das ihm sehr fremd vorkommt, trifft er auch eine schöne Unbekannte und wagt einiges, aber ob es Liebe ist?
„Der Lügner und die Bombe“, das sind – wie schon im Untertitel angekündigt – vier untypische Liebesgeschichten für Männer und ein Plädoyer für das richtige Maß zwischen Arbeit, Leben und Liebe und für Ehrlichkeit gegenüber dem anderen. Worin besteht er, der Sinn unseres Lebens? Hier der Anfang der titelgebenden Geschichte dieses Buches, in dem jemand eine damals übliche Anrede verweigert:
„Der Lügner und die Bombe
Wieso soll ich nicht Genosse sagen?
So was hab ich noch nicht erlebt. Das ist das erste Mal, dass einer sich dagegen verwahrt, wenn ich Genosse zu ihm sage. Ach, in Ihrer Funktion heißt das nicht Genosse. Und Angeschuldigte können nicht mit Ihnen auf einer Stufe stehen, das ist klar. Nein, bestimmt nicht, ich will Sie überhaupt nicht provozieren, kein Gedanke dran. Ich versteh das schon mit Ihrer Genossen-Regelung, ohne Flax. Bloß, das ist es eben: Was bin ich denn nun? Bin ich Angeschuldigter oder was? Oder wollen Sie sich einfach nur mit mir unterhalten? Was ich mir nicht vorstellen kann, ehrlich. Nein, ich war noch nie im Knast, wenn Sie das meinen. Bloß öffentliche Rüge und gerichtlichen Tadel und Schadenersatzsumme und so was, das hab ich hinter mir, aber im Knast? Nie! Eher hätt ich welche reingebracht, bloß aus unerfindlichen Gründen sind sie immer drumrum gekommen, nein, ich stoße keine Drohungen aus, ich weiß doch, wo ich hier bin. Also gut, sage ich Herr Staatsanwalt!
Nein, ich habe die Maschine nicht überprüft. Dafür bin ich gar nicht zuständig. Das ist Sache der Technikbrigade, die haben sich darum zu kümmern. Selbstverständlich wusste ich, dass das Ding defekt ist, ich meine, vor drei Wochen wusste ich das, und vor drei Wochen habe ich den Techniktruppen schon gesagt: Jungs, habe ich gesagt, bringt den Siebzehn-null-drei in Ordnung, da ist irgendwas mit dem Stabilisierungshebel, und ich dachte, die Sache wäre längst ausgestanden.
Also, wenn ich die Heinis in die Finger kriege… Ich stoße keine Drohungen aus, was Sie bloß von mir wollen! Außerdem habe ich noch nie im Leben leere Drohungen ausgestoßen. Damals dem Kerl im Ziegelwerk zum Beispiel hab ich nur ganz ruhig gesagt, dass er ein Müllkopf ist und hinter schwedische Gardinen gehört, und ich hab auch gesagt, er soll mich nicht anfassen, sonst dreh ich ihm die Ohren ab. Jawohl, das war der Fall mit meinem öffentlichen Tadel und dem Schmerzensgeld, Sie brauchen gar nicht erst in den Akten nachzugucken. Ich streite das ja nicht ab. Und ich steh auch dazu, ja, sicher, auch heute noch. Und ich sage Ihnen, ich würde das jeden Tag wieder machen und wenn Sie mich zwanzig Jahre dafür einlochen, aber so was hab ich noch nie leiden können. Erpresser hab ich noch nie leiden können. Natürlich war das Erpressung! Ganz klar! Also, Mann! Entschuldigung. Also, Herr Staatsanwalt: Ich komme morgens in die Ziegelei mit dem Hadreia, war überhaupt nur eingesprungen für Rolli, ich meine für Roland Schwarz, weil der wieder irgendeine Parteischote hatte – ist klar, Herr Staatsanwalt, war nicht so gemeint, schließlich bin ich ja selber Genosse, nicht wahr. Jedenfalls hatte Rolli, ich meine Herr Schwarz, wieder irgendeine Sekretariatssitzung oder so was, und unser Brigadier kommt in der Frühschicht angehechtet und fuchtelt mit den Armen und kaspert da rum, was nun werden soll, ohne Ziegel, und die Reichsbahn hat wieder mal keine ausreichenden Transportmittel, und wir müssen uns die Dinger selber aus dem Ziegelwerk holen, aber Rolli sitzt natürlich wieder auf irgendeiner Konferenz, und er wird noch verrückt hierbei und so weiter und so weiter. Ich sage Karl, sage ich, wo ist der Schein, ich fahre rüber und hole die Dinger. Wenn wir hier doch bloß rumsitzen und darauf warten, wie uns die Prämie durch die Lappen geht, dann kann ich auch rüber und die Steine holen, ob hier nun einer mehr rumgammelt oder nicht. Du, sagt der, du und Hadreia, der heilige Vater soll mir beistehen, zehn Hühner sind das mindeste, was du totfährst, und der Alte kriegt nachher die Anzeigen auf den Tisch. Junge, sage ich, mach dir nicht ins Hemd, ich hab bei der Fahne schon Brückenträger gefahren, da werde ich doch die Klapperkiste von Hadreia noch über die Straße kriegen… Keineswegs, Herr Staatsanwalt, ich schweife keineswegs ab.
Man muss nämlich wissen, dass ich zum ersten Mal in die Ziegelei gefahren bin, das ist wichtig, denn nur deshalb dachten die, sie könnten solchen Terror mit mir machen, ganz klar. Doch, doch, das gehört alles dazu.
Also, wenn Sie keine Zeit haben, dann müssen Sie das sagen. Hätten mich ja gar nicht vorzuladen brauchen. Noch bis zu dieser Minute weiß ich nicht, was das soll, ehrlich. Natürlich werden Sie das wissen, ist ja logisch. Aber ich wüsst es eben auch ganz gerne. Wegen der Maschine? Ach, bloß wegen der Maschine! Und da sitz ich hier rum und quatsche und denke, Sie interessieren sich für wer weiß was. Also, wegen der Maschine, hab ich schon gesagt, da wenden Sie sich am besten an die Technikbrigade, die sollte den Siebzehn-null-drei schon längst in Ordnung bringen. Warum ich… ? Ja, Mensch! Entschuldigung! Warum denn ich? Ich bin ja wirklich ein Mensch voller Gutmütigkeit, aber schließlich kann ich nicht anderen die Arbeit machen. Jajajaja, hab ich auch schon gesagt, dass ich gewusst habe, wie defekt das Ding ist, aber das war drei Wochen vorher, hab ich auch schon alles erklärt – fragen Sie doch nicht dauernd dasselbe! Und wer konnte schließlich ahnen, dass da ’ne Bombe liegt, ehrlich, auf so was wären Sie doch auch nicht gekommen. Ich hab das gemacht, weil Rolli, ich meine Roland Schwarz, weil der endlich zu seinem Eigenheim kommen musste. Ja, musste. Familiär. Gab Schwierigkeiten. Weiß ich nicht. Bei Leuten, die dauernd nicht da sind, gibt es immer Schwierigkeiten. Ganz logisch.
Rolli, ich meine Herr Schwarz, war mein Freund, deshalb. Also, Freund ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich weiß keinen besseren. Irgendwann hat er mir mal imponiert. Ja, das ist schon undenkliche Zeiten her, mein Gott, da war noch was los! Was? Ach gar nichts, ist nur so eine Redensart, Herr Staatsanwalt, hat nichts zu sagen. Nein, er hat mir einfach imponiert, der Mensch, ohne Flax. Klar hatte ich den schon gesehen bei uns, tauchte als Superlehrling auf, Berufsausbildung mit Abitur, du hast ja ein Ziel vor den Augen und so, also: Zuerst gefiel der mir gar nicht. Natürlich kann ich das sagen, denken Sie, ich red da drum rum? Es gibt Leute, die denken, sie haben den Sozialismus ganz persönlich erfunden und Old Charlie, Entschuldigung, also Karl Marx hat sie von Wolke soundso aus höchstselbst beauftragt, ihn allen anderen dauernd klarzumachen, denn die andern sind ja bescheuert und haben keine Ahnung, oder sie sind die listig verkleideten Klassenfeinde, die laufend entlarvt werden müssen.
Keineswegs, Herr Staatsanwalt, ich will keineswegs etwas gegen Ihre Aufgaben sagen. Ich will bloß erklären, wie das mit Rolli war, ich meine mit Roland Schwarz und mir, weil Rolli, ehrlich, das war nämlich so einer. Und gläubig, ist ja klar. Ach, doch nicht christlich, um Gottes willen! Gläubig! An alles, was von oben kam oder in der Zeitung stand, glaubte der unbesehen, Wenn der schon gewirkt hätte zur Zeit der Rinderoffenställe, der hätte sie mit Begeisterung aufgebaut und mit der gleichen Begeisterung wieder abgerissen, ohne Flax. So einer war das. Dem konnte man alles zumuten, mit dem ließ sich was machen. Alles für das Vaterland! So einer war das.
Aber ich hab ihn gemocht! Der hatte was, das haute einen glatt um. Ich weiß nicht, ist verdammt schwer zu erklären. Damals waren wir dabei, die Fundamente für die große Sporthalle zu schütten, na, die Schalung war wohl fünfundsiebzig breit, würde ich sagen, und halb voll Beton war sie schon, und wir waren so richtig kräftig am Zug und hatten schon fünf Stunden Planvorsprung, und hinter der Hausecke lachte schon die Schichtprämie, und Rolli immer vornedran. So was hatte er drauf, das war das Gute an ihm, das gehörte eben zu seinem Sozialismus.
Jedenfalls kommt doch solche Truppe von Anlernlingen vorbei, echte Stifte, zwei Packungen SALEM pro Tag, Viererabschluss aus der siebenten Klasse und einen Jargon wie Knastologen, stellen sich an die Schalung und quatschen dämlich, und einer von denen verliert doch dabei einen Karton mit Dusch-Armaturen, wissen Sie, für Dusche und Waschbecken und Bad, Mischbatterien, denn damals mussten wir die Bäder noch einbauen, Stück für Stück. Der Karton fällt in die Schüttung, die Stifte gucken wie die Blöden, und dazu brauchten die sich nicht anzustrengen, ehrlich, und unser Brigadier kriegt einen Blick wie ein säugendes Kalb, Tatsache. Also, die Stifte hauen ab, viel schneller als sie gekommen sind. Und wir stehen da mit dem Salat. Fünf Armaturen für die Körperpflege, und hinter der Ecke steht unsre Schichtprämie und hält die Luft an.
Los, sagt der Brigadier, weiter! Und der Kran mit der nächsten Schüttung schwenkt auf die Schalung ein, da ruft doch dieser Roland Schwarz: Halt mal, halt, das könnt ihr doch nicht machen, und wir denken, uns laust der Affe. Ich sage: Spinnst du, sage ich zu Rolli, wollen wir vielleicht die Sporthalle sausen lassen wegen solcher blöden Mischbatterien? Aber der hört gar nicht, der rennt zum Meister und gestikuliert da rum, und wir sehen, wie der Meister den Kran mit der Schüttung stoppt und sich am Kopf kratzt und uns ranwinkt, und wie wir hingehen und sind schon mächtig sauer wegen der unterbrochenen Arbeit und der Schichtprämie, die sich mit jeder Minute weiter entfernt, da sagt doch der Meister: Hört mal, sagt der, der Roland Schwarz will absteigen in die Schalung und die Mischbatterien da wieder rausholen, ich meine, den Karton. Der Brigadier dreht sich um zu Rolli und guckt den an wie ein Marswesen, und dann guckt er den Meister an und sagt: Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Und Rolli sagt ganz ruhig: Man kann die doch nicht einfach mit einschütten. Joseph, schreit unser Brigadier, Joseph, gib ein Zeichen! Und wir stehen rum und wissen, dieser dämliche Schwarz mit seinem Fimmel, der bringt uns um die Prämie, und ich bin sicher, die meisten hatten eine Wut auf den, die hätten ihn am liebsten den Mischbatterien hinterher geschmissen. So war das, garantiert.“
Erstmals 1964 veröffentlichte Heiner Rank als Heft 94 der beliebten Erzählerreihe im Deutschen Militärverlag Berlin seinen Zoll-Krimi „Schüsse im Hafen“: Zollassistent Bertholdi entdeckt in einer dunklen Nebelnacht im Hafengelände einen Mann, der vor ihm in Richtung des norwegischen Schiff „Ingo“ flieht. Zwei Männer lassen von der Reling dieses Schiffes einen Karton zu einem Boot herab. Als Bertholdi die beiden Männer von der „Ingo“ stellen will, wird er überwältigt. Er kann nur noch die Männer auf dem davoneilenden Boot zum Halten aufrufen und – nachdem sie fliehen – hinterherschießen. Die am nächsten Tag durchgeführte Zollkontrolle auf der „Ingo“ bringt zwar etwas Schmuggelgut zutage, aber keinen Hinweis auf die nächtliche Aktion. Eine akribische Ermittlungsarbeit des DDR-Zolls beginnt.
Dieser Zoll-Krimi von 1964 bietet auch dem heutigen Leser noch genügend Spannung und dazu einen kleinen Einblick in die Lebens- und Arbeitswelt in der DDR nach dem Mauerbau. Begleiten wir aber zunächst Bertholdi auf seinem nebelnächtlichem Dienst-Spaziergang durch den Rostocker Hafen:
„1. Kapitel
Zollassistent Bertholdi macht den gewohnten Hafenrundgang. Sein Weg führt ihn die Strandstraße entlang auf das Warnowufer zu. Links ragen die windschiefen, schmalbrüstigen Fachwerkhäuser der Rostocker Altstadt auf, rechts liegt das umzäunte Hafengelände mit Speichern, Kränen und den am Kai vertäuten Frachtern.
Bertholdi läuft auf dem schmalen, grasbewachsenen Sandstreifen zwischen Zaun und Gehweg. Oft bleibt er stehen und schaut sich prüfend nach allen Seiten um, doch die Sicht beträgt nur wenige Meter. Dichter schmutziggrauer Nebel liegt über der Warnowniederung. Es ist fast windstill. Die Geräusche klingen wie in Watte verpackt, ihre Entfernung ist nicht abzuschätzen, sie scheinen alle aus nächster Nähe zu kommen. Das heisere Stöhnen einer Schiffssirene draußen auf dem Fluss, der schrille, kurzatmige Pfiff der Rangierlok, das Klirren einer Krankette — alles ist greifbar nahe, dumpf, ohne Widerhall.
Der Zollassistent verhält im Schutz einer Schuppenwand. Am Mast über dem geteerten Dach steht verschwommen der gelbliche Schein einer Lampe. Von dem Ahornbaum auf der anderen Straßenseite löst sich Blatt um Blatt. Um den schwarzen, regennassen Stamm hat sich ein Hof aus dunkelbraunem Laub gebildet, das einen kräftigen herben Geruch ausströmt.
Gar nichts los heute Nacht, denkt Bertholdi, dabei ist das Wetter wie geschaffen für krumme Geschäfte. Ich muss meine Waffe einfetten, wenn ich in die Dienststelle zurückkomme. Die Nässe dringt in alle Ritzen und greift sogar Stahl an. — Da alles ruhig bleibt, will Bertholdi seinen Weg fortsetzen. Er löst sich von der Schuppenwand. Still! War da nicht ein Geräusch? Rasch tritt er zurück. Aus einem engen Altstadtgässchen nähern sich Schritte, frech und unbekümmert. Doch plötzlich bricht das Tappen ab. Eine Minute verstreicht. Bertholdi rührt sich nicht. Sollte er sich getäuscht haben? War es jemand, der in diesen Häusern da drüben wohnt? — Nein, da ist er! Eine gebückte Gestalt, Schiffermütze auf dem Kopf, huscht über die Straße auf den Hafenzaun zu. Mit einem Satz hängt der Mann am Zaun, schwingt sich hinauf.
Bertholdi springt vor. „Halt! Zollkontrolle!“
Der Mann denkt nicht daran, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Ehe Bertholdi zugreifen kann, zieht er sein Bein über den Zaun und rennt davon. Bertholdi verliert keine Zeit. Mit einer Flanke setzt auch er über den Hafenzaun. Der andere springt vor ihm über die Gleisanlagen, schlüpft unter einem Portalkran hindurch und verschwindet zwischen gestapelten Öltonnen. Der dichte Nebel erschwert die Verfolgung, und als Bertholdi die Tonnen erreicht, ist der Mann spurlos verschwunden. Doch da ertönt nahe dem Kai, hinter persenningüberdeckten Kisten mit Werkzeugmaschinen, blechernes Scheppern. Der Zollassistent läuft in diese Richtung. „Nicht so hastig, Freundchen“, brummt er, „und immer schön die Augen auf.“
Durch den Nebel dringen die Bordlichter eines Küstenfrachters. Es ist die „Ingo“, ein kleiner norwegischer Dreitausendtonner. Bertholdi kennt das Schiff, es läuft regelmäßig die Route Oslo—Rostock, bringt norwegische Fischkonserven und holt deutsche Werkzeugmaschinen und elektrische Ausrüstungen. Der Mann läuft direkt auf den Frachter zu. Vielleicht glaubt er, er hätte den Verfolger bereits abgeschüttelt. Er eilt die beleuchtete Schiffstreppe hinauf und taucht zwischen den dunklen Aufbauten unter. Es ist ein kleiner, etwas gebeugter Mann, schon nicht mehr jung, wie Bertholdi in diesem kurzen Augenblick feststellen kann. Er folgt ihm, schleicht so leise wie möglich an den Ladeluken vorbei nach Steuerbord, wo es dunkel ist. Irgendwo fällt eine eiserne Tür ins Schloss. Dann ist es wieder still. Nur unten an der Bordwand plätschern die Warnowwellen.
Soll er versuchen, den Kerl auf eigene Faust zu finden, oder gleich zum Kapitän gehen, um den Vorfall zu melden und eine Kontrolle der Mannschaft zu verlangen? Ehe sich Bertholdi entscheiden kann, öffnet sich in seiner Nähe eine Tür. Zwei Männer betreten leise das Deck. Unter ihren dunklen Gummimänteln heben sich hell die Hosenbeine der Schlafanzüge ab. Einer der beiden trägt einen großen Karton unter dem Arm, der zweite schleppt ein zusammengerolltes Seil. Vorsichtig sehen sie sich um. Bertholdi hält den Atem an. Doch er bleibt unbemerkt: Die beiden Männer treten an die Reling. Sie befestigen das Seil am Karton, der eine schaut auf seine Armbanduhr und nickt seinem Freund zu. Vom Wasser dringt ein leises Geräusch von Riemenschlägen herauf. Dollen quietschen gedämpft, Holz schlägt an Holz — ein Riemen wird eingezogen, dann eine kleines Schurren an der Bordwand: Ein Riemenboot ist am Schiff. Weit über die Reling gebeugt, lassen die beiden Männer den Karton hinunter.
„Jetzt!“, sagt Bertholdi zu sich. Mit zwei schnellen Schritten steht er hinter den Männern und packt einen von ihnen fest am Arm. „Zollkontrolle! Folgen Sie mir zum Kapitän!“
Ein erschreckter Aufschrei. Ein dumpfes Poltern. Die Insassen des Bootes fluchen, einer ruft empört: „Was ist denn los da oben? Seid ihr verrückt geworden?“ Da wird Bertholdi von hinten umklammert. Zwei bärenstarke Arme pressen sich um seinen Oberkörper. Ein dritter Mann, von Bertholdi unbemerkt, ist seinen Kumpanen zu Hilfe gekommen. Der Zollassistent wird gegen die Reling geschleudert und stürzt auf das Deck. Noch im Fallen greift er zur Pistolentasche; doch als er sich aufgerichtet hat, ist er allein. Bertholdi schaut über die Reling. Undeutlich erkennt er ein Boot, zwei Männer hantieren an den Riemen. Zwischen ihnen liegen Ballen oder Säcke auf den Bodenbrettern. Gerade stoßen sie das Boot ab und wollen sich davonmachen. „Ziehen Sie die Riemen ein! Bleiben Sie am, Schiff! Zollkontrolle!“, ruft Bertholdi hinunter.
„Ja, ja“, tönt es geruhsam zurück. „Nur keine Aufregung. Wir kommen schon.“ Doch entgegen dieser Beteuerung entfernt sich das Boot immer weiter von der Schiffswand.
„Kommen Sie sofort zurück, oder ich schieße! Bertholdi umklammert die Waffe. Noch nie hat er mit scharfer Munition auf einen Menschen schießen müssen. Es ist kein angenehmer Gedanke, dass dieser Notfall jetzt eintreten könnte.
„Die Strömung treibt uns ab, wir kommen schon zurück“, ruft einer aus dem Boot. Doch Bertholdi sieht: Sie helfen mit den Riemen nach, um immer mehr Abstand zu gewinnen.
„Letzte Warnung! Kommen Sie heran!“
Die beiden im Boot glauben, sie seien nun weit genug fort, um die Maske fallen lassen zu können. Mit aller Kraft werfen sie sich plötzlich in die Riemen. Das Boot macht eine Wendung und schießt auf den Fluss hinaus.
Bertholdi reißt die Pistole hoch und feuert zweimal. Sekunden später, noch ehe er feststellen kann, ob er getroffen hat, ist das Boot vom Nebel verschluckt. Erbittert starrt er in die Finsternis. Kein Laut mehr. Nur das monotone Klatschen der Wellen. Er schiebt die Waffe in die Ledertasche zurück, hebt die Hülsen auf und macht sich auf die Suche nach dem Kapitän.“
Erstmals 1977 erschien im Leipziger Prisma-Verlag Zenner und Gürchott „Das Haus an der Voldersgracht. Ein Vermeer-Roman“ von Ingrid Möller. Sehr schnell sind Leserinnen und Leser mittendrin im Leben des holländischen Malers, seiner Frau, seiner Freunde und Kollegen. Wir erfahren, warum Vermeer so viel Zeit für seine Bilder brauchte, wie er seine Motive fand und wie sein Anspruch an die eigene künstlerische Arbeit war. Und wir können miterleben, dass das Zusammenleben mit Vermeer nicht immer einfach gewesen sein dürfte. Denn „Das Haus an der Voldersgracht“ ist nicht nur ein Roman über den Maler, sondern mindestens zur Hälfte auch ein Roman über seine Frau. Und danach sieht man viele Bilder des Jan Vermeer sehr wahrscheinlich mit anderen, wissenderen Augen. Am Anfang des lesenswerten Buches wird ein sehr schönes Fest gefeiert, ein Hochzeitsfest:
„1. Kapitel
Hell und wärmend fällt das Sonnenlicht des Frühjahrstages durch die hohen Fenster, deren Scheiben in kleine bleigefasste Quadrate geteilt sind. Es fällt in einen Raum, in dem alles blitzsauber ist — vom schachbrettartigen Fliesenfußboden bis unter die braune Balkendecke. Es lässt den Wein in den bauchigen Gläsern funkeln, die kostbaren Seidenroben schillern und die Augen der Gäste strahlen. Es gibt den Farben Leuchtkraft. Grellrot prangt der Hummer auf dem blank geriebenen Silberteller, orange und gelb heben sich die Apfelsinen- und Zitronenstücke von den blauweißen Fayenceschüsseln ab, und — kunstvoll zusammengebastelt — schmückt das Federkleid eines Truthahns die Mitte der Tafel. Die Augen sollen mitessen, und das mit doppeltem Recht, wenn sie Malern gehören.
„Haben wir ein Glück mit dem Wetter“, sagt der Hausherr Reynier Vermeer vergnügt, „besser könnte man es sich gar nicht wünschen.“
„Ein gutes Omen für einen so bedeutungsvollen Tag“, nickt der greise Ohm Pieters. Doch seine Frau, die rundliche Geertje, sagt:
„Ach was, an unserm Hochzeitstag hat es in Strömen gegossen, und sind wir etwa nicht glücklich geworden?“ Herausfordernd hochgereckt, das Doppelkinn an den gestärkten Mühlradkragen gepresst, wartet sie auf die öffentliche Bestätigung durch ihren Mann. Dem macht es Spaß, die Antwort hinauszuzögern. In seinem hageren Gesicht verlagern sich die Falten zu einer gewichtigen Miene, hinter der der Schalk lauert.
„Und wie!“, bestätigt er dann mit einem Ernst, der die Gesellschaft zum Lachen bringt.
Schon dringt der Duft gebratenen Geflügels verführerisch aus der Küche herüber, sodass den Gästen das Wasser im Mund zusammenläuft. Ob auch Tauben dabei sind? Gleich wird man auftragen. Jetzt ist der richtige Augenblick, denkt Leonard Bramer und gibt sich einen Ruck. Jetzt!
Umständlich räuspert er sich, zupft an den Enden seines nach neuester Mode flach aufliegenden Spitzenkragens und streicht wohlgefällig über die Wölbung seines Bauches, um zu fühlen, ob die Schärpe auch richtig glatt ist, die Schärpe, auf die er so stolz ist und die allen unmissverständlich kundtut, dass er Mitglied einer der vier Delfter Schützengilden ist. Bramer steht auf, reckt sich und gewinnt so das Aussehen eines Achtung gebietenden Mannes, der sich seines Wertes voll bewusst ist. Augenblicklich verebben die Gespräche, alle Blicke wenden sich ihm zu.
Doch ausgerechnet jetzt beginnen die Turmuhren Delfts zu schlagen. Mit Sekundenvorsprung die Uhr der hohen Nieuwe Kerk, dann die des gegenüberliegenden Stadthuis, die der Oude Kerk, des Schiedamer Tors. Unwillkürlich horchen alle auf den vielstimmigen Klang, auf das unterschiedliche Tönen, wie die Schallwellen anschwellen, sich mit anderen mischen und abklingen, feierlich tief die einen, hoch und dünn die anderen.
Leonard Bramer wartet, bis der letzte Ton des nachhinkenden Bimmelglöckchens verschwebt ist. Die Verzögerung kann die erstrebte Spannung nur steigern. Er ist ein Meister der Regie.
„Liebes Brautpaar, liebe Hochzeitsgäste“, beginnt er seine wohlabgewogene Ansprache, „wir sind heute zusammengekommen, um teilzuhaben an der Freude eines jungen Paares. — Vielleicht sagt ihr, dass ich als alter Junggeselle diese Freude gar nicht zu beurteilen wisse. Vielleicht glaubt ihr auch dem Sprichwort, das da sagt ,Vier en liefde treken sterck / en beletten menich werk‘ (Wo die Liebe schleichet ein, alle Künst vertrieben sein). Nein, Freunde, wo bliebe die Kunst, wenn es die Liebe nicht gäbe! Und wie schnell wäre eine Liebe vergessen, wenn ihr nicht durch die Kunst ein Denkmal gesetzt würde!
Seht auf Catarina, unsere entzückende Braut! Auf wie viel Bildern, die unser Jan im Laufe seines Lebens malen wird, werden wir sie wiedererkennen? Denn dies, meine Freunde, ist ein Vermögen, das uns Künstler über andere Berufe erhebt: Wir können dem Augenblick Dauer, dem Flüchtigen Beständigkeit und dem Verborgenen Sichtbarkeit verleihen. Wenn du — Catarina — einst alt geworden bist, wird deine jugendliche Schönheit weiter bestehen auf der Leinwand.
Du, Jan, wirst als Maler eine große Zukunft haben, wenn du die Möglichkeiten nutzt, die in dir liegen. Mögest du deine Gaben nie vergeuden und der Gefahr des bequemen Erfolges entgehen!
Doch nicht den Ruhm der Kunst will ich singen, sondern den Ruhm dieser Stunde: Lasst mich, liebe Freunde, dieses Glas erheben, um Fortuna zu danken, die uns so frohe und glückliche Stunden zu spenden bereit ist. Möge die launische Göttin des Glücks dem jungen Paare stets gewogen bleiben! Denn lang ist ein Menschenleben — und es ist doppelt lang, wenn ein Schatten darauf liegt.“
Der Duft des Gebratenen wird immer verlockender. Der einzige, der nicht heimlich Witterung aufnimmt, ist der Redner selbst. Mit anscheinend ungeteiltem Interesse verfolgt er, wie der Wein nachgeschenkt wird, ergreift sein Glas abermals und fährt fort:
„Dies zweite Glas lasst uns erheben auf Amor, den Unberechenbaren, der seine Pfeile abschoss auf diese beiden jungen Leute und sie vereinte durch jenes Band, das niemand sieht und das doch fester bindet als jede sichtbare Kette. Trinken wir auf den Götterknaben, dessen Pfeile verletzen, denen aber doch niemand ernstlich ausweicht!“
Bei diesen Worten hält Bramer das Glas einem Gemälde entgegen, auf dem ein nackter blond gelockter Knabe ernsthaft Köcher und Bogen vorweist. Diese Pointe war gar nicht eingeplant. Gut, dass sie mir eingefallen ist, denkt Bramer selbstzufrieden. An den Wänden hängen so viele Bilder neben- und übereinander, dass es schon ein glücklicher Zufall war, gerade dieses im rechten Augenblick zu entdecken.“
Es war also ein schönes Fest und da haben sich zwei ein Versprechen gegeben – damals noch auf Lebenszeit, bis dass der Tod sie scheidet – und es ist spannend zu lesen, wie sich die ganze Sache, also die mit der Liebe und so entwickelt und im Alltag bewährt oder eben auch nicht. Auch deshalb ist dieser Künstlerroman von Ingrid Möller so lesenswert. Weil wir Leserinnen und Leser einen Blick hinter die Fassaden eines Hauses an der Voldersgracht in Delft tun können und uns in das Goldene Zeitalter der Niederlande hineinversetzen lassen und mehr oder weniger erstaunt feststellen können: Damals war es offenbar auch nicht viel anders als heute. Viele Themen berühren uns ebenso wie Vermeer und seine Frau: Partnerschaft und Kindererziehung, Arbeit und ordentlicher Lohn und selbst das Thema Krieg und seine Schrecken kommt vor.
Viel Vergnügen beim Lesen, weiter einen schönen April und bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.
Und da wir gerade bei Jan Vermeer waren, soll hier noch an einen schönen Film und an dessen literarische Vorlage erinnert werden: Die Rede ist von „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ des britischen Regisseurs Peter Webber aus dem Jahr 2003 nach dem gleichnamigen Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Tracy Chevalier von 1999. Um eben diese Perlen geht es natürlich auch in dem Vermeer-Roman von Ingrid Möller …
EDITION digital war vor 27 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.100 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()