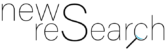Einen dramatischen Lebensbericht hat Ernst Klatt mit „Der Durst der Seele. Mein Weg vom Pimpf zum NVA-Offizier, CIA-Agenten und Alkoholiker“ vorgelegt.
Als zeitgeschichtlicher Archäologe ist Matthias Biskupek in „Wir Beuteldeutschen oder Wie ich zum Widerstandskämpfer wurde. Satiren, Glossen & Feuilletons“ unterwegs.
Um ein Abenteuer auf Leben und Tod geht es in „Insel der Piraten. Ein Ferienkrimi“ von Dietmar Beetz.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Schauen wir heute ein paar Jahrzehnte zurück und erinnern uns an einen gesellschaftlichen Aufbruch in Afrika, den auch die DDR nach ihren Kräften unterstützt hat – nicht zuletzt durch den Einsatz vieler Jugendlicher, die darin damals zum einen ganz persönlichen Beitrag für Solidarität sahen, zum anderen aber sicher auch ein Stück Abenteuer und Ausbruch aus ihrem ummauerten Staat. Vor allem aber wurde damals ein Wort ganz großgeschrieben – Solidarität, die Zärtlichkeit der Völker …
Erstmals 1980 erschien im Verlag Neues Leben Berlin „Ondjango. Ein angolanisches Tagebuch“ von Jürgen Leskien: Ondjango. Was bedeutet eigentlich dieser Titel?
Ende der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren wieder Deutsche nach Angola gekommen, diesmal mit blauen Hemden und mit Werkzeugkästen in den Händen. Vom ersten Tag an waren sie den Angolanern companheiros. Mit der Ablösung dieser Männer kam auch Jürgen Leskien für ein Dreivierteljahr nach Angola, um dort zu leben, zu helfen und – Tagebuch zu führen. Seine Aufzeichnungen nehmen den Leser mit in die Zeit kurz nach dem Erringen der Unabhängigkeit des Landes 1975, erlauben Einblicke in die Geschichte des Landes und in das damals gegenwärtige Leben in der Hauptstadt Luanda. Wir nehmen teil an der Fahrt durch den Regenwald, treffen ein am Stützpunkt der FDJ-Brigade in der Stadt Uige, wo sie W 50-LKWs aus der DDR reparieren und jungen Leuten aus Angola zeigen, wie das geht. Jürgen Leskien ist angekommen in Afrika. Er wird noch viel hören und sehen und noch viel aufschreiben von diesem Afrika, von diesem Angola, damals Ende der siebziger Jahre. Geschrieben hat er damals übrigens mit der Schreibmaschine …
Ondjango. Dieses Wort bezeichnet eine etwas größere runde Hütte mit kegeligem Grasdach, die gewöhnlich in der Mitte des Dorfes steht und der nach Sonnenuntergang ein Feuer brennt. Dann wird in dem Ondjango über alles geredet, was wichtig ist. Der Ondjango ist der Treffpunkt der Leute im Dorf: „Sie sitzen und reden miteinander. Der Alte auf der Matte, in der Nähe seine Kinder und Kindeskinder. Erzählen, zuhören, einander in die Gesichter schauen und darin lesen. Die Bedeutung der Pausen zwischen den Worten erspüren, der Melodie der Sprache lauschen wie einem Lied. Sich hineinsenken in die Gedankenwelt des anderen. Zueinander sprechen, einander zuhören – die ursprünglichste, wichtigste Form des Umgangs der Menschen miteinander. Für uns müssen wir sie erst wieder entdecken.“
Das angolanische Tagebuch von Jürgen Leskien ist wie ein solcher Ondjango. Und so beginnt es:
„27. September
Ein Berg kommt nicht zum anderen, aber die Menschen treffen sich
Sprichwort aus dem Umbundo
Nun ist es so weit.
Erst habe ich es geträumt. Dann habe ich es mir schreibend, als Vision, ins Zimmer geholt, anderen, als Traumbild, davon erzählt. Dann habe ich es gewollt, ganz heftig habe ich es gewollt und fand Freunde, die mich in dieser Sehnsucht sehr gut verstanden.
Was ich hatte tun können, hatte ich dafür getan.
Nun ist es so weit.
Eine Insel des Lichts und der Farbe, dieses Flughafengebäude inmitten der Spätsommernacht.
Ich trete durch das Portal. Piktogramme fordern auf, sich auf den sachlichen Vorgang der Abfertigung zu konzentrieren. Der Einzelmensch wird auf den Begriff PASSAGIER reduziert. Es geht darum, die richtigen Leute in die richtigen Flugzeuge zu sortieren.
An einem Schalter reiche ich den Angestellten meine Papiere. Sie sehen nicht mich, sie sehen mein Passbild, und sie sehen mein Gesicht. Sie vergleichen und sind zufrieden. Weiter in der Reihe. Jetzt werde ich für die Statistik interessant und für den zweiten Flugzeugführer unserer Maschine, der mein Lebendgewicht zur Kenntnis nehmen muss, um es in der Summe des Startgewichts dem Kommandanten zu melden, es dem Navigator mitzuteilen, damit dieser aus der Tabelle die rechte Abhebegeschwindigkeit unseres Aeroplans herausliest.
So unbedeutend ist der Einzelne also doch nicht, und es wäre vermessen, sich zu wünschen, dass die Hostessen gerade heute Engelsflügel tragen, frauliche Sanftheit zeigen, sich für mich ein besonderes Lächeln zurechtgelegt haben. Für mich, speziell für mich, der ich das erste Mal nach Afrika fliege.
Man fliegt hier andauernd irgendwohin. Das ist der Sinn der Einrichtung. Emotionale Beteiligung dieser jungen Frauen an meinem Unternehmen zu erwarten, jetzt nachts kurz vor eins, in einer Zeit also, in der man gewöhnlich noch oder wieder in den Armen eines Mannes liegt, in der man endlich seinen Dormutil-Schlaf gefunden hat, in der man, traum- und problemlos, in den neuen Tag hineingleitet – das ist wohl recht verstiegen.
Und doch gab es bei einer ein Blitzen im Auge, einen verzögerten Lidschlag. Die Schlanke war es, die mit den Bordkarten in der Hand.
Im Blechgehäuse ein Gedränge wie in der Siebzehnuhrstraßenbahn. Die alten Füchse sitzen schon auf den richtigen Plätzen. Nicht vor dem Lärm der Triebwerke, hüte dich vor einem Platz über den Tragflächen, dann kannst du auch gleich mit der U-Bahn fahren …
Dann klemme ich in meiner Sitzmulde, vor den Tragflächen sogar.
Zwei Uhr fünfzehn – Start. Zuvor das Übliche. Begrüßung, Ermahnung, die Gurte. Dankeschön.
Vier Triebwerke schieben das Silberschiff durch die Nacht. In ihm aufgereiht fast zweihundert Leute, die nach Algier wollen, nach Lagos oder Luanda. Zum anderen Kontinent, der zwischen dem Atlantischen und dem Indischen Ozean schwimmt.
Wieder die Frage, wie wird es sein, dieses Afrika, dieses Angola? Heiß sicherlich und groß, voller schwarzer, fremder Gesichter, mit Palmen, so zahlreich wie bei uns die Kiefern, und mit merkwürdigen Sitten und Gebräuchen.
Angola, Land in revolutionärer Bewegung, unabhängig, mit den frischen Narben des Befreiungskampfes.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.
Noch unter dem Titel „Mich schießt keiner tot“ veröffentlichte Karl Sewart erstmals 1994 im Chemnitzer Verlag „Karl Stülpner. Die Geschichte des erzgebirgischen Wildschützen“. Dem E-Book liegt die 3. erweiterte Auflage von 2004 zugrunde: Kaum eine andere historische Gestalt ist im Bewusstsein der Menschen des Erzgebirges so lebendig geblieben wie der Wildschütz Karl Stülpner. Seine Lebensspuren führen durch halb Europa, aber mit vielen abenteuerlichen Taten in seiner Heimatlandschaft hat er die Zuneigung seiner Zeitgenossen und nachwachsender Generationen gewonnen. Karl Sewart erzählt in seinem Buch die Biografie, und er weitet zugleich Tatsachen und Legenden dieses Lebens. Ein Volksbuch für alle Freunde erzgebirgischer Geschichte.
Das spannende, sehr gut recherchierte Buch hat seit seinem ersten Erscheinen 1994 viele interessierte Leser in ganz Deutschland gefunden und dem Autor bisher zahlreiche Lesungen und interessante Bekanntschaften und Gespräche eingebracht. Der Stülpner-Karl ist schon ein Phänomen. Dieser Analphabet zwingt nach wie vor alle möglichen hochgelehrten Leute dazu, sich mit ihm zu befassen. Wissenschaftler wie die Historikerin Britta Günther M.A., wie Kunst-Prof. Dr. Roland Unger oder PD Dr. Jähne haben die Stülpner-Forschung und damit auch das Gesamt-Geschichtsbild inzwischen um weitere interessante Erkenntnisse bereichert. So wissen wir z. B. nun endlich, wer der Stülpner-Biograf Schönberg eigentlich war und wie zu Stülpners Zeiten eine Staroperation verlief.
Weiterhin erfreut sich auch Karl Sewarts Stülpner-Buch der Gunst des Lesers, bringt es ihm doch sowohl die historische Biografie als auch die legendäre Gestalt des erzgebirgischen Wildschützen nahe und regt es ihn dazu an, den Spuren Stülpners in dessen Heimat nachzugehen. Viele Touristen besuchen heute die Erlebnisburg Scharfenstein, nicht zuletzt darum, weil sie von Stülpner einst belagert wurde, weil er im Dorf Scharfenstein geboren wurde und aufgewachsen ist und heute seiner dort mit einer repräsentativen Ausstellung gedacht wird. Hier ein spannender Auszug, in dem ein Förster eine geradezu hellseherische Vorhersage trifft:
„Der Schuss kracht. Der Rehbock wirft das Gehörn in den Nacken, setzt zum flüchtenden Sprung an – und bricht zusammen. Ein Meisterschuss!
Doch der Schütze, der aus dem Fichtendickicht auf die Wiese tritt, ist kein ausgewachsener Jäger. Es ist ein langaufgeschossener, schmächtiger Junge von elf, zwölf Jahren. Vorschriftsmäßig fängt er den Bock ab. Stolz betrachtet er seine Beute. Es ist ein starker Sechser. Das Gehörn ist regelmäßig gewachsen, das Fell glänzt. Unter ihm zeichnen sich die kräftigen Muskeln ab.
Der Junge muss daran denken, wie er den Bock an manchem schönen Abend zum Äsen auf die Wiese hat treten sehen, wie er seine Lauscher spielen ließ, sicherte, den Sprung nachtreten ließ. Der Junge hatte beobachtet, wie der Bock zur Blattzeit den gefährlichen Spießer aus dem Nachbarrevier annahm, wie er einen hinterhältigen Stoß in die Flanke empfing, jedoch mit blitzschneller Wendung den Gegner frontal anging, auf die Knie zwang und vertrieb. Die Narbe von dem Dolchstoß ist noch zu sehen als struppiger Strich im glatten Fell. Doch nun rinnt der Schweiß, sickert das Leben aus dem Fangstich und färbt den Wiesengrund rot.
Der junge Schütze schlägt den Blick vor den gebrochenen Lichtern des Wildes nieder … Doch dann entsinnt er sich des Auftrags, den er übernommen hat. Er nimmt die Läufe des Bockes zusammen und versucht ihn aufzuheben. Doch so sehr er sich auch abmüht, es gelingt ihm nicht. So schleift er die Beute ins Dickicht, deckt sie mit Farnkraut und grünen Zweigen zu und eilt hinüber zum Holzabfuhrweg, rennt ihn entlang zum Schlagplatz, bittet einen der Fäller, ihm den Bock zum Försterhaus zu tragen. Der Mann folgt dem Jungen. Ihm fällt ein, dass der Förster für ein paar Tage über Land gegangen ist – wer also habe denn den Bock geschossen, fragt er den Jungen, ob es etwa ein gewilderter sei, den der Junge gefunden habe?
Der Mann will kaum glauben, dass der Junge aus dem Forsthaus der Schütze war. Doch er sieht ja an Gewehr und Messer, dass es wahr sein muss. „Das Schießen ist wohl leichter für dich als das Tragen“, sagt der Holzfäller kopfschüttelnd. Da es sich um eine herrschaftliche Bestellung handelt, trägt er dem schwachen Schützen die Beute. Stolz schreitet der mit geschulterter Waffe hinterher …
Der junge Schütze kann die Heimkehr des Försters kaum erwarten. Als dieser dann noch am selben Abend eintrifft, will der Junge ihm stolz und begeistert von seinem gelungenen Jägerstück berichten. Doch sobald der Förster begriffen hat, was geschehen ist, unterbricht er den Jungen. Er sieht nicht die außerordentliche Situation des plötzlich eintreffenden dringenden herrschaftlichen Lieferauftrags, er sieht nicht den eifrigen Willen des Jungen, ihn, den abwesenden Förster, zu vertreten, noch will er etwas von der weidmännischen Leistung seines Zöglings wissen. Er sieht nur, dass der Junge sein strenges Verbot, eine Waffe anzurühren, missachtet hat. „Dem Jäger ist die Flinte kein Spielzeug!“, ruft er in aufflammendem Jähzorn. „Wie oft hab’ ich dir das gesagt!“ Und er verweist auf den Spruch an der Wand:
„Jagen, Fischen, Vogelstellen,
Verderben manchen guten Gesellen.“
Der Förster greift nach dem Ochsenziemer, um seinen ungehorsamen Zögling zu züchtigen. „Ist das der Dank dafür, dass ich dich in meinem Haus aufgenommen habe, als deine Mutter dich nicht mehr sattbekam und deiner nicht mehr Herr wurde!“, schreit der Förster den Jungen an.
Zum Glück hat der Förster einen Gast mitgebracht, seinen Amtskollegen aus Stollberg. Ihm gelingt es, den Wütenden zu besänftigen. Anstatt seinen gelehrigen Schüler zu bestrafen, könne er doch stolz auf ihn sein, sagt der Kollege. Es sei doch ein Bravourstück von dem Jungen, das zeuge von der meisterhaften Ausbildung, die er hier genossen habe. Und er möge doch dankbar dafür sein, dass ihn sein Gehilfe der Mühe enthoben habe, diesen Abend selber noch auf die Pirsch zu gehen.
Den jungen Meisterschützen aber lobte er für die Bravour, mit der er den Auftrag erledigt habe, und er bat diesen, den Hergang genau zu erzählen. Danach erteilte er als erfahrener Weidmann dem jüngeren „Kollegen“, wie er ihn nannte, Ratschläge zur Handhabung des Gewehrs und zum Verhalten des Wildes und beschenkte ihn gar noch mit einem Gulden.
Am Ende wollte der Forstmann den Namen des jungen Jägers wissen.
„Ich bin der Stülpner Karl aus Scharfenstein“, sagte der Junge.
„Den Namen werde ich mir merken“, sagte der Förster. „Du kannst einmal ein ganz großer Jäger werden.“´
Erstmals 1998 veröffentlichte EDITION digital als Eigenproduktion „Der Durst der Seele. Mein Weg vom Pimpf zum NVA-Offizier, CIA-Agenten und Alkoholiker. Ein Lebensbericht“ von Ernst Klatt, der von Jürgen Borchardt bearbeitet und herausgegeben wurde: Ein erschütternder Bericht über ein dramatisches Schicksal im 20. Jahrhundert: Der Autor erzählt vom Leben der Deutschen im Westpreußen der 30er Jahre, von den Freuden eines Kinderherzens, dem friedlichen Nebeneinander der Deutschen und Polen, die plötzlich Feinde werden im Kriege. Ergreifend ist die Trauer des Kindes über den Verlust lieber Menschen und dann auch der Heimat.
Der Junge findet eine neue Heimat, erlebt Kriegsende, amerikanische und sowjetische Besatzung in einem westmecklenburgischen Dorf. Schließlich erfüllt sich ein Kindheitstraum: eine Karriere als Soldat und Offizier. Dies während der „wilden“ 50er Jahre, in der DDR.
So rätselhaft wie plötzlich aber gerät der Offizier, Frauenheld und fröhliche Trinker in die Mühlen des kalten Krieges: Entlassung aus der Nationalen Volksarmee, Anwerbung durch die CIA, Zuchthaus in der DDR. Ein Absturz ohnegleichen.
So unmerklich wie heimtückisch packen ihn nun aber die Klauen eines noch grausameren Gegners: Der Trinker aus Fröhlichkeit wird gefangen von König Alkohol. In schier übermenschlichem Ringen, nach Jahrzehnten, entkommt er – die Freiheit aber bleibt bedroht. Hier der Einstieg in diesen ungewöhnlichen Lebensbericht:
„Am Wendepunkt
[*]An einem Dienstag ging ich wie üblich zum Dienst. Zwei Stunden später musste ich zum Regimentskommandeur. Der Stabschef und der Politoffizier waren auch da. Mir wurde der Befehl Nr. 358 des Ministers für Nationale Verteidigung der DDR vorgelesen: Auf Grund eines Selbstmordversuches wäre ich mit sofortiger Wirkung vom Oberleutnant zum Soldaten degradiert und in Unehren aus den Reihen der NVA ausgeschlossen. Ich hätte alle Auszeichnungen zurückzugeben. Einige Wochen zuvor war ich noch vor allen Offizieren des Regiments ausgezeichnet worden, für die sehr guten Ergebnisse bei einer Kompanieübung (Angriff und Schießen mit scharfem Schuss). Ich hatte etliche Auszeichnungen, insgesamt an die 20 Belobigungen, darunter einige Geldprämien – für Offiziere ganz selten.
Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Innerhalb von zwei Stunden hatte ich den Entlassungsschein und mein Geld. Ich stand auf der Straße. Als ich wieder klar denken konnte, fragte ich mich: Entlassung, ohne dass ich überhaupt befragt wurde? So geht das doch nicht! Aber es ging. In mir wallte es, ich grübelte und grübelte. Selbstmordversuch, das war lächerlich; ich und Selbstmord – nie und nimmer! Ob mein Schwager, wegen Spionage zu viereinhalb Jahren verurteilt, der Grund war? War es Alkohol? Getrunken wurde natürlich, das machten fast alle, nach Dienstschluss. Aber ich kam nie betrunken zum Dienst. Oder war es der neue Regimentskommandeur, der nach oben zeigen wollte, auch er griff endlich durch? Überall in der Partei wurde ja „gesäubert“, warum nicht auch in der Armee!
Mein Anrennen gegen dieses Unrecht blieb ohne Erfolg. Da ließ ich mich auf eine Sache ein, die für mich schlimme Folgen haben sollte. Ich lernte einen Mann kennen, der für die Amerikaner arbeitete… Eines Tages sollte ich nach Westberlin, zu der Zeit kein Problem; es gab noch keine Mauer. Man brachte mich nach Oberursel im Taunus – Zentrale und Agentenschule der CIA in der Bundesrepublik Deutschland…
Westpreußen
Elternhaus und Kindheit (1932-1945)
Bevor ich zu meiner eigentlichen Geschichte komme, möchte ich etwas von den Großeltern und Eltern und aus meiner Kindheit erzählen. Sie haben mein Leben nicht wenig geprägt.
Meine Vorfahren waren vor Jahrhunderten aus Deutschland nach Russland ausgewandert, an den Don, in eine Kosakensiedlung. Den Großvater habe ich nur auf Bildern gesehen: Ein großer Mann, schwarzhaarig und sehr bärtig, eigentlich konnte man nur seine Augen richtig sehen. Er war Rittmeister bei den Kosaken geworden, wohlhabend und lebte mit meiner Großmutter in Rostow am Don.
Hier wurde auch mein Vater geboren. In einer Staniza, nicht weit von Rostow entfernt, besaßen sie ein gut gehendes Gehöft, das von einem Verwalter geleitet wurde. Die Großeltern waren Anhänger des Zaren und monarchistisch eingestellt. Beim Ausbruch der Oktoberrevolution schaffte mein Großvater seine Frau und ihre vier Kinder, zwei Jungen und zwei Mädchen, über die Grenze nach Polen zu Verwandten. Diese lebten in dem Dorf Klein Weburg nahe Graudenz. Großvater blieb bei seiner Einheit, im guten Glauben, dass über kurz oder lang die alte Ordnung wieder eingeführt würde. Er war ein treuer Anhänger des Zaren und des Kosakentums in Russland, einer Art Mittelstand, besser gestellt als andere Schichten aus dem Volk. Die Kosaken wurden zum Heer eingezogen, sie mussten aber ihr eigenes Pferd mitbringen, dazu die gesamte Ausrüstung, Kleidung, Säbel, Sattel, Hufeisen, Nägel. Sie hatten auch das Vermögen dazu, es gehörte zu ihrem Stolz, mit den eigenen Waffen zu kämpfen. Wie ich von Großmutter erfuhr, diente Großvater auf Seiten der Weißen, unter dem Ataman Petljura. Keiner hat Großvater je wieder gesehen, noch etwas von ihm gehört. So wuchs mein Vater mit den Geschwistern ohne Vater auf.
Großmutter hatte in Polen ein schönes Häuschen, ungefähr vier Kilometer vom Dorf entfernt, direkt am Waldrand. Die beiden Schwestern meines Vaters heirateten Mitte der 20er Jahre, Tante Hulda einen Großbauern im Nachbardorf. Unsere Gegend bestand aus deutschen Dörfern, an deren Rand aber auch Ukrainer und Polen wohnten, von denen die meisten dort schon geboren waren. Mein Vater und sein Bruder, Onkel Siegmund, arbeiteten bei ihrer Schwester Tante Hulda. Einer kümmerte sich um die Knechte und Pferde und der andere um die Schweizer, also um die Melker. Vater blieb bis 1931 bei seiner Schwester.
Meine Mutter war eine Wolgadeutsche. 1905, während der ersten Revolution, war sie mit ihren Eltern nach Sibirien verschleppt worden. Sie kam später elternlos zu ihrer Cousine nach Polen, in das Dorf von Tante Hulda. Hier arbeitete sie als Dienstmädchen. Hier also lernten Vater und Mutter sich kennen und heirateten 1931. Tante Hulda und ihr Mann Robert Schauer kauften ihnen im nahe gelegenen Dorf Plangenau ein kleines Haus, mit einem Garten und einem Stück Land von 15 Morgen. Plangenau war ein Runddorf mit einem großen Dorfplatz und einer Gastwirtschaft zum Ausspannen, mit einer Schmiede, darum die Höfe einiger Großbauern, mit einem evangelischen und einem katholischen Friedhof und einer Schule. Am Dorfende standen Baracken für die polnischen Tagelöhner.
Im Januar 1932 wurde ich hier geboren und in der evangelisch- lutherischen Kirche in Villisas getauft. Meine Taufpaten waren die Großbauern, bei denen meine Mutter vor der Ehe als Dienstmädchen beschäftigt war, sie hörten auf den für mich komischen Namen Ast. Es war damals üblich, dass dem Taufkind ein Tablett hingehalten wurde, auf dem drei Dinge lagen: Ein Stück Brot, ein Geldstück und ein Schnapsglas. Ich soll, so meine Mutter, nach dem Geldstück gelangt haben. Für die Verwandtschaft war klar, dass ich immer reichlich Geld im Leben haben würde. Darüber kann ich heute nur lächeln. Zu Ehren dieser Tradition muss ich aber sagen, dass ich immer Geld hatte, von Reichtum konnte jedoch keine Rede sein. Die Taufpaten hatten einige Verpflichtungen. Sie kümmerten sich um ihr Taufkind bis zum 14. Lebensjahr, also bis zur Konfirmation, meist mit kleinen Zuwendungen, auch an die Eltern des Kindes. Nicht allein meine Eltern, auch die Paten waren also für mich verantwortlich. Die Konfirmation hatten sie auch auszurichten. Was konnte mir unter solchen Umständen eigentlich passieren? Meine Pflicht war es, die Paten mit Onkel und Tante anzureden und sie öfters zu besuchen. Das hielt ich schon aus.
Die Gehöfte des Dorfes lagen meistens weit auseinander. Für die Dorfkinder war es selten möglich, zusammen zu spielen. Nur sonntags kam ich auch mit anderen Jungen zusammen. Wir Kinder beschäftigten uns mehr mit den Tieren auf unseren Höfen. Ich hütete schon als kleiner Junge die Gänse und Schafe und spielte mit unserem Hund Dina.“
Erstmals 1991 erschien im Eulenspiegel Verlag Berlin „Wir Beuteldeutschen oder Wie ich zum Widerstandskämpfer wurde. Satiren, Glossen & Feuilletons“ von Matthias Biskupek: Ist der Beuteldeutsche ein aufstrebendes Wesen? Was Sie über ihn wissen sollten. In zweiundvierzig kurzen Texten werden frech-feuilletonistisch und respektlos Zeichen einer so ungewöhnlichen wie atemberaubenden Zeit kommentiert: die Gegenwart der Jahre 1989 und 1990 des gelernten und respektive gewesenen DDR-Bürgers. Der Gebrauch von Zwerchfell und Verstand bei der Lektüre empfiehlt sich. Hier ein schönes Beispiel:
„Für Zensur, Aufsichtsbehörde und Papst
Es gab nie sog. Zensur – das kann man jederzeit freimütig nachlesen. Es gab helfende Hinweise, kluge Ratschläge nach vorn, mal ein nett gemeintes Kopfnüsschen, damit man einen Schritt in die richtige Richtung schnell loslief. Aber ich habe nicht einmal in meiner Laufbahn als ständig bedacht werdender Mensch erlebt, dass mir etwa ein dummer Witz verboten wurde.
Es wurde helfend hingewiesen, dass man dumme Witze nicht reißen sollte.
War es etwa falsch, dass man dumme Witze hinwegeliminiert bekam?
Praktisch lief das doch so ab: Ich brachte unbedarft ein noch äußerst unabgesichertes Manuskript. Voller privatistischer Meinung. Schriftlich habe ich nämlich oft meinen großen politischen Unverstand ausgedrückt. Meine Aufsichtsbehörde sah mich jedes Mal sehr milde an und sprach: Dein großer politischer Unverstand ist ja wieder mal sehr groß. Wir werden ihn schnell zu verkleinern wissen.
Hernach setzte sich meine Aufsichtsbehörde kameradschaftlich mit mir hin, streichelte mit einem weichen Bleistift meinen kantigen Text und erläuterte nebenbei die scharf-existenzielle Situation von Welt und Regierung und Apfelsinendistribution. Und sprach wie ein Arzt am Krankenbett des Fortschritts: Wir sind doch gewiss auch der Meinung, dass der Text bei dieser wirklich einmaligen Weltwetterlage von staatsbürgerlicher Unrelevanz ist.
Ja, auch meine Aufsichtsbehörde wiederholte sich nicht, sondern wusste immer neue Fremdwörter für mich.
Leider war ich zuweilen uneinsichtig. Dann sagte meine Aufsichtsbehörde mütterväterlich: Du kannst ja machen, was du willst. Sogar schreiben kannst du, was du willst. Aber ich muss die Verantwortung wahrhaben.
Da begriff ich die ganze Tiefe des Wortes: wahrhaben.
Es war einfach schön, schreiben zu können, was man wollte, welch dumme Gedanken einem auch grade im Kopf herumfuhrwerkten und aufs Papier herausplatzten: Das Gedruckte war stets ein Ausdruck wahrgenommener Verantwortung. Und wenn dennoch was Schiefes ohne mein Dafürkönnen hernach zwischen den Zeilen ausgedruckt worden war: Nicht ich wurde dafür belangt, sondern meine Aufsichtsbehörde.
Ich durfte hochgefährlichen, gedanklichen Sprengstoff aufhäufen; ich durfte zu frühe oder zu späte oder gar verflixt und zugenähte Ideen haben: Meine Aufsichtsbehörde hatte sie alle zu verantworten, wenn sie ruchbar wurden. Also umgab mich die Aufsichtsbehörde mit einer schützenden Käseglocke, wofür ich noch heute dankbar bin. Wie vielen geforderten Stellungnahmen, geharnischten Strafanträgen oder meuchelnden Messerstechereien bin ich dadurch entgangen.
Ich hätte meine Ideen verteidigen müssen, hätte mich Kritikern stellen müssen, die nur auf meinen jungfräulichen politischen Unverstand scharf waren, die mich in der Luft zerfetzen wollten, die mich hätten anprangern, verketzern, ein- oder gar auskerkern können. Nichts dergleichen geschah. Ich schrieb mich als blauäugiger Hansguckindieluft durchs Leben, und die Aufsichtsbehörde samt klug gehandhabter sog. Zensur behütete mich vor meiner eigenen Gefährlichkeit.
Es war eine Lust, zu schreiben und zu leben und dabei dauernd schiefzuliegen, ohne dafür gradestehn zu müssen.
Und wenn ich nicht nur vor eigenen Ideen behütet werden musste, sondern gar keine hatte? Nun, dafür gab es immer den Weiterwisser. Hatte ich nämlich keine Meinung, sagte man mir meine.
Wie ist das nun gemeint?
Man ist sich auch heute einig: Jedes Kind braucht seinen Erziehungsberechtigten. Leider aber ist man derzeit davon abgekommen, jedem mündigen Bürger seinen übermündigen Bürgen beizugesellen. Jenen Stellvertreter des Bürgers auf Erden nämlich, der ihm die Mündigkeit abnimmt, weil er im Besitz der Allgegenwart ist: den Bürgerpapst also.
Wichtig scheint mir auch heute für jeden Bürger ein solcher Papst zu sein, der einem die eigene Nichtigkeit verdeutlicht.
Solch Papst sagte mir jederzeit seine Meinung. Egal, auf welcher Kleingärtnerversammlung ich saß, welcher Verkaufsstellenbeirat mich zurechtwies, in welcher Zeitung ich las: Die Meinung des Papstes war allgegenwärtig. Und ich konnte frei entscheiden, dass auch ich der Meinung des Papstes war.
Nur, wenn es immer und überall eine päpstliche Meinung gibt, kann ich mich dazu verhalten. Positiv verhalten. In meinem Gesamtverhalten mich richtig gut dazu verhalten.
Was aber soll ich denn wollen, wenn keiner mir sagt, was ich wollen soll?
Hier erleben Sie ganz sinnlich ein Stück Erinnerung an unsere gute alte DDR, wie sie wirklich war.
Wir haben eine glänzende Vergangenheit hinter uns.“
Erstmals 2001 erschien im Verlag Edition D. B. Erfurt „Insel der Piraten. Ein Ferienkrimi“ von Dietmar Beetz: Es sollte ein Abenteuer-Urlaub werden, ein „Abenteuer-Ferien-Trip“, und tatsächlich war schon die Reise nach La Roca aufregend und abenteuerlich. Dann aber, angelangt auf dieser entlegenen Insel, befindet sich Falko, der 12-jährige Held, eines Nachmittags mit einer Blende vor den Augen, geknebelt und gefesselt, offenbar in einem Höhlenlabyrinth und fragt sich unter jähem Entsetzen: Was, wenn das kein Spaß ist, kein von Paps arrangiertes Abenteuer live? Beetz erzählt eine Geschichte, die hierzulande beginnt und in fremdländische Urlaubsgefilde führt. Dort schlägt die Exotik bald in einen Albtraum um, wird zu einem Abenteuer auf Leben und Tod. Wir erleben Falko in heftigen Schwierigkeiten und erfahren dann, wie alles begonnen hatte:
„IM DUNKELN
Nach wie vor weiß Falko nicht genau, ob er nur träumt oder das alles tatsächlich erlebt. Kneifen kann er sich nicht, wenigstens nicht richtig, schreien erst recht nicht; denn die Hände sind ihm gefesselt, und seinen Mund hat man kreuz und quer verklebt.
Auch mit der Sicht ist es so eine Sache. Einer der Piraten hat dem Jungen ein Tuch vor die Augen gebunden, wahrscheinlich einen mehrfach zusammengefalteten Fetzen, in der Eile jedoch – oder vor Aufregung – die Enden nicht allzu straff verknotet. Jedenfalls konnte Falko nach dem Überfall, als er wieder auf den Beinen stand und der erste Schreck sich gegeben hatte, wenn er nach unten sah, einen hellen Streifen und ein Stück von seinem karierten Wollhemd sehn.
Das ist jetzt kaum mehr möglich. Die Blende vor den Augen lässt nur noch einen Schimmer erkennen, einen unruhigen, hin- und herspringenden Schein, der vermutlich von einer Taschenlampe stammt.
Nacht kann es nicht sein, auch nicht Abend. Als sie aufgebrochen sind, Falko und sein Vater, war es kurz nach neun, als sie überrumpelt wurden, noch immer Vormittag, und ohnmächtig geworden ist Falko, obwohl er mit dem Kopf aufschlug, keinen Moment. Also muss der Weg, der am helllichten Tag eine Taschenlampe erforderlich macht, weg vom Tageslicht führen, vermutlich in eine der Höhlen, von denen es auf dieser verkarsteten Insel, wie Falko weiß, jede Menge gibt.
Anfangs ging es über einen Bergpfad, wie der Junge sie von Ausflügen mit seinem Vater her kennt, dann über schräge, leicht abschüssige Steinplatten, dabei aus Mittagssonnenschein hinein in die Dunkelheit. Nun, ein Stück weiter, wird’s plötzlich unwegsam.
Bisher wurde Falko mit einem Strick an den gefesselten Händen geführt, außerdem durch kurze Zurufe dirigiert. Da hieß es befehlend mal „Fuß!“, mal „Achtung!“, mal „rechts!“ oder „links!“ – das alles in ein und demselben rauen, leicht heiseren, spanisch akzentuierten Deutsch und, wenn nötig, mit einem entsprechenden Ruck.
Jetzt hört der Junge unvermittelt eine andere Stimme in der Landessprache.
„Alto!“
Er ahnt, dass es gleichfalls ein Kommando ist, wohl „Stopp!“ bedeutet, reagiert aber zu spät und stößt an seinen Vordermann, den Führer.
Die Folge – ein unwilliges, nachträgliches „Halt!“
Dann redet der andere Pirat, vermutlich der Chef der beiden, der eine helle, überraschend melodische Stimme hat. Der zweite, der, dem Falko bislang arglos und – nach dem ersten Schrecken – sogar ein wenig abenteuerdurstig gefolgt ist, er erwidert etwas, das sich nicht gerade begeistert anhört, und plötzlich fühlt sich der Junge gepackt, hochgehoben und wie ein Sack über die Schulter geworfen.
Hehe! versucht er zu schreien. Vergebens. Die Lippen sind ja verklebt.
Sie brennen unter dem Streifen, an dem sie gezerrt haben. Dabei geht es Falko durch den Kopf: Lustig ist das nicht gerade.
Und dann erst, während er davongeschleppt wird, tiefer hinein in die Finsternis, fragt er sich unter jähem Erschrecken: Was, wenn das alles kein Spaß ist, kein von Paps arrangiertes Abenteuer live?
VON ANFANG AN
Es sollte ein Abenteuerurlaub werden, ein „Abenteuer-Ferien-Trip“, und tatsächlich war schon der Start, der Aufbruch zu dieser Insel, etwas Besonderes, Aufregendes, eben ein Abenteuer.
So sieht es Falko selbst jetzt noch, obwohl er allen Grund hat, skeptisch zu sein; und so sah er es schon damals, an jenem Morgen vor gut einer Woche, als Mutter, Vater und er das Haus verließen und, beladen mit drei Koffern, zwei Rucksäcken und einer Reisetasche, durch den weißlich schimmernden, frisch gefallenen Schnee stapften.
Das Haus war verschlossen, jedes Fenster, jede Außentür sorgfältig verriegelt, die Alarmanlage eingeschaltet und die Heizung „auf Frostschutz runtergefahren“. Die Reise konnte beginnen – nein, sie hatte bereits begonnen. Für Falko war ihr erster, nicht unwesentlicher Teil der gemeinsame Gang durch den verschneiten Vorgarten, vorbei an der geschwungenen, unberührten Kellergarageneinfahrt zu einem Taxi, das mit Standlicht und laufendem Motor vor dem Gartentor wartete.
Taxifahren, zum Bahnhof, und von dort in einem dieser Wagen, die was vom Passagierraum eines tieffliegenden Jets an sich haben, Richtung Flughafen!
Draußen war Winter, Vorweihnachtszeit, der Mittwoch vor dem offiziellen Ferienbeginn. Für Falko aber, der hier im Warmen saß, in der Frühe eines frostigen, fern heraufdämmernden Dezembertages, für ihn hatten die Ferien bereits begonnen. Die letzten drei Unterrichtstage des alten Jahres waren ihm, dem Gymnasialschüler der 6 a, antragsgemäß erlassen worden, weil, wie es hieß, seine schulischen und außerschulischen Leistungen das ausnahmsweise erlaubten.
So in der Mitteilung des Direktors höchstpersönlich, die von Herrn Schmidt, dem Klassenlehrer, verlesen worden war und die übrigens ein paar gehässige Äußerungen nach sich gezogen hatte.
Bereits während der Verkündung der Worte des Direktors – an den Tischen hinter Falko spöttisches Schnaufen, da und dort auch Getuschel. In der Pause dann die Bemerkung von Petrak, Falkos altem Widersacher: „Der Köppke, das Ausnahmegenie!“
„Was du nur willst?“, erwiderte llka erregt. „Er ist doch tatsächlich gut, besonders in Sport und so!“
„Gut …“ Petrak schnaufte höhnisch. „Als käm ’s darauf an! Wenn du nicht die richtigen Alten hast …“
Daran war etwas, leider, und Falko wusste das. Gewiss, seine Leistungen konnten sich sehen lassen, und das sowohl im Mehrkampf bei Schul- oder Kreismeisterschaften wie im Unterricht, Singen und Zeichnen leider ausgenommen. Trotzdem vermutete er selber, dass er die drei Tage Zusatzferien hauptsächlich seinen Eltern zu verdanken hatte, dem Ansehen, das sie genossen – die Mutter als Kinderärztin und vor allem der Vater als Fernsehreporter, der zudem erst neulich wieder in einer spektakulären Talkshow zu bewundern gewesen war.
Hätte Falko Petrak entgegenhalten sollen, dass seine Eltern, seine „Alten“, sich seit vier Jahren keinen Tag gemeinsam hatten „freimachen“ können? Keinen einzigen Tag seit vier Jahren! Dass dieser Urlaub auch gedacht ist als Versuch, Familienbande, die erschreckend locker geworden sind, wieder festzuzurren.
Doch das zu einem wie Petrak, bei dem es, wie gemunkelt wird, daheim ebenfalls knirscht und dessen Vater, ein ehemaliger, zum Wirtschaftskaufmann umgeschulter Diplomingenieur, seit langem arbeitslos ist?
Falko hat nicht mit Petrak gestritten, sich aber geschworen: Wart nur, dir werd ich zeigen, dass ich selber wer bin und was kann!
Hinzu kommt, dass llka ihm auf dem Heimweg ein Versprechen abgenommen hat. llka, die immer so aufgeregt wirkt, wenn es um ihn, Falko, geht oder wenn sie mit ihm spricht.
„Wirst du Dias machen?“, erkundigte sie sich, ohne ihn anzusehen.
„Dias?“, fragte er, in Gedanken noch bei der Attacke von Petrak.
„Na, auf der Insel, wo ihr hinfliegt!“
„Klar“, erwiderte er, obwohl ihm der Sinn ihrer Frage eher unklar gewesen war, und in einer heftigen, ihm nicht ganz verständlichen Wallung fügte er hinzu: „Fotos macht vielleicht mein Alter, Dias und all den Kram, am Ende sogar einen Film. Soll er. Ich knipse hiermit.“ Er wies zu seinen Augen.
Ilka hatte ihn überrascht, ja beinah erschrocken von der Seite her angeblickt. Nun schaute sie wieder vor sich hin. Und erklärte plötzlich: „Prima. Tu das! Und wenn du zurück bist, erzählst du uns, wie’s war!“
Dazu ein Blick – diesmal so, dass Falko weggucken musste.
„Mal sehn …“, sagte er mit unsicherer Stimme.
Mehr versprochen hat er nicht, sich insgeheim aber gelobt, Ilka – sie vor allen anderen – mit einem sensationellen Erlebnisbericht zu überraschen.“
Einen sensationellen Erlebnisbericht kann Falko sicherlich bieten – wenn er denn von diesem Ferienausflug überhaupt wieder nach Hause kommt. Wer mehr darüber wissen möchte, wie dieses Abenteuer auf Leben und Tod ausgeht, der sollte sich diesen spannenden Ferien-Krimi von Dietmar Beetz nicht entgehen lassen.
Aber auch die anderen vier Sonderangebote sind es – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen – wert, angesehen und gelesen zu werden. Viel Vergnügen bei der Lektüre, weiter einen schönen September und bleiben Sie auch im Herbst weiter vorsichtig, vor allem aber weiter schön gesund und munter und bis demnächst.
EDITION digital war vor 26 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.100 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()