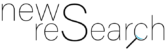Außerordentlich Märchenhaftes passiert in „Der Hexer aus dem Kupferwald“ von Aljonna und Klaus Möckel.
Mehr als 1000 Jahre Geschichte hat Renate Krüger in „Mecklenburg. Wege eines Landes“ im Blick.
Was Akten alles hergeben können, das zeigt Helmut Bulle in seiner aufwändigen Recherche „Die wilde Ehe der Justine M. Aktenkundiges vom Rennsteig“. Man muss sie nur lesen und auswerten können.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Das ist eine Erinnerung an die letzten Zeiten eines später untergegangenen Landes und an die Kämpfe, die damals um Natur und Umwelt und Gerechtigkeit ausgefochten wurden. Und man fragt sich, warum es in diesem kleinen Land nicht viel mehr Sympathie für diese Kämpfe gegeben hat und was die damaligen Helden heute machen würden. Ob sie vielleicht bei den Grünen wären oder wo? Die Geschichte von damals zeigt aber auch, was schiefgelaufen war im Sozialismus und was daraus hätte werden können. Insofern schwingt in der Erinnerung an die einstigen Kämpfe auch eine große Portion Trauer mit.
Erstmals 1984 veröffentlichte Wolf Spillner im Kinderbuchverlag Berlin „Wasseramsel. Die Geschichte von Ulla und Winfried“: Wasseramsel – das ist nicht nur der Name des seltenen Vogels, den Winfried und Ulla entdecken, der unter Wasser laufen kann und angeblich die Fischbrut aus dem Forellenteich frisst. Winfried nennt auch Ulla so, seit er sie zum ersten Mal sah, als sie im angestauten Waldbach badete. Zwischen beiden entsteht eine große Liebe, obwohl Winfried bisher nur Freude an schnellen Motorrädern fand und seine Mutter ihn noch zu jung für „Mädchengeschichten“ hält. Und dann hängt Ullas Bild auf der Ausstellung zum Heimatfest, es zeigt das schöne Tulbachtal im Landschaftsschutzgebiet, bevor dort Winfrieds Vater ein Haus baute und einen Forellenteich anlegte. Eines Tages ist Winfried fort, das Haus seiner Eltern verwaist, kein Zeichen, kein Brief gibt Ulla Nachricht.
Das durchaus gesellschaftskritische Buch wurde kurz vor dem Ende der DDR von der DEFA unter dem Titel „Biologie!“ von Jörg Foth (Regie und Drehbuch) mit Stefanie Stappenbeck und Cornelius Schulz in den beiden jugendlichen Hauptrollen sowie mit den beiden prominenten Schweriner Schauspielern Horst Rehberg (Generaldirektor Tübner) und Axel Werner (Bürgermeister Künzel) verfilmt und 1989/90 fertiggestellt, kam aber nicht mehr in die Kinos und wurde bisher nur einmal vom ZDF gesendet. 2019 war „Biologie!“ im Rahmen des Förderprogramms Filmerbe (FFE) von der DEFA-Stiftung digitalisiert worden.
Zurück zur literarischen Vorlage. Gleich am Anfang des Buches begegnen wir der Wasseramsel und – den beiden jungen Leuten:
„1. Kapitel
Der Vogel fliegt unter der Brücke hervor. Rasche Flügelschläge tragen ihn bachauf zum Forellenteich. Dort landet er auf dem hölzernen Überlaufkasten. Er dreht sich hin und her, seine weiße Brust leuchtet in der Nachmittagssonne, und sein kurzer Schwanz zuckt. Als der Junge näher kommt, stößt sich der Vogel vom Kasten ab, streicht flach über das gestaute Wasser und dann weiter den Bach hinauf, der den Teich gefüllt hat.
„Sieh mal nach, was diese Vögel machen“, hat der Vater dem Jungen gesagt, „die holen uns die Forellenbrut aus dem Teich!“ Nun steht der Junge da und blickt dem Vogel nach. Der ist ihm ziemlich gleichgültig, und die jungen Forellen sind es auch. Dem Vater aber nicht. Also muss er auskundschaften, was der Vogel wirklich treibt, hier oben am Teich.
Der Vogel landet im Bach auf einem der braunen, glänzenden Steine. Um ihn spritzt und gischtet das Wasser. Das scheint ihn nicht zu stören. Komisch, denkt der Junge, sieht gar nicht wie ’n Wasservogel aus! Wie soll der wohl Forellen fressen?
Plötzlich ist der Vogel kopfüber verschwunden. Der Stein ist leer, als hätte er dort niemals gesessen. Und das Wasser schäumt. Aber ein paar Meter weiter oben im Bach taucht der Vogel wieder auf. Er kommt flatternd aus dem Wasser heraus, fliegt auf einen anderen Stein, schüttelt sich und trägt etwas im Schnabel, das klein und schwärzlich ist. Oder grau vielleicht. Das kann der Junge nicht genau erkennen. Ein Fisch ist das wohl nicht. Diese Beute schlägt der Vogel heftig auf den Stein, stochert mit dem Schnabel und schluckt. Dann knickst er ruckartig auf und nieder, dreht und wendet sich und springt kopfüber ins Wasser.
Jetzt wird der Junge doch neugierig. Er will sehen, was der Vogel erbeutet. Sehr scheu ist er eigentlich nicht. Nur vorsichtig. Als ob er nicht gestört sein möchte bei seiner Jagd. So kommt es dem Jungen vor, und er überlegt, dass es besser ist, nicht so dicht am Bach zu bleiben.
Das Bachtal wird schmaler und steiler. Die Schmelzwasser haben hier in vielen Jahren eine tiefe Rinne gegraben. Umgestürzte Bäume liegen ausgewurzelt über dem Bach, Buchen und ausgewaschene Erlen. Der Vogel fliegt unter ihnen hindurch oder huscht blitzschnell über die abgeschliffenen Äste hinweg. Immer dort, wo das Wasser um die größeren Steine schäumt, landet er, knickst, lustig wippend, dann taucht er wieder. Dem Jungen kommt es vor, als liefe der Vogel unter Wasser mit leicht gewinkelten Flügeln gegen die Strömung an. Das Wasser ist sehr klar. Der Vogel stochert mit dem Schnabel zwischen den Kieseln am Bachgrund. Wenn er Tropfen schüttelnd auftaucht, hat er kleine, schwarzgraue Beute im Schnabel. Es sind keine Fische.
Bis der Junge sich dessen sicher sein kann, vergeht eine ganze Weile. Er muss langsam und vorsichtig im raschelnden Buchenlaub den Hang entlangsteigen. Er darf sich nur dann bewegen, wenn der Vogel unter Wasser läuft. Sobald er auftaucht, bleibt der Junge hinter einem Buchenstamm in Deckung. So kommt er dem Vogel näher. Doch dann muss er stehen bleiben. Mehrere Bäume liegen quer über dem Bach. Steine und Schlamm hat das Hochwasser zu einer Staumauer dazwischengepresst. Sanft plätschernd läuft Wasser in der ganzen Breite über dies Wehr, und der Vogel bleibt unter dem Wehr sitzen. Jetzt kann der Junge nicht dichter an ihn heran, denn er blickt sich nach allen Seiten um, steht aufgereckt auf dem Stein und wirkt besonders aufmerksam. Dann gibt er sich einen Ruck – seine Flügel heben ihn über das Wehr hinweg, und er ist verschwunden. Der Junge springt hinter dem Baum hervor und auf das Wehr zu. Doch da kommt ihm der Vogel von oben entgegen. Er ruft ein helles, sehr ängstliches „Zi – zitt“ und verschwindet so blitzschnell talwärts, als sei ein Habicht hinter ihm her.
Der Junge sieht ihm erstaunt nach. Da ist doch nichts, was ihm Angst machen könnte! Nur die Meisen wispern, und über ihm im Buchengrün schmettert sehr laut ein Finkenhahn. Und sanft und murmelnd fließt das Wasser vom Wehr über die Steine.
An einer dünnen Buche zieht sich der Junge den Hang hinauf, um über die Krone des Wehrs zu blicken. Doch er fährt zurück, blitzschnell. Einen langen Augenblick kann er sich nicht mehr bewegen. Er hält die Luft an. Er will es nicht sehen, und er will nicht gesehen werden. Er zieht langsam den Kopf ein und lässt sich nach unten rutschen. Und doch will er sehen, was ihm unfassbar ist: Der Wald um ihn her ist nicht mehr Wald und der Bach kein Bach mehr, und das Wasser, das sich hinter dem Wehr da staut, das wird zum Märchenweiher, an den zur Mitternacht die Elfen treten mögen.
Aber es ist ja nicht Mitternacht mit Mondenschein. Es ist ein warmer Nachmittag im Mai. Durch die Blätterlücken in den Baumkronen fällt Sonnenlicht auf einen Stamm im Wasser, und auf dem Stamm sitzt ein Mädchen, und das Mädchen ist sehr hell in diesem Licht, bis auf das dunkle Haar. Es ist überdeutlich und sehr nahe.
Der Junge hat nie zuvor ein Mädchen nackt gesehen.
Er ist an diesem Tag im Mai nicht ganz sechzehn Jahre alt, und an Mädchen denkt er nicht. Die Aktbilder im „Magazin“ oder solche, die aus irgendwelchen Heften oder Illustrierten aus dem Westen stammen mögen und die bisweilen von Jungen in seiner Klasse herumgezeigt werden, reizen ihn nicht. Ein Bild nur hat es gegeben, das er sich länger angesehen hat. Da saß eine Nackte auf einem Motorrad, und das war eine Honda! Achtzylinder! Das war es! Technische Zeichnungen von Motorradvergasern oder der Schnitt durch eine Teleskopfederung interessieren ihn mehr als die abgegriffenen Buntseiten. Er will Cross-Fahrer werden, und der Vater wird das Motorrad kaufen, wenn er sechzehn ist. Er träumt von den Six-Days und der Silbervasentrophäe.
Von diesem langen Augenblick an, von der Atemlosigkeit, vom Blick über die Stämme des Wehrs, wird der Junge von Mädchen träumen. Von diesem Mädchen wird er träumen, und er wird sich manches vorstellen.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der andern vier Sonderangebote dieses Newsletters:
Erstmals 1983 erschien im Verlag Das Neue Berlin in dessen DIE-Reihe (Delikte, Indizien, Ermittlungen) der Krimi „Blumen von der Himmelswiese“ von Steffen Mohr: „Raum ist in der kleinsten Hütte …“ – Wird sich dieses alte Dichterwort im Leben bewahrheiten – im Leben der Krankenschwester Roswitha mit ihrem Freund Norbert zum Beispiel? Als er nach dem tödlichen Unfall seiner Frau Brigitte zu ihr ins Schwesterninternat zog, empfand Roswitha ihr Dasein wie ein Inselparadies. Aber man kann nichts voreinander verbergen auf so engem Raum. Und wenn, wie hier, unerwartete Eigenschaften hervortreten, erscheint Vergangenes in einem anderen Licht. Die Frage, ob Brigitte wirklich bei einem Unfall verstarb, mehr noch, welche Rolle Norbert ihr selbst zugedacht hat, stellt sich Roswitha immer quälender. Sie findet die Antwort. Aber um welchen Preis! Hier der scheinbar harmlose Beginn dieses spannenden Buches:
„1. Kapitel
Mitten in der Stadt, in einer Idylle immergrüner Parkanlagen, die den Straßenlärm mildem, ragt sieben Stockwerke hoch ein hässliches gelbes Gebäude. Das Haus erweckt von weitem den Eindruck einer gewaltigen Tafel Ersatzschokolade mit gleichmäßig eingestanzten Riefen. Doch wird diese Gleichförmigkeit von mehreren Reihen hoher Fenster mit breiten Simsen unterbrochen.
Jeder der Simse bietet einer Legion Tauben bequem Platz für ihre tägliche Frühgymnastik. Der Koloss wirkt aus der Ferne etwa so anheimelnd romantisch wie eine Maschinenfabrik aus den Gründerjahren.
Beim Näherkommen deutet ein typischer Geruch, der die Erinnerung an Schmerzen und untätiges Herumliegen, an die Farbe Weiß und die verschiedenen Klänge von Glas weckt, auf seinen Zweck. Ein Schild am Eingang bestätigt schließlich die Vermutung. Man steht vor dem Städtischen Krankenhaus.
Durch die Hauptpforte trat ein schlaksiger junger Mann, der einen für die frühe Vormittagsstunde grotesk wirkenden Gesellschaftsanzug trug. Ruhig, vielleicht etwas zu lässig, hob er die Hand. Dabei schaute er dem Invaliden, der hinter dem Schalter auf Posten saß, nicht ins Gesicht. Der hatte, als die Tür ging, seinen Schmöker unter dem Kniestumpf versteckt. Als er in dem Besucher jedoch einen Bekannten erblickte, knurrte er bloß und holte die zerlesene Broschüre wieder hervor. Aber er las nicht sofort weiter. Mit dem geübten Blick seines Berufs musterte er den an ihm vorbeigeisternden Typ.
Freilich handelte es sich um niemand anderen als Norbert Schadendorf. Also um den Freund der kleinen Schwester Rosi seit etwa einem Jahr. Das war ganz richtig. Nur: Wie sah der Knabe heute aus?
Noch als Schadendorf längst im Hause verschwunden war, beugte sich der Pförtner aus seinem in Steißhöhe der Vorübergehenden angebrachten Schalter und dachte nach. Weder der liederlich gebundene Schlips noch die von Schmutz verkrusteten Schuhe waren seiner Aufmerksamkeit entgangen. Der junge Mann musste die halbe Nacht durch Pfützen gewatet sein. Denn schon vor Stunden hatte eine ungewöhnlich durstige Julisonne jeden Tropfen von den Trottoirs aufgesogen. Nach einer total verregneten Nacht war der letzte Guss zu Beginn der Frühschicht gefallen, gegen sechs. Hellmeier, so hieß der einbeinige Zerberus, fischte unter einem Stapel von Rätselzeitungen den Schichtplan der Schwestern heraus. Daraus ersah er, dass Schwester Roswitha in dieser Woche Nachtdienst hatte. Die Information befriedigte ihn. So wusste er genau, dass Norbert Schadendorfs Ziel nur das siebente Stockwerk sein konnte, exakt Appartement Nummer vierundzwanzig. Dort würde Schadendorf das Mädchen gerade im ersten süßen Schlaf stören.
Wahrscheinlich hatte der Bursche bis in die Morgenstunden in einer Bar herumgehockt. Wahrscheinlich war er zu Hause nicht hereingekommen, weil seine Frau den Schlüssel von innen steckengelassen hatte. Wahrscheinlich war er dann eine Zeitlang wütend durch den Stadtpark gestapft. Ebenso wahrscheinlich war, dass er einen zweiten Versuch unternommen hatte, in die eheliche Wohnung zu gelangen. Sonst wäre er früher erschienen als erst jetzt. Der altertümliche Wecker auf dem Rollschrank zeigte neun. Ebenso die elektrische Wanduhr. Da brauchte Hellmeier nicht erst hochzublicken. Nun hatte der schöne Norbert sicherlich nichts Schlimmeres vor, als an der zarten Schulter seiner Geliebten einzuschlafen, nichts weiter als einzuschlafen.
O unsere jungen Schwestern, seufzte Hellmeier in Gedanken. O diese kaputten Ehen. Daraufhin rückte er seine Brille zurecht. Er schlug den Schmöker an der Stelle auf, die er vorsorglich durch ein Eselsohr markiert hatte. Die wenigsten der im Haus untergebrachten Patienten wussten, dass das oberste Stockwerk in keiner Weise ihrer eigenen Station ähnelte. Da fanden sich nicht die Säle mit ihren in Reih und Glied gestellten Betten. Auch Untersuchungs-, Verband- oder Arztzimmer fehlten unter dem Dach völlig. Hier, Tür an Tür, in märchenhaft winzigen Behausungen von zehn Quadratmetern Größe, verbrachten die jungen Krankenschwestern die freie Zeit zwischen den Diensten. Freilich sahen die meisten zu, so oft wie möglich ihren Taubenschlägen zu entfliehen: in den Trubel der Warenhäuser und Cafés oder in eine der zahlreichen Nachtbars der Stadt. Blieb eine der Schwestern öfters daheim, so hatte sie einen festen Freund. Der gesamte Flur wusste dann, um welchen Mann es sich handelte, was der Auserwählte verdiente, ob er ein Auto fuhr, wenn ja, welchen Typ, und wie er in der Liebe war. Roswitha Fuhrmann, mit ihren siebenundzwanzig Lenzen eine der ältesten Bewohnerinnen des Schwesternflurs, gehörte zu den Mädchen, die selten in die Stadt ausschwärmten. Zu einem von den Nachbarinnen geplanten und verheißungsvoll ausgemalten Bartrip sagte sie vielleicht zunächst ja, dann aber immer entschieden nein.
Sie war ein kleines, etwas fülliges Mädchen mit einem wie aus weißrosa Porzellan modellierten Engelsgesicht. Für ihr unumstößliches Nein zu Vergnügungstouren, die bei den anderen zum normalen Lebensstil gehörten, hatte Roswitha verschiedene Gründe. Einer mochte ihr Vorleben sein. Da gab es zwei Verlobungen und zwei Aufenthalte auf einer Station, die nicht zu ihrem Arbeitsbereich gehörte. Jedes Mal hatte sie das Kind gewollt. Doch jedes Mal war kurz danach die Verlobung in die Brüche gegangen. So wollte sie dann auch das Kind nicht mehr.
Schwester Rosi, wie sie gerufen wurde, arbeitete in einem besonderen Sektor der Krankenpflege. Ihr Dienst an den Betten der Frauen, die manchmal kaum älter, manchmal sogar jünger waren als sie selbst, war leider nicht selten der Geburtshilfe genau entgegengesetzt. Im Jargon der Schwestern nannte man ihre Abteilung Krebsstation. Das mochte ein weiterer Grund für eine nach dem Dienst nicht gerade spontan aufbrechende Lust zum Ausschwärmen sein. Dennoch spielten die Härte des Dienstes und das ausgelassene Vorleben Schwester Rosis nur eine untergeordnete Rolle für ihre Zurückgezogenheit. Die entscheidende Tatsache war, dass ihr Freund zu jener Sorte von Männern gehörte, die sowohl verheiratet als auch verliebt sind, und das in zwei verschiedene Frauen. Weder wusste sie, wann er sich scheiden lassen, noch, wie es dann mit ihnen weitergehen würde. Auf einen kurzen Nenner gebracht: Sie blieb daheim, weil Norbert kam, wann er konnte oder wollte. Eben diesen Unterschied zwischen verhindertem Können oder mangelndem Wollen wusste sie bei Norbert nicht genau abzuschätzen. Anfangs empfand sie das reizvoll. Später quälte sie sich nur.
Manchmal wohnte Norbert mehrere Nächte bei ihr. Andere Male ließ er sich zwei Wochen lang nicht sehen. Roswitha wartete geduldig. Die Stunden des Wartens verkürzten das Radio, der Plattenspieler oder ein Besuch ihrer Türnachbarin Gesine. Von allen Mädchen hatte sie seit jeher Gesine am wenigsten gemocht. Die bildete sich einfach zuviel auf zu vieles ein – auf ihr Aussehen, ihren Fachschwesternabschluss und auf ihre eingebildete Art selbst. Rosi verachtete dieses Ich-bin-zu-schade-für-irgendeinen-Mann-Gebaren. Vor einigen Tagen erst hatte Gesine ihr in den Ohren gelegen, sich doch zur Fachschwester zu qualifizieren. Gesine bohrte damit in einer offenen Wunde. Denn zu den notwendigen Abend- und Nachmittagskursen hatte sich Roswitha mit Rücksicht auf Norberts unberechenbare Besuche nie recht entschließen können. In der Hitze des Disputs verpasste Rosi der vor Eigenlob fast dahinschmelzenden Nachbarin einfach eine Ohrfeige.
Der direkte Anlass war unerheblich.
Gesine hatte (mit ausgesuchter Freundlichkeit!) lediglich angefragt, ob Roswithas Bemühen um Norbert Schadendorf nicht ein paar deutliche Zeichen von Torschlusspanik trage?
Dem bösen Wort, kaum dass es ausgesprochen war, folgte die schallende Tat auf dem Fuße.
Die Mädchen versöhnten sich zwar noch am selben Abend. Aber ein unbestimmtes Misstrauen gegenüber den Schwestern, die mit ihr den Flur teilten, setzte sich seitdem stärker in Rosi fest.“
Erstmals 2002 veröffentlichten Aljonna und Klaus Möckel bei der LeiV Buchhandels- und Verlagsanstalt GmbH den Band 7 ihrer Nikolai-Bachnow-Bücher „Der Hexer aus dem Kupferwald“ – damals noch unter dem Pseudonym Nikolai Bachnow“: Im Kupferwald, wo es Aluminiumfinken, Goldschwanzaffen und Silberwölfe gibt, haust in seiner Hütte der finstere Hexer Kaligmo. Seine magischen Kräfte bezieht er von einem Strauch, dem er dafür sein Blut spenden muss. Kaligmo ist eingebildet und hält sich für den größten aller Zauberer. Als er bei einem Magierwettstreit in der Smaragdenstadt nur den dritten Platz belegt, schwört er schreckliche Rache. Er schickt schwarze Stachelmänner aus, die überall wildwachsende Dornenhecken und Kakteen pflanzen. Die Stadt soll zuwuchern und alles Leben darin erstickt werden. Eine Katastrophe droht, der Weise Scheuch, Prinzessin Betty und die anderen müssen etwas unternehmen. Vergeblich bemühen sie sich zunächst, den Urheber herauszufinden. Als der Hexer sich dann zu erkennen gibt, ist guter Rat teuer. Der Tapfere Löwe und Elefant Dickhaut, die Kaligmo aufsuchen, um ihn zur Rede zu stellen, werden in unzerbrechliche Glaskugeln gebannt; der Eiserne Holzfäller entkommt mit Not einem grässlichen Tod. Aber da der Scheuch, Betty, Jessica, Larry Katzenschreck und sogar der Storch Klapp sich zusammenschließen, wird der Zauberer am Ende doch noch gestoppt. „Wieder einmal stehen Freundschaft und Hilfsbereitschaft im Mittelpunkt der Märchenreihe und vermitteln Verständnis für Recht und Unrecht. So ist der ‚Hexer aus dem Kupferwald‘ erneut ein gelungenes Abenteuer, das ganz für Nikolai Bachnow spricht und der Reihe einen lesenswerten Teil hinzufügt“, schrieb zu diesem Buch Karolin Kullmann. „Endlich befindet man sich wieder in Gefilden, die nicht mehr futuristisch oder abstrakt anmuten“, fügte die Rezensentin damals hinzu. Hier ein längerer Ausschnitt, in dem ein seltsames Wesen vorkommt, und nicht nur eines …
„Der sprechende Strauch
Nachdem der Hexer dem Wolf ein ohnmächtiges „Na warte, dich krieg ich schon“ hinterhergerufen hatte, kehrte er murrend in seine Hütte zurück. Eins hatte er allerdings begriffen – er würde seine Ruhe erst wiederfinden, wenn er sich Genugtuung verschafft hatte. Für die Schmach in der Smaragdenstadt! Er wusste nur noch nicht, wie er das anstellen sollte.
Vier Tage und Nächte brachte Kaligmo mit Nachdenken zu. Besser gesagt, war es ein dumpfes Grübeln, unterbrochen von kurzem unruhigen Schlaf und wenigen kargen Mahlzeiten. Endlich glaubte er eine Lösung gefunden zu haben.
„Der Zauberstrauch mit seinen sprechenden Blättern muss mir die Lösung verraten“, murmelte er.
Dieser Strauch, der gleich hinter seiner Hütte wuchs, hatte scheinbar nichts Besonderes an sich. Genau wie die Bäume des Kupferwaldes waren seine Äste und Blätter aus rötlichem Metall, das in der Sonne glänzte. Genau wie die Früchte hier waren seine Beeren hart und nur von den Aluminiumvögeln zu genießen. Aber der Strauch war uralt und warf nie ein Blatt ab. Von ihm bezog Kaligmo seine Kraft, er musste nur ab und zu etwas Blut opfern. Dafür bekam er wiederum Antwort auf seine Fragen.
Freilich, betrügen ließ sich der Busch nicht. Der Hexer musste schon sein eigenes Blut spenden, nicht etwa das eines Huhns oder einer Kröte. Hier aber lag das Problem für Kaligmo. Er war wehleidig, fürchtete sich vor der kleinsten Verletzung und zögerte deshalb jedes Mal lange, den Strauch zu befragen.
Doch sein Rachedurst war stärker und so griff er schließlich nach einem großen Küchenmesser. Eine Weile überlegte er, ob er sich in den Zeh, in den Finger oder vielleicht in den Arm schneiden sollte.
„Ach was, ich nehme den Daumen“, sagte er missmutig, stellte ein Glas vor sich auf den Tisch und näherte die Hand mit Todesverachtung der Messerschneide. Als die Klinge endlich ins Fleisch drang, stieß er einen entsetzlichen Schrei aus. Aber er hatte es geschafft, einige Blutstropfen perlten in das Glas, der Strauch würde antworten müssen.
Der Hexer klebte ein Pflaster auf die Wunde, nahm das Glas und verließ die Hütte. Er hatte sich nicht gerade viel Blut abgezapft und als der Busch damit betröpfelt war, verging einige Zeit, bevor die Blätter zu wispern begannen. Es war das Zeichen, dass sie ihr Wissen preisgeben würden.
Kaligmo berichtete, worum es ihm ging.
„Ich brauche ein besonderes Rezept, um in der Smaragdenstadt den Scheuch zu bestrafen, den sie weise nennen“, verlangte er.
„Ich weiß, wie man Gold zu Eisen macht“, begann ein Blatt.
„Gold zu Eisen? Ich glaube, der Scheuch legt keinen Wert auf Reichtümer. Das nützt mir nichts.“
„Ich kann dir sagen, wie man ihn in einen silbernen Uhu verwandelt und seine Frau in eine Messingeule“, gab ein zweites Blatt kund. „Die beiden müssten aber in den Kupferwald kommen.“
„Es ist mir zu kompliziert, ihn hierher zu locken“, erklärte der Hexer unzufrieden. „Er wird auch keine Lust haben, gerade mich zu besuchen. Ratet mir etwas anderes.“
Es wurde still. Dann wisperte ein Blatt tief im Innern des Strauchs:
„Du könntest ihm die schwarzen Kaktusmänner schicken. Ich verrate dir, wie man sie ruft.“
Kaligmo hatte noch nie von solchen Männern gehört.
„Wer soll das sein? Was können sie ausrichten?“
Das Blut im Busch war fast verdunstet. Das Blatt sprach so leise, dass sich der Hexer weit hinabbeugen musste, um etwas zu verstehen. Als er die Antwort gehört hatte, klatschte er in die Hände.
„Das ist gut. Das wird sie lehren, mich zu verhöhnen!“
„Du solltest den Stachelkugeln aber dein Blut beimischen“, flüsterte das Blatt.
„Mein Blut? Kommt nicht in Frage! Es reicht mir schon, dass ich euch damit bedienen muss.“
„Dann … nimm … Schlangenblut. Aber Vor… sicht …“
„Vorsicht in welcher Beziehung“, rief Kaligmo. „Ich versteh dich nicht.“ Er schlug wütend mit der Faust in den Strauch.
Doch der hatte keine Kraft mehr, Antwort zu geben. Die Blätter schwiegen. Um weiteres zu erfahren, hätte der Hexer erneut seinen Daumen anzapfen müssen. Davor aber graute ihm.
„Ach was, ich werd schon aufpassen“, sagte er laut. „Wie war das? Eine Paste aus Lehm, Kupferbaumharz und schwarzen Kaktusstacheln. Bei abnehmendem Mond zur Kugel geformt. Etwas Schlangenblut hinein. Gut, das alles lässt sich machen.“
Noch am gleichen Tag ging Kaligmo ans Werk. Lehm und Harz ließen sich leicht auftreiben, schwarze Kakteen, denen er die Stacheln abschneiden konnte, fand er in der Ebene. Schwieriger war es schon, eine Schlange zu fangen. Aber auch das schaffte er letztlich, indem er Drahtnetze mit Fleischködern auslegte.
Als Kaligmo alles beisammen hatte, rührte er einen dicken Brei an und formte bei abnehmendem Mond, vorsichtig, damit er sich nicht an den Stacheln verletzte, mehrere kinderkopfgroße Kugeln. Er trug sie hinaus auf die Lichtung, legte sie im Halbkreis ins Gras, holte seinen Zauberstab und rief:
„Kantus, Kaktus, Höllenglut,
zeig dich, schwarze Dornenbrut!“
Mit der Stockspitze wies er nacheinander auf jede der Kugeln und stampfte dabei mit dem Fuß auf.
Einige Sekunden lang geschah nichts, dann aber ertönte ein Zischen und Knacken, Flammen züngelten im Gras auf und die Kugeln begannen zu wachsen. Sie bewegten sich hin und her, bekamen Auswüchse, reckten sich eiförmig empor. Das erste Ei reichte dem Hexer bereits bis zum Kinn, das zweite hatte Brusthöhe, das dritte ragte über den Gürtel hinaus. Plötzlich gab es einen Knall, die erste Kugel war geplatzt und heraus sprang ein rabenschwarzer Kerl, stachlig wie ein Kaktus. Er schaute sich verdutzt um und fragte:
„Bist du mein Herr?“
„Der bin ich und ich verlange unbedingten Gehorsam“, erwiderte Kaligmo.
Der Mann, einen Kopf größer als der Hexer selbst – im Ei hatte er sich zusammenducken müssen -, wollte etwas sagen, aber ein zweiter Knall ertönte. Dann ein dritter, vierter und so weiter. Endlich standen acht Kaktusmänner vor Kaligmo.“
Erstmals 2007 veröffentlichte Renate Krüger im Godewind Verlag Wismar „Mecklenburg. Wege eines Landes“: Über 1000 Jahre Geschichte Mecklenburgs von der Ersterwähnung der Burg Mecklenburg (Michelenburg) in einer Urkunde König Ottos III. im Jahre 995 bis zur Gegenwart: Die Autorin beschreibt die wichtigsten politischen Ereignisse, Stärken und Schwächen der Herrscher, Kirchengeschichte, Kultur, Sprache, kurz, präzise und sehr interessant. Einen breiten Raum nimmt die Identitätsfindung ein: Worin unterscheidet sich der Mecklenburger von anderen Deutschen, was macht ihn so liebenswert? Hier ein weiter Blick zurück:
„Das Auerochsenhaupt mit der später hinzugefügten so genannten wendischen Krone ist Selbstdarstellung, Wunschtraum, auch nostalgische Verklärung. Das bezwungene und unterworfene, dienstbar gemachte Tier ist als Symbol der Stärke und der Starken, Abschreckung im Machtkampf, fast eine Parallele zur Wirkung der Gorgo Medusa aus der griechischen Mythologie, deren Anblick erstarren ließ und tötete.
Unter diesem Zeichen entwickelte sich auch die Nachbarschaft der Slawenstämme, insbesondere der Obotriten, zu den Dänen im Norden und den Sachsen im Westen. Von den Sachsen wurden die Obotriten vor allem als unberechenbare gefürchtete Räuber erlebt, die in wohl organisierten Zügen ins Nachbarland einfielen und mit reicher Beute wieder in ihre unzugänglichen Seengebiete zurückkehrten, Verwüstung und Zerstörung hinterlassend.
Gegen Ende des 8. Jahrhunderts treten die Obotriten in neue geschichtliche Zusammenhänge ein. Zum ersten Mal wird ein Fürst namentlich genannt, Witzan, der ein Bündnis mit Karl dem Großen einging, nachdem die Sachsen gewaltsam ins Frankenreich eingegliedert worden waren. Der Frankenkönig und spätere Kaiser brauchte die Hilfe der Obotriten gegen die Bedrohung durch die unterworfenen Sachsen und die Dänen, die seinem Reich gleichfalls feindselig gegenüberstanden. Aus dieser Konstellation entstand eine lang anhaltende und folgenschwere blutige Feindschaft zwischen Obotriten und Dänen.
Der Sitz des Obotritenfürsten in Mecklenburg, 6 km südlich von Wismar gelegen, gab dem Land den Namen und wurde zu einem festen historischen Punkt. Die „Michelenburg“ wurde erstmals 995 erwähnt, als Kaiser Otto III. (996-1002) hier eine Urkunde ausstellen ließ. Solche Burgen dienten in Kriegszeiten als Zufluchtsstätten für die Dorfbevölkerung der Umgebung. An schwer zugänglichen Stellen errichtet, in einem Sumpfgebiet, auf einer Insel, boten die Burgen Schutz für Mensch und Vieh und waren darüber hinaus sicherer und zugleich repräsentativer Wohnsitz für das Stammes- oder Sippenoberhaupt und den Kosmos der Stammesgottheiten. Die Gesamtheit der obotritischen und wilzischen Burgen ergab ein gestaffeltes System mit den klar unterschiedenen Funktionen von Hauptburg, Nebenburgen und Verteidigungslinien bildenden Grenzburgen, das in dieser klaren Ausprägung einen längeren Entwicklungsprozess voraussetzt. Die wichtigsten Burgen sind mit ihren Namen überliefert: Schwerin, Wiligrad (auch Weligrad genannt, das spätere Mecklenburg), Dobin und Ilow bei den Obotriten, Werle bei den Kessinern, Stargard und Rethra bei den Redariern.
Über Anlage und Bau solcher Burgen hat ein jüdischer Reisender um 973 berichtet. Ibrahim ibn Jacub, vermutlich ein Arzt, bereiste im Gefolge des Kalifen von Cordoba im seinerzeit islamischen Spanien die slawischen Länder an der Ostsee und in Böhmen. Seine Berichte sind in einer Abschrift aus der Mitte des 11.Jahrhunderts erhalten und stellen wohl die älteste schriftliche Quelle über das Leben der Ostseeslawen dar, wohltuend sachlich und ohne Vorurteile. In späterer Zeit waren die schriftlosen Slawen Darstellungsobjekt von Berichterstattern, von denen sie meist als Gegner angesehen wurden.
Der Burgenbau scheint Ibrahim ibn Jacub ganz besonders interessiert zu haben. Aus seinen Beschreibungen spricht auch Bewunderung für diese Art des Bauens und die Funktionstüchtigkeit der Bauwerke. Zunächst suchte man sorgfältig nach einem Bauplatz, der bestimmten Normen und Anforderungen entsprechen musste. Ein Wiesenboden sollte es sein, der Nahrung für das Vieh bot. Wasser musste desgleichen für Mensch und Tier verfügbar sein, und es hatte auch der Verteidigung zu dienen. Unabdingbar war das Vorhandensein von schilfbewachsenen morastigen Uferzonen als Rückzugsgebiet und Versteck. Solche Gegebenheiten finden sich in Mecklenburg häufig.
Spätere Berichterstatter sind meist Geistliche, die ihr Material oft nur aus zweiter Hand erhielten und unter eingeschränkten Blickwinkeln verarbeiteten: die Überlegenheit des christlichen Glaubens, die primitive Wildheit der slawischen Stämme und eine gewisse attraktive Exotik. Es bedarf daher nicht nur sprachlicher Übersetzerkünste, um ein zutreffendes Bild slawischen Lebens entstehen zu lassen.
Die Obotriten errichteten im Westen Mecklenburgs eine territoriale Herrschaft, die weit in die Siedlungsgebiete der Liutizen hineinreichte. Nach deren Unterwerfung der Sachsen 789 drang das fränkische Heer tief in slawische Gebiete bis zur Peene vor. Mit solchen Zügen wollten die deutschen Kaiser in erster Linie die Ostgrenze des Reiches schützen.
Vorübergehend unterwarf Otto der Große die Obotriten und setzte einen Markgrafen für Ostholstein, Mecklenburg und Vorpommern ein. Im großen Slawenaufstand 983 ging die Markgrafschaft wieder verloren. Der Limes Saxonicus, der sächsische Grenzwall, kennzeichnete in der Folgezeit von Boizenburg an der Elbe bis zur Kieler Bucht die Abgrenzung gegen die Slawen, die von den Deutschen als Wenden bezeichnet wurden.“
Erstmals 2015 legte Helmut Bulle bei der Edition D.B. Erfurt „Die wilde Ehe der Justine M. Aktenkundiges vom Rennsteig“ vor: Lasst Akten sprechen! – 1835: Sechs Tage Gefängnis und drei Tage Fronarbeit für ein Stück Buchenholz; 1889: Wilddieb Becker am Höllteich bei Neustadt am Rennsteig erschossen – und zwischendrin, was nachzulesen ist im Staatsarchiv Rudolstadt zur „wilden Ehe“ der Justine Möller, anno 1839. – Kommentare überflüssig; Akten sprechen auch bei den anderen Texten, so bei der „Not der geschwängerten Maria Elisabeth Riethin aus Breitenbach“. Dazu zum Beispiel Folgendes:
„Die Unter-Akte Rieth oder Zur Not der geschwängerten Johanna Maria Elisabeth Riethin aus Breitenbach,
dargelegt anhand von Schriftgut aus dem Unterkonsistorium Gehren (1789 – 1792)
Brief des Breitenbacher Pfarrers Emmerling an das Unterkonsistorium Gehren
- B Breitenbach
Untersuchungsakte derJohanna Maria Elisabeth Riethin
Und
des Landgräflich Hessen. Leutnants Herrn Gottlob Adam Ludwig von Hopfgarten zu Breitenbach
…
1789
Praef.: d. 22. Juli 1789
Hochfürstl. Schwarzburg. Hochverordnete Herren Wohlgeborene und Hochehrwürdige Hochgeneigteste und Hochgeehrteste Herren.
Überbringerin dieses, Johanna Maria Elisabeth Riethin, des hiesigen Friseurs, Andr. Nie. Rieths, dritte Tochter, befindet sich schwanger, u. zwar, ihrem Vorgeben nach, von dem Leutnant Gottlob von Hopfgarten allhier, der es auch wohl nicht leugnen dürfte. Wie sie versichert, hat er ihr die Ehe versprochen und sie will ihn nehmen. Der Vater, dessen Warnungen die Tochter nicht gefolgt hat, ist aber nicht gesonnen, sich derselben anzunehmen: Und er ist es auch, wegen den vier Kindern, die er zu ernähren hat, nicht im Stande.
Er überlässt es der Tochter, zu thun, was sie wolle, und will die Heirat eben so wenig hindern als fördern. Dieses habe demnach einem Hochlöbl. Unter-Consistorio hiermit einberichtet sollen ehrerbietig beharrend.
Ihre Wohlgeb. und Hochehrwürdige Herren
Breitenbach, den 21. Juli 1789
Gehorsamster Diener
Joh. Jac. Emmerling
Brief von Hopfgarten an das Unterkonsistorium Gehren
praef. d.22. Juli 1789
Hochwohl. Ehrwürdiger
besonders höchst wertgeschätzter Herr …
Was der Riethin ihre Sorge und Unkosten anbetrifft weswegen sie Bericht erstatten ins Hochfürstliche Amt nach Gehren will ich bezahlen, im übrigen aber kann ich mich aus verschiedenen Ursachen halber auf weiter gar nichts einlassen.
Übrigens verharre mit aller Hochachtung
Euer
Hochwohl. Ehrwürden untertänigster Diener v. Hopfgarten
Protokoll der Anhörung der Johanna Rieth vor dem Unterkonsistorium Gehren
Praef. Du. Inspect. Kobel.
Actam, Gehren, den 22.Juli 1789
Bei fürstl. Unter Consistorio
Allhier … sich acto freiwillig
Johanna Maria Elisabeth Riethin aus Breitenbach überreichte den vorstehenden pastoralen Bericht nebst den Inlagen, wurde ad locum Consistorio vorgelassen, und, aus Befragen und Vermahnen zur Wahrheit, folgendermaßen vernommen: Sie gehe in das 20-ste Jahr ihres Alters, wäre noch unverheiratet, und die dritte Tochter des Friseurs, Andreas Niocol Rieth, zu Breitenbach welcher ihr Vater, so wie ihre Mutter, Anna Margaretha Riethin, noch am Leben wären, an welcher ihrer Eltern Brote sie sich bisher befunden habe.
Sie habe noch kein eigenes Vermögen. Ihre Eltern hätten ein Wohnhaus nebst einer … besessen, solches aber vor einiger Zeit für 500 … verkauft, nach Abzug der Schulden hätten sie von diesen 500 … nicht viel übrig behalten,
mit ihr hätten sie acht Kinder, und zwei wären gestorben.
Sie könnte nicht leugnen, dass Sie sich schwanger befände, und wäre
der Leutnant, Herr von Hopfgarten zu Breitenbach
ihr Schwängerer. Sie wäre im heurigen Winter ungefähr vier Wochen nach dem neuen Jahr bei einem gewissen Kappans zu Breitenbach zur Hochzeit gewesen. Sie und andere Hochzeit. Mädgen … wären da von den jungen Burschen, die sich auf der Kappansische Hochzeit befunden, zu das Breitenbachische Rathaus zu Weine geführt worden. Der gedachte Herr Leutnant von Hopfgarten hätte sich auch allda befunden, und wie sie des Morgens früh um 1 Uhr habe nach Hause gehen wollen, hätte dieser sie begleitet, sie aber nicht nach Hause in ihrer Eltern Wohnhaus gehen lassen, sondern mit sich fortgezogen, und mit zu seiner Mietwohnung im oberen Ende genommen. Hier sei es nun in der von ihm bewohnten Stube geschehen, dass er sich mit ihr auf seinem Bette fleischlich vermischt und sie dadurch geschwängert habe. Er wäre seit einiger Zeit schon bei ihren Eltern fast tägl. ein- und aus gegangen, und habe vorgegeben, dass er sie heiraten wolle, ihr Vater aber habe nicht darein willigen wollen, sondern wäre dawider gewesen.
Inzwischen bleibe er noch jetzt dabei, dass er sie heiraten wolle. Sie wäre auch gemeinet, ihn zu ehelichen, ihre Eltern sagten nichts dazu, und sprächen, sie sollte es machen, wie sie wolle.
Hierbei beharrte die Riethin facta prolectone, und gelobte hiernächst an Eides statt unter Nachsprechung der Worte
So wahr mir Gott helfe
Und sein heil. Wort!
dass sie vor dem Anbetrage gegenwärtiger Untersuchungssache aus dem hiesigen fürstl. Amtsbezirke nicht entweichen, vielmehr auf jedesmaliges Erfordern sich bei fürstl. Untere Consistorio allhier oder da, wohin diese Sache sonst gediehen möge, und das, was ihr an Strafe, Unkosten, oder der Kirchenbuße halber zuerkannt werden möge, leiden, büßen und nach vermögen zahlen wolle. Worauf dieselbe …. wieder entlassen wurde.
…
Unterschrift: Schubert ?“
Schon aus diesen wenigen Ausschnitten aus den Akten lässt sich die ganze Tragik hinter den dort beschriebenen Ereignissen ersehen. Helmut Bulle hat es sehr gut verstanden, die alten Papiere zum Sprechen zu bringen und scheinbar längst vergessene Menschenschicksale wieder lebendig werden zu lassen. Wie wird die Riethien wohl gedacht, gefühlt und weitergelebt haben? Nicht auf alles geben die alten Akten eine Antwort, dennoch sind sie spannend und ergreifend zu lesen.
Eine Einladung zur Lektüre und zum Erkunden höchst unterschiedlicher Räume und Zeiten sprechen auch die anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters aus. Und auch sie erzählen von Menschen und ihren Schicksalen, von Liebe und von Schwierigkeiten, in die sie selbst geraten oder in die sie andere bringen. Wie eben das Leben so spielt …
Viel Vergnügen beim Lesen, weiter einen schönen Sommer, bleiben Sie trotz mancher sich ankündigender Corona-Erleichterungen weiter vorsichtig, vor allem aber weiter gesund und munter und neugierig auf das Leben und auf die Literatur und bis demnächst.
EDITION digital war vor 26 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()