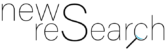Um extreme Tiefen, Machtinteressen und Geheimhaltung geht es in dem politischen Abenteuerroman „Eiskalt im Paradies“ von Wolfgang Schreyer.
Utopische Anekdoten um den erfindungsreichen Mechanikus Fränki und seinen ihm anhängenden Freund Joschka präsentiert Gerhard Branstner, der literarische Anwalt der Heiterkeit, in „Der astronomische Dieb“.
„Anton G. Eine Krankengeschichte“ – so lautet der Titel des Buches von Dietmar Beetz. Doch dieses Buch ist zweifellos mehr als eine Krankengeschichte.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Heute geht es um einen Aufstand gegen Ungerechtigkeiten, um die Angst der Herrschenden und um Rassismus. So darf nicht sein, was nicht sein darf. Kommt uns das nicht schon wieder irgendwie bekannt vor?
Erstmals 1965 erschien als Heft 109 der ERZÄHLERREIHE des Deutschen Militärverlags Berlin die Erzählung nach Tatsachen ‚Panzerschiff „Zeven Provincien“‘ von Hasso Grabner: Der Matrosengefreite der Königlich-Niederländischen Marine Mauritius Boshart von der „Zeven Provincien“ wird 1933 zu 16 Jahren Haft verurteilt, gefoltert und geschlagen, weil er gemeinsam mit Eingeborenen von Niederländisch-Indien einen Aufstand angezettelt haben soll. Der wahre Führer des Aufstandes war der indonesische Matrosengefreite Kawilaran. Aber das wollen die Herren nicht wahrhaben. Ein Eingeborener darf nicht das Offizierskorps Ihrer Majestät gedemütigt, ein Kolonialreich in Schrecken und die Welt in Staunen versetzt haben. Wenn dieser peinliche Vorfall schon geschehen ist, dann muss er wenigstens von einem Weißen, von einem Angehörigen der höheren Rasse, verursacht worden sein. Anlass war die Senkung der schon viel zu niedrigen Heuer. Aber es ging um mehr: um die Unabhängigkeit des indonesischen Volkes, das in Freiheit selbst über seine Geschicke bestimmen wollte. Hier der Beginn dieses ebenso spannenden wie kämpferisch geschriebenen Romans:
„1
Verdammt fern der Heimat bist du hier, Maud! denkt der Matrosengefreite der Königlich-Niederländischen Marine Mauritius Boshart. Laut kann er das nicht sagen, weil er jetzt nicht dran ist mit reden. Jetzt redet der Staatsanwalt Ihrer Majestät der Königin Wilhelmina, die, einige tausend Meilen entfernt, im winterlichen Den Haag sitzt und sicherlich nicht viel weniger erbost ist als ihr ergebener Kapitänleutnant und Rechtswahrer beim Hohen Militärgericht von Madura, erbost über den unverschämten kleinen Matrosengefreiten Boshart, der gewagt hatte, woran ein biederer Holländer nicht einmal im Schlafe denkt.
Ja, der Herr Kapitänleutnant hat viel zu reden. Er ist dran, er allein, und er weiß, dass er dran ist, und er weiß auch, dass er die Macht dazu hat. Gegen eben diese Macht haben sie sich aufgebäumt: der kleine Matrosengefreite und seine Spießgesellen, alles kleine Gefreite oder noch weniger als das. Viel weniger sogar, denn Maud Boshart hat „Kumpanei mit Farbigen“ getrieben. Gottsverdorri! Wo hat es das je gegeben: Ein Soldat Ihrer Majestät – ausgesucht, ausgebildet, bezahlt und der Ehre würdig befunden, Ihrer Majestät Macht und Ansehen in Niederländisch-Indien zu festigen, zu mehren und gegen die neuerdings aufflackernde Anmaßung des braunen Pöbels zu verteidigen – tut akkurat das Gegenteil; dieser pflichtvergessene Mensch verbündet sich mit diesem Gesindel, das kaum den eigenen Namen schreiben kann, um die Ehre und das Ansehen Ihrer Majestät zu untergraben, um vielleicht sogar alle Mühen und Opfer zunichte zu machen, die Väter und Vätersväter im alten Holland für dieses so schöne und vor allem nutzbringende Kolonialreich auf sich genommen hatten. Von dieser Art ist die Empörung des Herrn Staatsanwalts, und er redet und redet, teils, ihr Luft zu verschaffen, teils, die Herren des Hohen Militärgerichts von deren Gerechtigkeit zu überzeugen. Und das bedarf im Grunde genommen keiner besonderen Anstrengung. Unter den Militärrichtern befindet sich niemand, der nicht denselben königstreuen Zorn über die Frevel dieses kleinen Matrosengefreiten und seiner Freunde empfindet. Für dieses Häuflein unwürdiger Söhne Hollands wäre eigentlich der Strick nicht zu schade. Aber leider lebt man in Zeiten – einige Narren nennen sie zivilisiert –, in denen man mit Stricken sparsam umgehen und solche Leute sogar jahrelang durchfüttern muss.
Irgendwann wird er ja aufhören zu reden, denkt Maud Boshart, und kurz vor dem Ende des Sermons wird er die Stimme noch einmal heben und sagen: Der Matrosengefreite Mauritius Boshart – soundso viel Jahre, der Matrole Leeuwen – soundso viel, der Matrose Dannau – soundso viel, der Matrose Snel –soundso viel, der Matrose Doyeweerd – soundso viel Jahre. Es spricht sich ja so leicht aus: fünf Jahre – zehn Jahre – zwanzig Jahre. Die Zeit jedoch, die vergehen muss, bis man wieder frei ist, lässt sich kaum nach Sekunden messen. Zehn Jahre, zwanzig Jahre – das sind, weiß der Teufel, wie viele Sekunden. Unzählige.
Unzählige Sekunden, Maud, damit musst du dich schon abfinden. Einmal bist du nicht wie ein kleines Kind in die Geschichte gestolpert, sondern hast genau gewusst, was dir blüht; zum anderen haben die, die schon vor dir in derselben Sache auf dieser Anklagebank saßen, hohe Strafen erhalten, so dass du dir ausrechnen konntest, was mit dem geschieht, der als „Rädelsführer“ gilt.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters:
1982 veröffentlichte Wolfgang Schreyer im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig seinen Roman „Eiskalt im Paradies“: Indischer Ozean, Gegenwart. Auf Paradise Island trifft Danny Wolfe ein, englischer Ziviltaucher für extreme Tiefen. Sein Motto: Wo ich lande, da hat noch immer ein Wrack gelegen. Für die Royal Navy soll er einen Froschmann jagen, der wohlgerüstet und mit bestem Alibi den Sperrkreis des Marine-Stützpunktes durchbricht. Wolfe ist selbstbewusst, als Taucher ungeschlagen. Aber er steht im Schnittpunkt von Machtinteressen und erfährt nicht einmal, worum es wirklich geht. Gebremst von der Geheimhaltung und der Bürokratie in der britischen Abwehr, geschockt durch Tricks unter Wasser, verwirrt durch Rivalität und Doppelspiel an Land, wird er seines Auftrages überdrüssig. Er riskiert den Kopf für ein paar hundert Pfund, andere machen ein Vermögen. Jeder benutzt ihn, er ist auf sich allein gestellt. Wolfgang Schreyer veröffentlichte nach einer Zypern-Reise und eigenen Tauchversuchen 1966 sein Buch „Fremder im Paradies“. 1982 hat er den Stoff noch einmal neu gestaltet. So entstand aus dem utopischen Erfolgsroman ein spannender Abenteuerroman. Ironie, Sarkasmus und salopper Stil schärfen den Blick für eine beklemmende Realität. Vor dem Hintergrund der Weltpolitik im Öl- und Krisengebiet des Mittleren Ostens liegen die Dinge jetzt in härterem Licht. Das Buch ist Hubert v. Blücher gewidmet, einem hilfreichen Freund des Autors. Und so beginnt die Geschichte:
„1. Kapitel
Nur einfältige Menschen fliegen gern; vielleicht noch solche, die den Rausch der Geschwindigkeit lieben, den glatten Ortswechsel, ohne sich selber groß zu bewegen. Es ist durchaus kein Genuss. Man steckt mit vielen von der Sorte in einer zylindrischen Zelle, seiner Freiheit beraubt, in der Hoffnung, die Jungs da vorn möchten ihr Handwerk verstehen. Ich hasse Luftreisen, und die war eine der längsten; jedenfalls kam sie mir endlos vor. An dem Flug störte mich außerdem, dass ich ihn unfreiwillig antrat. Na gut – auch auf fremde Kosten, und es war ein teurer Spaß. Sie hatten die Linie in Schuss, wollten einem das Gefühl geben, hier sei der Fluggast noch König. Die Drinks und Menüs waren so fein wie die käufliche Freundlichkeit, Service genannt. All das lenkte mich ab. Mir gefiel auch der Film im Bordkino und der Blick auf die Küsten Afrikas; manchmal wälzten sich dort unten Flüsse gelb in den Ozean. Aber dann, zwischen Aden und Mauritius, wo es wenig zu sehen gab, nickte ich doch ein.
Schuld an dem Alptraum muss meine Beklommenheit gewesen sein. Eine innere Abwehr; man wählt ja sein Ziel gern selber aus, in Kenntnis der eigenen Kraft. Anderen fehlt meist das Augenmaß für das, was eben noch geht. Zu meinem Job gehört eine Portion Glück. Gewöhnlich glückt einem nur, was man sich selbst zutraut. Sie hatten in London zu wenig gesagt, als dass ich mir ein Bild machen konnte… Als die Stewardess mit dem Landebonbon kam, fiel mir nur noch der Schluss des Traums ein: Von auslaufenden Wellen sanft bewegt, der Körper eines Froschmanns, eingesiegelt in Neopren, Kopf im Wasser, Schwimmflossen an Land. Eine Ambulanz parkt neben dem Verunglückten, der Arzt zieht ihm die Atemmaske ab, während zwei bullige Zivilisten damit beschäftigt sind, einen hässlichen Hund fernzuhalten. Jemand fragt: „Zu schneller Abstieg?“ Der Arzt tippt an die Gaswechselautomatik. „Das Übliche. Da genügt ein bisschen Eis auf der Membrane, Sir. Hier schafft keiner mehr als achthundert Fuß. Was dann kommt, ist Artistik.“ – „Dann muss ein Artist eben her…“ Der Rest geht unter im Gekläff, im Gebalge mit dem Hund. Man schiebt die Leiche ins Auto, die Brust gebläht von der Rettungsweste, die nichts mehr gerettet hat, und es fällt der Satz: „Augen zu und an England denken.“ Einer der Sprüche, die sie so drauf hatten bei der Marine. Aus. Das war alles gewesen.
Kein gutes Omen. Ich schüttelte das ab, was blieb mir übrig, der Jumbo rollte schon aus. Es war Nacht, über den Begrenzungslichtern anderer Maschinen strahlte es trübrot vom Dach der Abfertigungshalle: PHOENIX AIRPORT – PARADISE ISLAND. Die Luft roch wie ein Badetuch, das feucht auf der Heizung gelegen hat. Nach dem Nebel daheim und dem Frühlingshauch bei der Zwischenlandung das dritte Klima heute. Auf der Gangway lockerte ich den Schlips, den umzubinden sie mir vorgeschrieben hatten, und fing an, nach einem zu suchen, der denselben trug, rotgrünes Schottenkaro, das Dessin hieß „Duke of the Islands“. Ein Teil des Indianerspiels, ohne das es nicht abgeht bei ihnen; wenn es auch sonst nicht hilft, so stärkt es doch ihr Wertgefühl… Unten stand nur eine schwarze Hostess, die mich in den Flughofbus lockte.
Eine Halle im tropischen Barackenstil, nicht klimatisiert, doch schon mit Bildtelefonen. Zwei Schlangen vor der Einreise, für „Briten“ und für „Sonstige“. Der Beamte warf einen Blick auf meinen Pass und winkte mich durch. Eben nahm ich den Koffer vom Band, als jemand mich antippte, ein stämmiger kleiner Bursche mit silbrigem Haar, er trug wirklich dieselbe Krawatte und sagte: „Glashart, nicht wahr?“
Das Kennwort. „Glashart und stinksauer“, antwortete ich, nicht ganz mein Text – ‚eiskalt und glashart‘ war die Parole –, ihm aber schien es zu genügen. Er hatte bestimmt einen Steckbrief von mir in der Tasche. Die Burschen überlassen nichts dem Zufall, anders gesagt: in Kleinigkeiten sind sie groß.
„Mr. Wolfe, mein Name ist Tom Clark, der Wagen steht bereit.“ Mir fiel ein schwacher Akzent auf, wie in dem Film, den ich an Bord gesehen hatte. Darin war ein Brite fremden Agenten in die Hand gefallen, weil er dem falschen Mann gefolgt war; das Kennwort hatte auch dort gestimmt. „Wohin bringen Sie mich?“
„Nach Tyana, Sir.“ Clark ließ den Motor an. „Es dauert eine Stunde, durch die Kontrollen an den Straßensperren. Danach aber schlafen Sie im ‚Stardust‘, dem besten Hotel der Insel.“
„Nett von Ihren Leuten.“ Es erleichterte mich, dass es Kontrollpunkte gab.
„Na, Sie sind doch nicht irgendwer!“ Ein Schild glitt vorbei: Tyana – 30 Meilen. Clark bog in eine vierspurige Fernstraße ein. Das Land zu beiden Seiten war merkwürdig kahl. Keine Spur von den Palmen, Gummibäumen oder Teeplantagen, die ich erwartet hatte. Im Scheinwerferlicht sah es aus, als seien die Felder kaum bestellt; ab und zu Hütten aus erdfarbenem Zeug, ungebrannten Ziegeln wohl. Paradies-Insel? Reichlich hoch gegriffen! Der Verkehr floss spärlich, man fuhr links wie zu Haus. Schweigend und sicher lenkte Clark an Shell-Tankstellen, parkenden Militärfahrzeugen und an den Benzinfässern vorbei, die die Wachposten als Hindernis aufgestellt hatten, so dass man zwischen ihnen Slalom fuhr. „Ein Ergebnis der Krawalle.“
„Was denn für Krawalle?“
„Nichts davon gehört? Ja, das Volk hier hat nun ’ne eigene Regierung, aber manchem reicht das schon nicht mehr.“
„Mir reicht die eigene Regierung. Wer hat mich eigentlich herbestellt?“
„Das Marineamt Tyana, Sir.“
„Geht es etwas genauer?“
„Tja, die Testabteilung der Unterwasser-Medizin. Geleitet von Commander Scott. Der Commandeur sucht ein As für extreme Tiefen.“
So oft ich später zurückdachte an diese Fahrt, erinnerte ich mich eines Unbehagens – des absurden Verdachts, einem Feind in die Arme zu laufen. Ich fürchtete das gewiss nicht ernsthaft, es war eher ein Gedankenspiel, und doch… Was Clark über das Marineamt sagte, war dürftig, ja idiotisch, wie auf Verwirrung angelegt. Sein Akzent allerdings erklärte sich harmlos – mit seiner Herkunft aus Wales. „Ich verkaufe hier bloß Klimaanlagen“, hielt er mir schließlich entgegen. „Der Fachmann sind Sie.“
Soviel Beschränktheit nahm ich ihm nicht ab, das Gespräch versickerte. Der nächste Posten hielt uns an. Clark zog ein in Kunststoff eingeschweißtes Papier, dem Zauberkraft innewohnte, denn man gab den Weg grüßend frei. „Regen fehlt“, meinte Clark zu der Halbwüste, die wir nun passierten. „Nur eine Ernte in zwei Jahren! Das Problem ist der Wassermangel.“
„Mir genügt Salzwasser. Mal zur Sache: wo liegt es?“
„Ringsum, Mr. Wolfe. Dies ist eine Insel.“
„Schon gut. Wo liegt euer Wrack?“
„Es gibt kein, Wrack.“
„Wo ich hinkomme, ist immer ein Wrack.“ Er trieb mir das zu weit, die Geheimniskrämerei; da musste man deutlich werden. „Hören Sie, ich bin völlig ausgebucht. In der Irischen See liegt eine Jacht bequem auf dreihundert Fuß, den Tresor voller Schmuck, der Bergungsvertrag läuft… Also, was wollt ihr von mir? Und warum gerade ich? Habt ihr selber keine Taucher?“
„Sie sollten das nicht persönlich sehen, Sir. Ein Computer hat Sie ausgewählt, wegen Ihrer Leistungsdaten.“
„Grüßen Sie ihn schön! Und wecken Sie mich, wenn Sie zur Sache kommen.“ Ich kippte die Sitzlehne flach, spähte verdrossen durch die Heckscheibe zum Himmel hinauf. Orion, Stier und Großer Hund mit dem Sirius, die hatten sie auch – in ganz anderer Position. Und noch nie hatte ich Sternbilder so klar gesehen, wie Silbernägel auf schwarzem Samt. Dabei fiel mir Claudia ein, es war ihr Vergleich gewesen. Sie hatte erzählt, dass seefahrende Araber schon vor tausend Jahren auf Paradise Island ein Observatorium gebaut hatten, wegen der reinen Luft. Sindbad war hier… Die gute Claudia, viel zu poetisch und zart für einen wie mich.“
1991 erschien im Hoch-Verlag die nach Motiven des Märchenromans „Das Leben der Hochgräfin Gritta von Rattenzuhausbeiuns“ von Gisela und Bettina von Arnim sehr frei nacherzählte Geschichte „Gritta von Rattenzuhausbeiuns – vom Rattenschloss“ von Christa Kožik: Gritta, Tochter des Hochgrafen Rattenzuhausbeiuns, wird von ihrer Stiefmutter in eine dunkle Klosterschule gesteckt. Zum Glück aber gelingt es der kleinen Gräfin, zusammen mit anderen Schülerinnen auszubrechen. Dass alles ein gutes Ende nimmt und dass auch die sensationelle Thronrettungsmaschine, die Grittas Vater erfunden hat, ein voller Erfolg wird, daran sind nicht zuletzt Grittas vierbeinige Freunde, die Ratten, beteiligt. Christa Kožik hat die Geschichte nach einer Vorlage von Gisela und Bettina von Arnim für junge Leser neu erzählt. Nach einem ebenfalls von Christa Kožik geschriebenen Drehbuch wurde das Buch 1985 unter der Regie von Jürgen Brauer mit der damals zwölfjährigen Nadja Klier als Hauptdarstellerin von der DEFA verfilmt. Aber begeben wir uns erstmals in das Erste Kapitel und damit zugleich in „Das Rattenschloss“:
„Es war einmal…
Ja, es war wirklich einmal, hundert oder zweihundert Jahre ist es her, da lebte in dem alten Schloss der Grafen von Rattenzuhausbeiuns ein Mädchen. Sie hieß Gritta.
Gritta lebte dort allein mit ihrem Vater, dem Hochgrafen Freiherr Julius Ortel von Rattenzuhausbeiuns und dem alten Diener Müffert, der aus Mitleid im Schloss geblieben war. Denn der Hochgraf Julius Ortel verarmte immer mehr. Regieren war nicht seine Stärke.
Als er jung war, hatte ihn sein Vater auf einige Belehrungsreisen geschickt. Er sollte lernen, wie man seine Untertanen streng beherrscht. Aber diese Reisen waren umsonst gewesen. Hochgraf Julius Ortel brachte es einfach nicht übers Herz, die Bauern für sich arbeiten zu lassen und ihnen hohe Steuern abzupressen. Doch mit Lust hatte er das Maschinen-Werkwesen studiert, und auf diesem Gebiet brachte er es zu einigen Erfolgen. Er erfand zum Beispiel eine Haferschneidemaschine für seine Bauern, die ihm aus Dankbarkeit dafür zeitlebens den Hafer lieferten. Dann erfand er noch ein Fern Sprachgerät, genannt Bellophon, eine Wasseruhr, die leider tropfte und immer nachging, und ein hölzernes Fahrrad.
Und seit sieben Jahren baute er an einer mächtig-gewaltigen Maschine: einer Thronrettungsmaschine für seinen König. Denn der König, im Volke König Gänserich genannt, bangte immerzu um sein Leben. Das hatte wohl seine Gründe, denn ein guter und gerechter König war er nicht, sondern eher faul, gefräßig und sehr ängstlich.
Die Angst um sein Leben ließ ihn wenig Schlaf finden, und so hatte er im Lande ausrufen lassen, wer ihm eine Thronrettungsmaschine baut, der soll reich belohnt werden: mit dem Maschinenwerks-Orden erster Klasse und mit einem Sack Goldstücke. Hochgraf Julius Ortel baute nun schon das siebente Jahr an dieser merkwürdigen Rettungsmaschine. Dafür hatte er einen Teil der Möbel verkauft, die Teppiche, Pferde, Kutschen und das gute Porzellan.
Andere Möbel wie Stühle, Tische, Bänke hatte er zersägt. Alles für diese, wie er sie selber nannte, mächtig-gewaltige Maschine. Das Schloss Rattenzuhausbeiuns, das hoch auf einem Berge lag, wie die meisten Schlösser, verfiel immer mehr. Die Türme wackelten, die Mauern bröckelten, die Säle und Zimmer waren voller Staub, so dass man immer niesen musste. Ging man durch die halbleeren Räume, konnte es sein, dass man über dürre Hühner, Mäuse und Ratten stolperte.
Die Ratten waren aber von der ansehnlichen Sorte und sahen nicht hässlich oder gar ekelhaft aus. Nein, nein. Ihr dichtes Fell war bräunlich und schwarzweiß gescheckt. Zutraulich waren sie und von einer gewissen Klugheit und glichen freundlichen Mäusen oder Hamstern.
In den Abendstunden, wenn die Berge vom matten Schimmer der untergehenden Sonne bestrahlt wurden, da regte sich ein seltsames Leben im Schloss. Es war ein Gewimmel von kleinen und großen Grauröcken. Sie balancierten munter auf den Dachbalken, den Säulen und Schränken herum, krochen in den Kamin oder versammelten sich auf der Fensterbank. Eine Rattenmutter mit sieben Kleinen lehrte ihre Kinder auf dem Seil zu tanzen, ein Rattenvater gab seinen Kindern Unterricht im Klettern.
Kurzum, diese muntere Rattenschar belebte das Schloss auf gemütliche Art und Weise, und keiner der drei Bewohner fürchtete sich vor ihnen.
Es waren wirklich freundliche Hausgenossen.
Allerdings benagten sie alles, was ihnen vor die langen Zähne kam: Stoffe, Möbel, Papier und sogar das Familienwappen war vor ihnen nicht sicher.
Die Leute in der Umgebung nannten das merkwürdige Schloss einfach das Rattenschloss. Aber sie sagten es mit freundlicher Zuneigung.
Die Dienerschaft hatte nach und nach das Schloss verlassen, und so lebten dort oben nur noch der Hochgraf Julius Ortel, die kleine Gritta und der alte treue Diener Müffert in fröhlichem Einvernehmen miteinander.
Der alte Müffert war, wie schon gesagt, aus Mitleid geblieben. Er diente als Koch und Leibdiener, als Turmwächter und Hofmeister.
Nach dem Tode der jungen Gräfin Amalia kümmerte er sich herzlich um die kleine Gritta, die ohne Mutter aufwachsen musste. Gritta zählte jetzt zehn Jahre.
Sie war ein fröhliches, anmutiges und sehr kluges Mädchen. Klug war sie durch die vielen Bücher geworden, die sie im Laufe ihres jungen Lebens schon gelesen hatte.
Lesen war ihre Lieblingsbeschäftigung, und sie verbrachte ganze Tage und lange Abende in der Schlossbibliothek im Turm. Dort standen in den hohen Regalen, die man mit einer kleinen Leiter erreichen konnte, alte dicke Bücher, in Leder gebunden. Manche waren so groß, dass man die Buchseiten mit beiden Armen umschlagen musste. Blätterte man in den Büchern, stiegen Staubwolken auf, und allerlei kleines Getier, wie Motten, Mücken und Bücherwürmer aus dem vorigen Jahrhundert kamen ans Licht. Gritta las und las, und ihre Wangen röteten sich, und sie vergaß Zeit und Raum beim Lesen. Ja, sie verschlang die Bücher geradezu. Sie wirkten wie ein Zauber, und die Gestalten aus fernen Jahrhunderten rückten ganz in Grittas Nähe und wurden lebendig. Zum Beispiel die Gräfin Bärwalda, die vor Zeiten in diesem Schloss gewohnt hatte. Sie war ihrem Geliebten in den Krieg nachgezogen, weil sie ohne ihn nicht leben konnte. Sie wollte ihn retten und verkleidete sich als junger Mann. So ritt sie auf das Schloss des feindlichen Königs, und mit einer List sperrte sie diesen drei Tage in den Schrank ein und forderte, dass er den Krieg beende.
So geschah es dann auch.
Auch die Lebensgeschichte des spanischen Ritters Don Quichotte, der ein bisschen weltfremd war wie ihr Papa, rührte Gritta an. Tapfer nahm dieser den Kampf gegen das Böse in der Welt auf. Seine Mitmenschen aber lachten ihn aus.
Stundenlang saß Gritta auf dem großen Holztisch der Bibliothek, eingerollt in den blauen Samtmantel ihrer verstorbenen Mutter, und las und las und vergaß alles um sich herum.
Manchmal setzte sich ihre Lieblingsratte Meta zu ihr auf die großen Buchseiten, und es sah aus, als lese sie mit.
Meta war rotbraun-schwarzweiß gescheckt und trug im linken Ohr einen goldenen Ohrring. Daran konnte man sie von den anderen unterscheiden.
Sie folgte Gritta wie ein Hündchen, und wenn Gritta einen besonderen Pfiff ausstieß, kam Meta sofort angerannt.
Es wäre ein fröhliches und unbeschwertes Leben auf dem Rattenschloss gewesen, wenn nicht diese merkwürdige Thronrettungsmaschine gewesen wäre.
Denn die Leidenschaft des Hochgrafen Julius Ortel wurde immer heftiger. Eigentlich war seine Maschine fertig. Es fehlten aber immer noch einige Kleinigkeiten zur Sicherheit. Und um die Maschine gründlich zu testen, mussten Gritta und der alte Müffert jeden Morgen zur gleichen Stunde in die Werkstatt des Hochgrafen kommen, um als Schleuderobjekte zu dienen. Doch davon später.“
1973 veröffentlichte Gerhard Branstner im Verlag Das Neue Berlin „Der astronomische Dieb. Utopische Anekdoten um den erfindungsreichen Mechanikus Fränki und seinen ihm anhängenden Freund Joschka“: Hier werden utopische Spiele geboten. Hauptakteur Fränki, dessen Auftritte kauzig, töricht oder gönnerhaft sein können, kennt kein Faulbett. Mit seinem Freund Joschka knüpft er Einfälle und Begebenheiten zu Anekdoten. Schelmischer Eigensinn rückt dabei manches Abenteuer in die Nähe eines skurrilen Spaßes. Einmal jagen sie durchs Weltall und narren mit listigen Manövern unangemessene Ansprüche ferner Sternenbewohner, dann wieder sind sie in heimischer Umgebung und probieren die halbe Unsterblichkeit aus. Das Inventar ihrer Spiele sorgt für Abwechslungen: Energieprobleme scheint ein Sonnenmobil vergessen zu machen, eine Ehrenkompanie lässt sich auf ganz andere Art abschreiten, Ärgernisse des Alltags werden durch schrille Signaltöne unüberhörbar gemacht. Der Roboter stellt sich in gelungener Vervollkommnung vor. Schreibern von Kriminalromanen wird ein guter Rat für alle Zeiten und Gelegenheiten gegeben. Das alles geschieht mit astronomischer Sicherheit. Also pünktlich und fast immer reibungslos. Und haben Fränki und Joschka mal ein etwas problematisches Abenteuer zu bestehen, gelingt ihnen ein witziger und das heißt hier rettender Einfall. Die utopische Anekdote stellt sich als Spiel mit fantastischen Apparaturen und gedanklichen Verstiegenheiten vor. Bei aller Kuriosität, die auch von singenden Blumen und einem Dirigenten, dem selbst bei größter Hitze kein Stirnschweiß perlt, zu berichten weiß, gehen in Branstners Anekdoten Gemütlichkeit und stimmungsvolle Heiterkeit nicht verloren. Hier einige Textauszüge:
„Der gravierende Unterschied
„Wir haben uns lange nicht gesehen“, sagte Fränki, als er mit seinem Freund Joschka auf der Erde zusammentraf.
Die beiden umarmten sich, und Joschka fragte: „Wie ist es dir ergangen während unserer Trennung?“
„Du hast Glück“, sagte Fränki, „mich lebend zu sehen. Ich bin eben noch dem Tode entronnen.“
„Wie das?“, fragte Joschka.
„Ich war auf dem Jo, einem der Jupitermonde“, berichtete Fränki. „Dort wurde ich von einem Löwen angefallen.“
„Auf dem Jo gibt es doch keine Löwen“, wandte Joschka ein.
„Wenn ich es dir sage“, behauptete Fränki. „Ich ging nichts ahnend durch einen neu angelegten Park. Der Jo ist, wie du weißt, seit Kurzem zu einem Fernerholungsgebiet des Sonnensystems gemacht worden. Wie ich also so vor mich hinging, stand plötzlich ein Löwe vor mir. Und eh’ ich mich versah, setzte er zum Sprung an. Er sprang aber viel zu hoch und landete weit hinter mir. Sogleich wandte er sich um und sprang ein zweites Mal, aber wieder viel zu hoch und zu weit. Vielleicht, so dachte ich, ist es ein ehemaliger Zirkuslöwe, der darauf dressiert ist, irgendwem über den Kopf zu springen, und nicht aufhört damit, bis der Applaus kommt. Ich klatschte in die Hände, der Löwe hörte jedoch nicht auf zu springen. Da ich mir allmählich die Beine in den Bauch stand, setzte ich mich nieder, und der Löwe fuhr fort, mir über den Kopf zu springen. Er sprang und sprang, und endlich wurden seine Sprünge immer niedriger und kürzer. Jetzt bekam ich es doch mit der Angst zu tun, doch eben da blieb er, nachdem er mir beim letzten Sprung das Haar gestreift hatte, völlig erschöpft liegen.“
„Und“, fragte Joschka, „war es nun wirklich ein Zirkuslöwe?“
„Im Gegenteil“, erklärte Fränki, „er war gerade aus Afrika gekommen und, kaum in das Freigehege gesetzt, über den Zaun gesprungen. Man hatte wohl die auf dem Jo bedeutend geringere Anziehungskraft nicht richtig veranschlagt gehabt.“ „Nur gut“, meinte Joschka, „dass der Löwe den gleichen Fehler machte. Und das nicht nur einmal.“
„Eben das ist der Unterschied“, sagte Fränki. „Der Mensch macht den gleichen Fehler nur einmal. Wenigstens, wenn er was auf sich hält.“
Schattenspiele
Von einer längeren Weltraumfahrt zurückgekehrt, hatte Fränki endlich wieder Muße, etwas zu erfinden, und er stürzte sich voll Eifer in die Arbeit. Diesmal schien ihm jedoch, ganz gegen alle Gewohnheit, der Erfolg versagt zu bleiben. Enttäuscht suchte er Joschka auf.
„Nun wollte ich einmal eine Erfindung machen, die wie keine andere der Menschheit auf die Sprünge geholfen hätte“, klagte er seinem Freund, „aber herausgekommen ist nichts als der bügelfreie Schatten.“
„Das ist allerdings von geringem Nutzen“, bestätigte Joschka. „Wenn wir unseren Schatten hin und wieder waschen würden, käme uns seine bügelfreie Qualität wohl zustatten. Wer aber wäscht schon seinen Schatten?“
„Kein Mensch!“, rief Fränki. „Ursprünglich war ich ja auch nicht auf den bügelfreien, sondern auf den überspringbaren Schatten aus. Und den ersten dieser Art solltest du bekommen. Aber mein Genie hat diesmal gänzlich versagt.“
„Andernfalls hätte ich dich sehr enttäuschen müssen“, meinte Joschka. „Ich für meinen Teil würde mir solch ein charakterloses Ding keinesfalls zulegen.“
Das Sonnenmobil
Eines Tages kam Fränki mit einem kleinen Kästchen unter dem Arm zu seinem Freund Joschka.
„Was bringst du da?“, fragte Joschka.
„Etwas ganz Besonderes“, sagte Fränki mit geheimnisvoller Miene. „Wenn ich einen Sonnenstrahl in dieses kleine Loch des Kästchens fallen lasse und den Hebel hier herunterdrücke, habe ich eine feste Verbindung zwischen Kästchen und Sonne hergestellt.“
„Und welchen Nutzen hat das?“, fragte Joschka weiter.
„Sobald ich das Kästchen an einem Fahrzeug anbringe und auf die Sonne einstelle“, erklärte Fränki, „fährt das Fahrzeug, da es jetzt mittels des Kästchens an die Sonne gebunden ist, mit dieser um die Erde herum. In vierundzwanzig Stunden hat es die ganze Erde einmal umkreist. Genau genommen“, fuhr Fränki fort, „ist es natürlich umgekehrt. Das Fahrzeug bleibt, da es jetzt an die Sonne gebunden ist und die Umdrehung der Erde um sich selber nicht mehr mitmacht, stehen, und die Erde dreht sich unter ihm fort.“
„Einfach toll!“, rief Joschka. „Aber was ist, wenn keine Sonne scheint? Hast du auch daran gedacht?“
„Nein“, sagte Fränki. „Das hätte mir die Arbeit verleidet.“
Ohne Kontakt kein Takt
Seitdem Fränki im Stadtverkehr eine kleine, auf den Rücken geschnallte Hubschraube benützte, klopfte er, wenn er seinen Freund Joschka besuchte, nicht mehr an die Tür, sondern schwirrte, so er es offen fand, wie eine Libelle zum Fenster herein.
„Die fortschreitende Technik“, sagte Joschka, als Fränki wieder einmal ohne anzuklopfen hereinschwirrte, „setzt die Verfügung des Menschen über sich selbst immer mehr außer Kraft. Ein jeder kann, ohne um Erlaubnis zu fragen und wann er will, in unsere Privatsphäre eindringen. Das fing mit dem Telefon an, und ich möchte wissen, womit es endet.“
„Mit dem Psychokommunikator“, erklärte Fränki. „Soviel ich gehört habe, wird in Kürze ein jedermann mit solch einem Gerät ausgestattet. Dann kann, wer immer Lust dazu hat, mit dir in Kontakt treten und feststellen, in welcher Stimmung du dich befindest. Und das nicht nur ohne deinen Willen, sondern sogar ohne dein Wissen.“
„Wenn sich alle Welt nach Belieben ein Röntgenbild meiner Seele machen kann“, rief Joschka, „hat die Autonomie der Persönlichkeit tatsächlich ihr Ende gefunden!“
„Im Gegenteil“, sagte Fränki, „sie ist erst jetzt wirklich erreichbar, und zwar in einem tieferen Sinne. Wie soll ein anderer wissen, ob er dir zu nahe tritt, wenn du dich ihm verschließt? Vermittels des Psychokommunikators hingegen weiß er jederzeit, wie es um dich bestellt ist, und kann darauf Rücksicht nehmen.“
„Ein komisches Gefühl ist das schon“, meinte Joschka, „in dem Bewusstsein zu leben, dass einem ein jeder zu jeder Zeit wie der liebe Gott in die Seele gucken kann. Wenn ihn das jedoch verpflichtet, mich nicht mehr aus dem Schlaf zu klingeln oder zur Unzeit durchs Fenster zu besuchen, könnte ich mich wohl daran gewöhnen.“
Die umgekehrte Utopie
Fränki hatte einen utopischen Roman geschrieben. „Wovon handelt er?“, fragte sein Freund Joschka. „Von einer kinderreichen Familie.“
Joschka machte ein verständnisloses Gesicht. „Aber das ist doch nicht utopisch.“
„Noch nicht“, sagte Fränki.
2006 erschien im Verlag Edition D. B. Erfurt „Anton G. Eine Krankengeschichte“ von Dietmar Beetz, welche „Claudia und ihren Kindern“ gewidmet ist: Im Sommer 2004 erkrankte Anton, einer der Enkelsöhne des Autors, und musste operiert werden. Diagnose: Hirntumor. Der Text, der daraufhin entstand, ist eine Krankengeschichte – und mehr als das. „Eigentlich“ – so ein Bücherwurm – „hat Beetz einen Roman geschrieben, eine Familienchronik, die straff und poetisch ein Stück Zeitgeschichte spiegelt.“ Und so beginnt die Geschichte, die nur scheinbar eine Krankengeschichte ist:
„Aus scheinbar heiterem Himmel
DA WAR EIN KIND,
ein Knabe an der, wie man einst schrieb, Schwelle zum Jünglingsalter, dem heute sogenannten Teenage; Anton – sein Name.
Anton G. hatte Mutter und Vater, ein Brüderchen, Großeltern und auch sonst eine zahlreiche, weitläufige Verwandt- und Bekanntschaft. Er lebte in A., einem Ort in Thüringen, dem Grünen Herzen Deutschlands, also dort, wo sich, treibt man diese Sichtweise auf die Spitze, das Zentrum Europas – 1 11und mithin der Mittelpunkt unseres Erdballs – befindet.
Hier nichts zu den Kriegen und Schwelbränden, Katastrophen und Hungersnöten anderswo, weit weg auf den Kontinenten im Süden, Südosten oder Südwesten. Auch nichts hier zu dem, was thüringenweit und in verwandten Ländern Ängste und Frust fast schon üblicherweise wieder und wieder in Siedepunktnähe trieb und treibt. Hier was zum Wetter.
Das war damals, 2004, kurz vor der Grenze vom Früh- zum Hochsommer, vielversprechend, ja verheißungsvoll. Juli, für Alte noch der Heumond oder Heuert, wie er im Wunschkalender steht, für Kids gleich Anton, Thüringer im Schulkindesalter, am 21. des Monats seit 13 Tagen: sommerlich sonnige Ferienzeit. –
13 Monate zuvor, im Juni 2003, lag Anton im Krankenhaus. Unterarmbruch beiderseits.
Er war mit Friedo, einem Freund, beim Sportplatz auf einen Kirschbaum geklettert, auf einen morschen Ast getreten, und da…
Friedo flitzte zum noch unverputzten Haus der Familie G., wo Kurt, das Oberhaupt, sich gerade an der Fassade zu schaffen machte, und als der, alarmiert, Richtung Sportplatz rannte, kam ihm Anton entgegen, wankend, an den erhobenen Armen die Hände wie geknickte Flügel.
„Bin von ’nem Kischbaum gefallen. Aus etwa vier Meter Höhe. Können auch viereinhalb Meter gewesen sein.“
So Pingel Anton, der Coolman, damals. –
Mittlerweile waren die Brüche verheilt, und an den Unfall hatten sich, als er sich jährte, außer Anton vermutlich nur dessen Mutter und ihre Eltern, die Großeltern mütterlicherseits, erinnert, auch sie bloß beiläufig.
Verdrängt jenes Unglück, wenngleich nicht vergessen – eine Art Schwelbrand, der aufschoss im Gedächtnis der Großeltern an jenem 21. Juli 2004. –
13 Tage vorher waren die beiden Alten in A. gewesen, hatten die Zeugnisausgabe und den bevorstehenden Urlaub der Familie G. – zwei Wochen bei Freunden in Mecklenburg – zum Anlass genommen, mal wieder vorbeizuschaun.
Gute Zensuren für Anton, obwohl nicht ganz so prächtig wie noch im Vorjahr, am Ende der ersten Gymnasialklasse; Nachlassen speziell in Mathematik, dem Fach, für das er als besonders befähigt gegolten hatte – und dann auch seine Schul-Unlust in letzter Zeit, die angeblich vergessenen Hausaufgaben, die zur Unterschrift nicht vorlegten Mitteilungen, Mahnungen, Tadel…
„Er kommt in die Pubertät, unser Großer“, diagnostizierte die Oma, um Festigkeit bemüht, und der Opa pflichtete kummervoll bei.
Bettina, die Mutter, nickte – in Gedanken offenbar wieder mal mehr bei dem nie gänzlich entwirrbaren, da und dort bereits verfilzten, durch Urlaubsvorbereitungen zusätzlich strapazierten Haushalts-Job-Ehe-Problemkonglomerat.
Beim Abgang nach diesem Kurzbesuch begleitete Anton die Großeltern zum Auto. Am Weg, auf einem Haufen Pflastersteine, der Tret-Roller, den er, erstmals mit einer Kugel in der Hand, Wochen zuvor beim Kegeln anläßlich der 1225-Jahr-Feier von A. gewonnen hatte.
Er müsse noch eine Feder auswechseln, dann wolle er ihn verkaufen; einen Käufer habe er schon.
So Anton – ungefragt – zum Opa, der stirnrunzelnd vor dem chromglänzenden, stellenweise bereits rostfleckigen Roller stehengeblieben war – eine Beiläufigkeit, die erst im nachhinein Gewicht bekommen sollte, und das gleich allem anderen
im Vorfeld des 21. Juli 2004.
Bei jenem Kurzbesuch 13 Tage zuvor – und knapp eine Woche vor dem Urlaub in Mecklenburg – sahen die Großeltern Anton zum letzten Mal scheinbar gesund.
ALS SIE ES ERFAHREN,
erst die Oma, dann – von ihr – der Großvater, ist es noch nur ein Verdacht, der nicht einmal beim Namen genannt wird, doch erfassen beide, von Berufs wegen mit Symptomen vertraut, dass da was Schlimmes zur Abklärung ansteht, von allem, was ihnen bislang innerfamiliär widerfahren ist, das Schlimmste überhaupt.
„Bettina hat angerufen.“
„Ja, und?“
Die Großmutter, die auf diesen Seiten „Katinka“ genannt werden soll – sie schluckt. Wartet, bis der Großvater seinen Arbeitsutensilienkoffer abgestellt hat. Sagt dann: „Vorhin – von unterwegs. Wegen Anton.“
Unwichtig, was der Großvater erwidert, wie er reagiert. Er, den seine Enkel „Teddy“ nennen, woraus er selber gelegentlich gern „Deppy“ macht – er hockt wenig später am Küchentisch, die Unterarme aufgestützt, die altersfleckigen Hände gefaltet.
Bettina, erfährt er, ist mit Anton zurückgefahren, allein; Kurt wird mit Oscar, dem Kleinen, nachkommen, mit der Bahn. – Nein, kein Ehekrach, im Gegenteil; was das betrifft, sei es schön gewesen. – Hätte es sein können.
Und dann – plötzlich: „Anton… Seit Tagen erbricht er, hat Kopfschmerzen und erbricht. Sie halten es… Sie haben es für einen Sonnenstich gehalten. Eine Bootsfahrt auf dem See dort, bei herrlichem Wetter, alle, auch Anton, in Höchstform – und seit der Nacht darauf das Erbrechen, ständig Übelkeit und nun, seit gestern Abend, auch – Doppelbilder.“
Das kommt fast tonlos heraus. Stille danach, doch im Ohr, im Kopf wie ein Echo – dieses Wort, die Bezeichnung für ein richtungweisendes, beängstigendes Symptom: Doppelbilder, Doppelbilder…
„Tina“, sagt die Mutter und Oma nach einer Weile, „sie wollte beruhigt werden, von mir hören, es sei nicht so schlimm, vielleicht doch nur ein Sonnenstich; aber ich hab ihr gesagt, dass Anton untersucht werden muss, gründlich und unverzüglich, dass sie am besten durchfährt mit ihm, weiter nach Arnstadt, gleich ins Krankenhaus zum Notfallarzt. Eigentlich müssten sie jetzt schon dort sein.“
ZU WARTEN MÜSSEN,
also gezwungen sein, untätig auszuharren – da werden, wie es ein vom Dasein durchgewalkter Sprücheklopfer auf den Punkt gebracht hat, selbst bei hellem Tageslicht Nachtmahr-Geschwader aktiv.
An jenem 21. Juli ging die Sonne 20 Uhr 25 unter, und die Dämmerung zog sich, hochsommergemäß, hin bis gegen halb zehn. Man konnte auf dem Balkon sitzen, an einem Glas nippen, was lesen oder zumindest auf bedruckte Seiten starren, doch spätestens um elf empfahl es sich, sich im Bett zu verkriechen.
Müde sein, wie betäubt – und dennoch die Lagerstatt fürchten. Ahnen, was da herankriechen, sich auf dich wälzen wird, sobald die Lid-Jalousien herabgehn und das Bewusstsein sich ausdimmt. Einer der Albträume, die im Gedächtnis hausen, sich nicht ausmerzen, sich allenfalls eine Zeitlang zurückdrängen lassen, ein Mahr, der seit Jahr und Tag auf der Lauer liegt – seit ziemlich genau einem Jahrzehnt…
Vor ziemlich genau zehn Jahren, an einem sonnigen Spätsommertag, war Teddy-Deppy mit Anton, seinem damals dreijährigen und im übrigen noch einzigen Enkel, zum Zoopark gereist, per Straßenbahn quer durch die Stadt von Ost-Südost nach Ost-Nordost – des Ausflugvergnügens erster, bereits hochinteressanter Teil.
Nach leeren Fensterhöhlen, vernagelten Fabrikmaueraugen, nach einem Baukran, einem Bagger da und dort, nach glänzenden Schnecken-Schleimspur-Geheimschriftzeichen auf einem Betonplattenweg und nach all den Tieren von A (wie Affe) bis Z (wie Zebra), durchweg alten Bekannten von früheren Zoobesuchen her – oben auf dem baumgekrönten Bergplateau als Höhepunkt: der Spielplatz mit Rutsche, Schaukel, Klettergerüst, mit schwenkbarem Bagger-Maul und frisch geöltem Drehwurm-Karussell.
Kaum Spielplatz-Gefährten-und-Konkurrenten an diesem Samstag-Vormittag. Wohl nicht mal ’ne Cola und ein Würstchen mit Senf oder viel Ketchup vom Kiosk weiter vorn; vermutlich nur Äpfel und Trinkpäckchen aus dem Ausflugs-Umhängebeutel.
All das tat der Hochstimmung keinen Abbruch – leider, könnte man sagen; denn beim Abmarsch, mittlerweile gegen Mittag, drehte Deppy, eben noch Karussell-Schwungmasse-und-Motor, durch und hob ab: fiel, Anton an der Hand, in Trab, geriet, betonwegabwärts neben Treppenstufen, in Galopp, in nicht mehr bremsbare Tal-Schussfahrt.
Der Sturz auf die Betonpiste – und kurz vorm Aufschlagen: ein Riss an der umklammerten Hand, dem wie mit Krallen gepackten Händchen.
Der Kopf, Antons Kopf – ein, zwei Zentimeter neben einer Treppenkante.
Keine Tränen, schon gar kein Geschrei, nicht mal ein Zucken der Mundwinkel. „Nichts tut mir weh, wirklich nicht, aber du, Opa, deine Hose… „
Und später, bereits in der Straßenbahn, als der Staub abgeklopft, der Jeans-Riss geglättet und die Abschürfungen an der linken Deppy-Hand mit Spucke behandelt worden waren, da erklärte Anton einer kritisch äugenden Oma nicht ohne Stolz: „Wir sind hingeschlagen.“
Sein Köpfchen, die rechte Schläfe – zentimeternah neben jener Treppenkante… Der Albtraum, der seitdem im Gedächtnis haust, seitdem auf der Lauer liegt, der sich nicht ausmerzen lässt, den du allenfalls zurückdrängen kannst, solang er nicht aktiviert wird und dich nicht in Panik stößt.
Der Anruf, der erwartete, kam kurz nach neun, und der stockende Wortwechsel, der sich ergab, hatte etwas Befremdlich-Starres.
Bettina teilte per Handy vom Parkplatz beim Krankenhaus mit, man habe von Meningitis gesprochen – hier ein hörbares Fragezeichen – und für morgen früh eine Untersuchung in der „Röhre“ angekündigt.
Ja, so die beiden Alten synchron am lautgestellten Telefon, das sei so üblich und nötig und gut so, und man dürfe, solle, müsse hoffen, und ob sie helfen könnten?
„Lieb von euch, danke, aber jetzt – jetzt noch nicht.“
Und als nichts nachkam, weder tröstlicher Schwindel noch die indirekte Bitte darum – von Bettina die Information: Jetzt fahre sie erst mal heim, stelle die Koffer rein, und dann hole sie Kurt und Oscar vom Bahnhof ab. –
„Gut, dass sie so eingespannt ist und kaum zur Besinnung kommt“, äußerte Teddy-Deppy nach einiger Zeit über den Rand eines Buches hinweg, und Katinka, über die Tageszeitung gebeugt, nickte – nickte, ohne aufzublicken.
Sie, schon im „Ruhestand“, würde morgen – uneingespannt -rumhocken oder rumtigern müssen, während er noch das Glück hatte, ja das Privileg genoss, in den Sielen zu gehn und kaum zur Besinnung zu kommen.
Fiel er auch deshalb rasch in Schlaf, schneller vermutlich als seine Katinka?
Als er wach wird, stehen die Zeiger beider Leuchtziffer-Wecker auf Viertel nach zwei. – Ende der Tiefschlaf-Phase und Ende des Selbstbetrugs.
Ein Tumor, geht es durch den Kopf, tinnitus-stur, ein Tumor, was sonst? – Ein Hirntumor.
Und da ist auch wieder jener Albtraum – die Treppenkante, Zentimeter neben der rechten Schläfe – eine Brandspur, von der man weiß, dass dergleichen Psychosyndrom genannt wird, posttraumatisches Psychosyndrom. Merkwürdig diesmal, dass der Schweiß nicht ausbricht, das Herz nicht zu rasen beginnt, dass all die Paniksymptome, ähnlich denen bei Absturzphobie, ausbleiben, und nicht minder seltsam, dass dem Alten da im Dunkeln plötzlich sein Vater in den Sinn kommt.
Dieser Uropa, Anton, an den du dich vielleicht noch erinnern kannst, war ein tatkräftiger, scheinbar völlig sachlicher Mann. Nie himmelhoch jauchzend, nie zu Tode betrübt, aller Duselei und Spökenkiekerei abhold. Dennoch verriet er, altersduldsam geworden, seinem aus seiner Sicht einschlägig missratenen, von der mütterlichen Linie geprägten Sohn, seit dem Tod seiner Mutter habe ihn jahrelang eine ihm unerklärliche, kaum beherrschbare Unruhe umgetrieben, zu Motorradrennen, Ski-Eskapaden, Sauftouren verleitet. Bis – und das ist der springende Punkt – bis der Krieg ausbrach, der Zweite Weltkrieg; da habe er plötzlich gewusst, das also war’s, und von da an sei er ruhig gewesen, gefasst, kühl – ja, so könne man sagen: kühl bis ans Herz hinan.
Seine Mutter, eine meiner Großmütter und eine deiner Ururgroßmütter – sie starb 1929, ziemlich genau zehn Jahre zuvor.“
Man kann sich vorstellen, welche Gedanken und Gefühle dieser schlimme Verdacht auslöst. Wie geht man mit einer solchen, wahrscheinlichen Diagnose um? Kann man irgendetwas tun, um zu helfen und mindestens zu trösten? Und welchen Sinn und Zweck hat das Leben? Dieses Buch von Dietmar Beetz ist nicht leicht zu lesen, aber es ist ein ebenso wichtiges wie mutiges Buch und zugleich ein Zeitdokument. Nun lässt sich dazu schwerlich Vergnügen beim Lesen wünschen, zum Lesen empfehlen kann man diese Kranken- und Zeitgeschichte dagegen schon. Diese Anstrengung lohnt sich.
Bleibt zum Schluss nur noch ein schöner Sommer zu wünschen, mit weiter zurückgehenden Einschränkungen des Lebens und mancher literarischen Entdeckung und bleiben auch Sie weiter vorsichtig, vor allem aber weiter schön gesund und munter und bis demnächst. Und im Übrigen verläuft die OP am 28. Juli 2004 zunächst offenbar erfolgreich. Nähere histologische Befunde sind allerdings erst später zu erwarten. Aber lesen Sie doch selbst …
EDITION digital war vor 26 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()