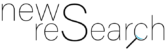Zehn spannende historische Abenteuererzählungen bietet „Der Turm des Todes“ von Otto Emersleben.
Auf eine ganz besondere Weise auf die Reise begeben sich Kinder in „Schatzsuche auf der Totenkopfinsel“ von Jan Flieger.
Packende Stories enthält „Am Kai der Hoffnung“ von Walter Kaufmann.
Um reichlich verwirrende Spuren geht es in „Die Suche oder Die Abenteuer des Uwe Reuss. Erstes Buch“ von Wolfgang Schreyer.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. Gegenwärtig scheint sich auf der Welt vieles, wenn nicht fast alles nur um das Thema Klimawandel zu drehen. Heute geht es um einen ganz besonders hinterhältigen Krieg – den Krieg gegen die Natur und gegen die Tiere, die zum Beispiel in Afrika von gewissenlosen, aber finanzkräftigen Leuten geradezu massakriert werden. Und wenn sich heute immer mehr Kinder und Jugendliche für das Thema Klima und den wohl menschengemachten Klimawandel interessieren, so hat sich ein Schriftsteller bereits vor einigen Jahren mit dem Morden an Afrikas Tierwelt beschäftigt und darüber geschrieben – für Kinder und Jugendliche:
Erstmals 1996 veröffentlichte Dietmar Beetz im Erika Klopp Verlag das Kinderbuch „Rhinos Reise“: Nino hat den Hubschrauber gehört. Auch die Schüsse. Wenig später sieht er die tote Nashornmutter. Neben ihr das Junge. Nino ist entschlossen, das Nashornkalb zu schützen. Und das Wunder geschieht: Rhino vertraut ihm. Aber was soll aus ihm werden? Allein kann er im Busch nicht überleben. Ist der märchenhafte Vorschlag die Lösung, Rhino auf eine weite Reise ins ferne Europa zu schicken – mit Nino als Begleiter? Hier ein Ausschnitt, der kurz nach dem Anfang des Buches spielt und der auch die jungen Leser mit einem grausamen Geschehen konfrontiert:
„Die Schüsse hörte auch Nino, ein zwölfjähriger Afrikaner vom Stamme der Tawana.
Er war seit der Frühe unterwegs. Mit ihm Vater und Mutter, seine vier Geschwister, drei Onkel, fünf Tanten und achtzehn Vettern und Basen. Sie hatten kurz vor Sonnenaufgang, als die Macht der bösen Geister schon gebrochen war, ihr Dorf verlassen, auf dem Kopf Bündel zusammengerollter Ledersäcke und leere Kalebassen. Die Männer trugen außerdem gewohnheitsmäßig ihre Waffen: Jagdmesser, Wurfspeere, Bogen und Köcher voller Pfeile. Onkel Yoyo hatte seine uralte Flinte dabei.
Im Dorf zurückgeblieben waren bloß die Alten und Gebrechlichen der Großfamilie. Selbst Bebe, Ninos jüngste Schwester, machte den Ausflug mit – bei Mutter im Tragetuch.
Es sollte nur eine kurze Reise werden, ein Abstecher ins Wildreservat jenseits des Ngori-Baches. Dorthin war gestern Abend, wie Onkel Yoyo auf einem Streifzug beobachtet haben wollte, ein Heuschreckenschwarm geflogen. Nun beabsichtigte die Sippe, sozusagen Heuschrecken zu ernten. Seit Regenzeit war, gab es zwar reichlich Kräuter und Knollen beim Dorf, auf den Feldern wuchsen Mais und Maniok, Bohnen, Bataten und Erdnüsse, und außerdem lief manchmal ein Perlhuhn oder gar eine Gazelle vor die Pfeilspitzen oder vor Yoyos Flinte. Heuschrecken aber, auf einem Blech über dem Feuer geröstet, waren und blieben ein Festtagsschmaus, eine höchst nahrhafte Delikatesse.
Vorausgesetzt, man fand einen Schwarm und scheute nicht die Mühe, die geflügelte Speise aufzuklauben und heimzuschleppen.
„Und du hast sie wirklich hier gesehen?“, erkundigte sich Vater bereits zum zweiten Mal.
„Ja doch!“, erwiderte Onkel Yoyo gekränkt. „Hier zwischen den Hügeln. Beim letzten Tageslicht.“
„Und es war ein Heuschreckenschwarm, nicht etwa eine Regenwolke?“
„Na, hör mal!“
Sie standen, Erwachsene und Kinder beieinander, am Fuße eines Hügels und blickten ein wenig ratlos in die Runde. Seit sie den Ngori-Bach, der zu einem Fluss angeschwollen war, durchwatet hatten, war die Sonne spürbar gestiegen. Und noch immer fand sich kein Hinweis auf einen Heuschreckenschwarm, der über Nacht gerastet hätte. Weder ein kahl gefressener Flecken noch irgendwelche Nachzügler aus der Millionenschar.
Weitersuchen oder umkehren, um vor der Mittagshitze nach Möglichkeit wieder daheim zu sein? Vielleicht hatte sich Yoyo geirrt. Außerdem war der Aufenthalt im Wildreservat eine gewagte Sache. Wie sollten sie dem Wildhüter beweisen, dass sie gar nicht die Absicht hatten zu jagen?
Nino sah, dass Vater – bei diesem Ausflug wie auch sonst im Dorf das Oberhaupt – zu überlegen schien, und in der Stille, die aufgekommen war, hörte er plötzlich ein Geräusch. Es klang wie Insektengebrumm, das sich rasch näherte und bald wieder entfernte.
Der Heuschreckenschwarm?
Auch Tante Yami nahm das offenbar an, doch Yoyo schüttelte den Kopf. „Ein Flugzeug“, sagte er. „Einer dieser verdammten Helikopter.“
„Von der Reservatsverwaltung?“, fragte Yami besorgt.
„Unsinn“, versetzte Yoyo. „Wahrscheinlich sind es Touristen.“
Und Vater fügte beruhigend, zugleich aber erbittert hinzu: „Irgendwelche Schmalnasen, Leute mit sehr viel Geld.“
Unterdessen war der Helikopter, den Nino auch unter dem Namen „Hubschrauber“ kannte, weder herangekommen noch davongeflogen. Er schien hinter den Hügeln zu kreisen oder hin und her zu tanzen, denn sein Lärm drang mal lauter, mal gedämpfter zu ihnen. Was dort wohl los war?
Die Kinder hatten während des Marsches miteinander gescherzt und dann wie Nino die Ohren gespitzt. Ein paar von ihnen schickten sich jetzt an, in Richtung des Helikoptergebrumms davonzuschleichen.
„Hiergeblieben!“, befahl Ninos Vater.
Onkel Yoyo setzte zu einem Widerspruch an, doch im nächsten Moment brach er ab und horchte wie alle anderen.
In die Helikoptergeräusche hatte sich härterer Lärm gemischt, ein Knattern, einmal, nun wieder.
„Schüsse“, stieß Vater hervor.
„Salven aus einer Maschinenpistole“, sagte Onkel Yoyo.
Niemand rührte sich. Alle lauschten.
Und dann war das Geknatter vorbei. Eine Weile hörte man noch das Lärmen des Helikopters, bis es – nach einem letzten Anschwellen – leiser wurde und schließlich verstummte.
Nino hatte sich mitsamt seinen Angehörigen in Bewegung gesetzt, zögernd erst, geduckt. Nun liefen sie, die Tragelasten, die sie während der Rast abgenommen hatten, wieder auf dem Kopf, entschlossen und rasch hügelauf und hügelab, Nino und einige seiner Vettern und Basen ein Stück voraus.
Auf einer Anhöhe stockten die Kinder. Vor ihnen in einer Senke – ein Tier, offenbar ein Nashorn. Und daneben ein zweites, kleines, das jetzt einen Laut ausstieß, einen jammervollen Schrei.“ Und damit zu ausführlicheren Vorstellungen der anderen Sonderangebote dieses Newsletters:
Erstmals 1985 veröffentlichte Otto Emersleben in der Reihe „Spannend erzählt“ des Verlags Neues Leben Berlin „Der Turm des Todes. Historische Abenteuererzählungen über drei Kontinente und die Weltmeere“: Mittelasien, Rom, Peru, Beringstraße – in drei Kontinenten und auf den Weltmeeren liegen die Schauplätze der zehn historischen Abenteuererzählungen dieses Bandes. Entdecker, Ketzer und sturmerprobte Kapitäne sind unter ihren Helden zu finden, die Verstrickungen von brutalem Machtstreben und der Sehnsucht nach einer besseren Welt ein immer wiederkehrendes Thema. Die Titelgeschichte erzählt vom gescheiterten Aufstand der Bewohner von Buchara unter Führung des frommen Handwerkers Machmud Tarabi gegen die mongolische Fremdherrschaft. Auch die Erzählungen um Giordano Bruno, die Weltumsegler Anson und Cook, um Sir Walter Raleigh, Semejka Deshnjow, Ulug Beg und all die anderen Kämpen sind an historische Figuren angelehnt. Doch wird nicht die Wiedergabe dessen angestrebt, was ohnehin in Geschichtsbüchern steht. Vielmehr ist der Ausgangsgedanke: wie hätte es sein können? Hier der Beginn der Titelgeschichte „Der Turm des Todes“:
„Glatt und drohend ragt der wuchtige Kegelstumpf des Kaljan-Minaretts in den mondhellen Nachthimmel, lässt die kantige Silhouette der Moschee unter sich im Schweigen des nächtlichen Buchara.
Achmed atmet stoßweise, so erschöpft ist er. Noch hundert Schritte vielleicht…
Dort hinter der Koranschule, zu der die Moschee gehört, liegt das Haus seines Onkels Omar, des Vorstehers der Schule. Er wird ihn aufnehmen und gut und sicher verstecken, denn niemand dort wird nach ihm, Achmed, suchen, Achmed, dem Kameltreiber, den die Wogen des Schicksals für kurze Zeit in ungeahnte Höhe gehoben haben und den sie jetzt wieder hinabstürzen — vielleicht ins Verderben, vielleicht an ein sicheres Ufer.
Achmed klammert sich an die Mauerkante. Er beugt sich vor und sieht um die Ecke. Nichts. Da hastet er weiter, springt eher, als dass er läuft, hält von neuem an, sichert.
Die Menschenleere, mit der die Nacht ihn umgibt, beunruhigt Achmed. Kein verspäteter Mullah auf dem Heimweg vom Abendgebet, kein Eselstreiber, keine eiligen Derwische. Niemand. So streng also ist die Ausgangssperre noch immer… Nur – warum ist er dann noch keiner der mongolischen Schildwachen begegnet? Unverständlich.
Seit Achmed heute kurz vor dem Schließen der Tore in die innere Stadt geschlüpft war – ein Moment Unaufmerksamkeit des kontrollierenden Postens, ein gewagter Sprung über eine Mauer -, hatte er sich in der Menge geborgen gefühlt, die über den Basar wogte wie früher – so als wären die letzten vier Wochen niemals gewesen, als hätte es keinen Aufstand gegeben und als wäre diese Stadt Buchara und das Land ringsum nie von einem Kalifen Machmud regiert worden, dem Siebflechter aus Tarab, und seinem Wesir Achmed, ihm, dem Kameltreiber.
Mit dem Einbruch der Dunkelheit waren die Menschen in ihren Häusern verschwunden, der Basar und bald darauf auch die Gassen hatten sich geleert. Es war eben in Buchara an diesem feuchtklammen Winterabend doch nicht so, wie es sonst immer gewesen war…
Noch liegt es keine Woche zurück, dass die Mongolen auf ihren kleinen, kurzbeinigen Pferden in großen Scharen zurückgekehrt sind in die Stadt und mit ihnen der Sadr und die anderen Würdenträger der islamischen Hierarchie. Kurz war der Traum gewesen von einem Leben ohne sie, den die Stadt geträumt hatte in den wenigen Tagen der Herrschaft des Kalifen Machmud Tarabi. Die Handwerker, die kleinen Händler und mit ihnen die Bauern in den Dörfern der Oasen ringsum haben ihn ausgeträumt, den Traum, den Hoffnungsrausch, sie sind – das sieht Achmed – unter dem Zwang der Ereignisse schon wieder zum nüchternen Alltag zurückgekehrt. Das Leben geht weiter, auch wenn es sich mit der untergehenden Sonne hinter Hofmauern und fensterlosen Lehmwänden verstecken muss.
Achmed versteht die Leute, die froh sind, noch einmal davongekommen zu sein, und die jetzt – als wäre nie etwas gewesen – weiterleben, wie sie vorher gelebt haben. Nur – und hier unterscheidet sich sein, Achmeds, Wunsch weiterzuleben von dem der Basarhändler und Bettelderwische – er kann nicht weiterleben, ohne dass auch sie ihn verstehn, ihn unterstützen, verstecken, ihm weiterhelfen. Denn hat er nicht in den wenigen Tagen, in denen Buchara sich aus der altgewohnten unterwürfigen Haltung erhob und aufstand, um sich auf eigene Beine zu stellen, sich für alle sichtbar von dem alten Achmed gelöst? Und musste es nicht allen – Freunden wie Feinden – wie eine Loslösung ohne Wiederkehr scheinen?
Er hastet weiter, an dem prachtvollen Portal der Koranschule vorbei, erreicht außer Atem das Haus seines Onkels Omar. Die Pforte ist zugesperrt, Achmed erklimmt mit größter Anstrengung die Mauer, die glatt ist und nur wenige leichte Lehmdellen aufweist.
Im Hof ist es still. Achmed ist froh, dass der weiche Lehmboden das Geräusch seines Aufsprungs verschluckt hat. Die Mauer des Nachbarhauses wirft einen undurchdringlichen Schatten, der Achmed anzieht, weil er Sicherheit bietet, jedenfalls für den Moment.
Er schrickt zusammen, als plötzlich Licht durch ein Fenster fällt, und dreht sich um. Er sieht den Onkel das Fenster öffnen und hört ihn in den Hof hinein fragen: „Ist dort jemand?“
Einen Atemzug lang bleibt Achmed stumm. Dann flüstert er fest und vernehmlich: „Ich bin es, Achmed. Ich bin allein und muss dich sprechen, Onkel. Schließ das Fenster und komm hierher in den Hof. Aber ohne Licht…“ Da wird das Fenster wieder dunkel.
Im mondhellen inneren Hof sieht Achmed schließlich die aufrechte Gestalt seines Onkels auftauchen, sieht ihn, den Vorsteher der Koranschule, im würdevollen Gewand, mit Turban und kantig gestutztem Bart, seinen gewaltigen Schatten hinter sich herziehend, und da hört er schon die vertraute Stimme des Onkels sagen: „Wo bist du, Achmed?“
Achmed tritt heraus aus seiner Ecke Dunkelheit. Als er Omar gegenübersteht, gewahrt er den gutmütigen Ausdruck, der stets auf diesem Gesicht gelegen hat, seit Achmed sich erinnern kann. „Ich komme, um dich zu bitten, Onkel…“
„Ich bin dein Onkel nicht mehr. Meines Bruders Sohn ist tot für mich, seit er die Demut vergaß und die Hingabe, die er Allah schuldet. Denn Allah allein gibt, und er nimmt auch allein, und es ist niemand, der dies ihm gleichtun könnte. Such dir einen anderen, der dich Neffe zu nennen bereit ist. Und jetzt verlasse mein Haus.“
Dann knarrt die Tür. Achmed ist wieder allein. Allein mit seiner geschwundenen Hoffnung und mit seinen Fragen. Er tritt zurück in den Schatten. Für Ratlosigkeit, das weiß er, ist jetzt keine Zeit. Und doch spürt er die Leere, die sein Dasein so plötzlich erstarren lässt und seine Entschlusskraft zu lähmen droht.“
Erstmals im Jahre 2000 erschien im Arena Verlag Würzburg der 1. Teil der Kinderbuchreihe „Die Haifischbande auf Zeitreise“ von Jan Flieger – „Schatzsuche auf der Totenkopfinsel“: Julia und Vanessa, Long Basti und Specki gehören zur Haifisch-Bande, die ihr Domizil in der alten Fischfabrik hat. Das Wahrzeichen ihrer Clique ist die Fahne mit dem Haifisch. Heute ist ihnen langweilig und daher gehen sie zu Old Krusemann, dem alten Seebären. Der besitzt eine geheimnisvolle Glaskugel, über die er allerdings nichts sagen will. Aber dann erfahren sie doch, dass diese Glaskugel das größte Geheimnis birgt, das Old Krusemann kennt. Das allergrößte. Die Glaskugel ist eine Zeitkugel, mit der man an jeden Ort und in jede Zeit reisen kann. Und auch wenn es Julia und Vanessa, Long Bast und Specki anfangs natürlich nicht glauben wollen, probieren sie es aus und begeben sich auf ihre erste Zeitreise zu den Piraten. Und dort erleben sie gefährliche Abenteuer … Begleiten wir die Kinder bei ihrem Besuch bei Old Krusemann, wo sie ein Geheimnis erfahren, das sie aber anfangs gar nicht so recht glauben können und wollen:
„Im Innern des Waggons sieht es aus wie in einer Schiffskajüte. Alte Steuerräder hängen an den Wänden und ein verwitterter Rettungsring mit der Aufschrift YH 127.SOUTH. Auf selbst gezimmerten Schränken stehen Schiffsmodelle und tolle Flaschenschiffe, ein Teleskop und ein vergilbtes Schiffstagebuch. Das ist Old Krusemanns altes Logbuch aus den Tagen, als er noch zur See gefahren ist. Eine Standuhr aus blau bemaltem Treibholz zeigt die Zeit an, denn Old Krusemann besitzt keine Armbanduhr. Eine Hängematte dient ihm als Bett. „Die ist gut für mein Kreuz“, behauptet er.
Auch Stühle und Regale bestehen aus bemaltem Treibholz. In einem kurzen Regal zwischen zwei Fenstern liegt eine geheimnisvolle große gläserne Kugel. Leider verrät Old Krusemann nie, wozu sie gut ist. Aber etwas Wichtiges muss es schon sein, denn er hütet die Kugel wie seinen Augapfel.
Der alte Seebär empfängt die vier im Waggon. Er blickt Vanessa freundlich an. „Na, min Deern!“
Vanessa verdreht genervt die Augen. „Ich bin Vanessa“, verbessert sie Old Krusemann. „Jaja, min Deern“, sagt er strahlend und nickt. Vanessa schweigt lieber. Old Krusemann muss man eben so nehmen, wie er ist. Er ändert sich nicht mehr. Nun redet er auch Julia mit „Na, min Deern“ an und Long Basti mit „Na, min Jong“. Aber Julia grinst nur und Long Basti zeigt keine Reaktion. Er will eben immer cool wirken. Und ein cooler Typ bleibt stets gelassen. Auch wenn man ihn komisch anredet.
Vanessa schlendert durch den Waggon und bleibt vor der Glaskugel stehen.
„Du hast uns nie gesagt, was mit der Kugel los ist“, stellt sie fest und blickt Old Krusemann an. „Du wolltest es aber mal sagen.“
„Hm – ja?“, macht Old Krusemann. Nachdenklich befühlt er seinen weißen Bart.
Vanessa will die Kugel anheben. Doch Old Krusemann ist sofort bei ihr, entreißt ihr die Kugel und presst sie an seine Brust.
„Finger weg!“, schimpft er los.
Die Kinder staunen. Noch nie haben sie Old Krusemann so böse gesehen. Was ist los mit ihm? Was ist los mit dieser Glaskugel? Warum dürfen sie sie nicht einmal anfassen?
Vanessa findet Old Krusemanns Verhalten einfach affig, superaffig sogar. Zu jedem anderen hätte sie mit Sicherheit laut gesagt: „Du hast wohl einen an der Waffel.“ Aber Old Krusemann möchte sie nicht beleidigen. Also schweigt sie lieber und kaut stattdessen auf ihren Fingernägeln herum. Das hilft, wenn man erregt ist, glaubt Vanessa.
„Ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig, Old Krusemann“, sagt Julia ruhig. „Und ich finde, dass du Vanessa nicht anschreien solltest.“
Old Krusemann muss sich setzen. Er stellt die schwere Glaskugel auf dem Tisch mit der Muschelplatte ab und wischt sich über die Stirn. „Ach, Kinder, ihr habt ja recht“, sagt er schließlich und seufzt tief. „Ich bin ein alter Dösbaddel, der alles falsch macht. Dabei habe ich schon oft überlegt, ob ich euch nicht von der Glaskugel erzählen soll. Aber ich habe mich einfach nicht getraut.“
„Warum denn nicht?“, entfährt es Vanessa.
„So ein Quatsch!“, meint Specki.
„Also, diese Glaskugel“, fängt Old Krusemann geheimnisvoll an und blickt Vanessa, Julia, Specki und Long Basti der Reihe nach tief in die Augen. „Diese Glaskugel birgt das größte Geheimnis, das ich kenne. Das allergrößte.“ Mucksmäuschenstill ist es im Waggon geworden.
„Ist doch bloß ’ne Glaskugel“, nörgelt Vanessa. „Langweilig hoch hundert.“
„Du nervst, Vanessa“, faucht Long Basti. „Hör lieber zu!“
„Hahaha“, macht Vanessa.
Julia starrt Old Krusemann mit angehaltenem Atem an. Auch Specki sagt kein Wort. Er knebelt den linken Daumen mit den Fingern der rechten Hand und zieht seine Baseballkappe tief in das Gesicht. Er denkt also wahnsinnig konzentriert nach.
Old Krusemann schmunzelt geheimnisvoll. „Weiter, Old Krusemann“, drängt Long Basti. „Kleine Mädchen muss man quatschen lassen.“
„Sehr witzig“, motzt Vanessa.
Old Krusemann streicht liebevoll über die Kugel. „Ihr seht vor euch eine Zeitkugel. Sie kann euch überall hinbringen. An jeden Ort. Sogar in eine andere Zeit. Man muss nur ein Foto oder Bild auf den Tisch legen, die Kugel darauf stellen und sie dreimal um die eigene Achse drehen. So einfach ist das.“
Specki blickt Old Krusemann misstrauisch an. Am liebsten würde er sagen: „Du hast wohl ’nen Sprung in der Schüssel, Old Krusemann!“ Aber er verkneift sich den Spruch.
Julia schüttelt den Kopf. „Das ist doch Seemannsgarn!“
Die Kinder lachen Old Krusemann aus. Sie wollen einfach nicht glauben, dass die Kugel Zauberkräfte besitzen soll. Nur Long Basti lacht nicht mit. Er weiß nicht, was er denken soll. Also sagt er vorsichtshalber gar nichts. Old Krusemann blickt Vanessa fest an. „Tja, min Deern, dann muss ich euch das wohl beweisen?“
Specki knebelt noch immer seinen Daumen. „Und wie soll das ablaufen?“
„Ihr bringt mir ein Bild von einem Ort, zu dem ihr hinwollt“, antwortet Old Krusemann. „Das Bild legen wir auf den Tisch mit der Muschelplatte. Genau in die Mitte. Dann stelle ich die Zeitkugel darauf. Ihr setzt euch um den Tisch herum, fasst euch an den Händen und bildet einen Kreis um die Kugel. Ihr schließt die Augen, ich drehe die Kugel und ab geht die Reise.“
Vanessa verdreht die Augen. „Find ich affig. So was gibt’s nicht.“
Old Krusemann droht ihr mit dem Finger. Aber er grinst dabei.
„Old Krusemann, willst du uns verkohlen?“, kommt es von Julia.
Aber Old Krusemann schüttelt entschieden den Kopf und hört auf zu lächeln.
Erstmals 1974 veröffentlichte Walter Kaufmann im Verlag der Nation Berlin „Am Kai der Hoffnung“: Obwohl dieses Buch vor nunmehr fast einem halben Jahrhundert erschienen ist, packen die darin versammelten Storys noch immer. Erzählt der Globetrotter Walter Kaufmann in ihnen doch von Schicksalen von Menschen, die ihre Liebe verteidigen wollen und die sich wehren müssen gegen eine nicht immer friedliche Natur und gegen eine oft unbarmherzige Umwelt. Berichte mitten aus dem Leben. So auch die erste Geschichte mit dem Titel „Ruf der Inseln“. Da geht es um den Seemann Keith Forrest, der Frau und Kinder in Sydney hat und zugleich eine Geliebte auf den Fidschi-Inseln – Caroline aus Suva. Und so beginnt die Story „Der Ruf der Inseln“:
„Sie war nicht wie die anderen Töchter der Fidschi-Inseln, nicht so redselig, ruhiger, zierlicher aber auch nicht so schön. Im Vergleich zu ihnen war sie mager, hatte eine viel dunklere, fast schwarze Haut, und ihr Gesicht war auf Stirn und Wangen von Blatternarben entstellt. Doch ihre Augen, die Augen ihrer Mutter, waren groß und leuchtend wie zwei stille Weiher in einer rauen Landschaft, und ihre Stimme, die Stimme ihres Vaters, war leise und sanft wie das Raunen des Windes in den Blättern der Palmen. Die Besatzung der „Rosa“ kannte Caroline aus Suva und wusste, dass sie dem Seemann Keith Forrest gehörte, der in Sydney Frau und zwei Kinder hatte.
Keith Forrest ging nach mittschiffs und klopfte an die Kajütentür.
„Herein!“, rief der Erste Offizier.
„Kann ich heut nachmittag freihaben, Mister?“
Der Offizier blickte auf, zögerte. „Meinetwegen“, antwortete er dann. „Seien Sie morgen früh zurück.“
„Es ist schwer, einem so guten Matrosen etwas abzuschlagen“, erklärte er dem Zweiten, als Forrest außer Hörweite war, „Außerdem …“ Er machte eine Eintragung in den Arbeitsplan und ließ das übrige, das allgemein bekannt war, unausgesprochen.
Keith Forrest zog das Hemd und die verdreckte Arbeitshose aus und duschte sich. Das Wasser war lauwarm und nicht erfrischend; den ganzen Vormittag über hatte die Tropensonne auf die Wassertanks herabgebrannt. Während er übers Deck zu seiner Kajüte ging, ließ er sich von der Seebrise trocknen und abkühlen. Aus seiner Seemannskiste nahm er ein frisches Hemd und eine saubere Drillichhose und kleidete sich langsam an. Er stieg, ohne ein Wort mit jemandem zu sprechen, die Gangway hinunter und lief den Kai entlang zu den Toren. Eingeborene Händler umringten ihn, sobald er heraustrat. „Schönes Armband für Mädchen, schöne Muscheln, schöne Kette …“
Sie hielten ihm die aufgereihten Muscheln lockend vors Gesicht, so nahe, dass Keith Forrest den Geruch ihrer dunklen Haut wahrnehmen konnte. Er blickte sich um. Und dann hörte er ihre sanfte Stimme – wie immer sprach sie seinen Namen falsch aus.
„Kei, o Kei!“
Der Matrose lächelte. Die Spannung in ihm löste sich, der suchende Ausdruck wich aus seinen Augen. „Caroline“, sagte er leise.
„Kei, o Kei !“
Das schienen die einzigen Worte zu sein, die sie kannte. Er berührte ihren Arm. Sie stand reglos, wie gebannt, nur ihre Augen umfassten ihn mit verzehrendem Feuer.
„Komm, Caroline!“
Hand in Hand schlenderten sie über den belebten Marktplatz. Ein Zollbeamter musterte sie scharf, spuckte aus und wandte sich ab. Die Einheimischen sahen ihnen nach, als sie hinter den Verkaufsständen verschwanden und den Weg entlanggingen, wo Palmen in langer Reihe den Strand säumten und das dahinter liegende Grashüttendorf abgrenzten.
„Sa tabu“, sagte ein Fidschi, „sa tabu, tabu …“
Keith Forrest war ein hochgewachsener, ruhiger, gut aussehender Mann, dem die Frauen nachschauten, doch er hielt sich von ihnen fern. Er war fünfunddreißig Jahre alt und zwanzig davon auf Schiffen um die Welt gefahren. Vor zehn Jahren hatte er in Sydney eine Verkäuferin geheiratet, hatte um ihretwillen als Decksmann auf einem Schlepper angemustert und von der Reling aus zugesehen, wie die großen Überseedampfer den Hafen verließen und an den Riffen vorbei Kurs aufs offene Meer nahmen. Ein ganzes Jahr lang war er tagtäglich, die Arbeitstasche unterm Arm, mit einer holpernden Straßenbahn zum Hafen gefahren, und ein ganzes Jahr lang hatten der Verkehrslärm, die Neonlichter, die fieberhafte Unrast des Großstadtgetriebes ebenso an seinen Nerven gezerrt wie das eintönige Leben in seinem Häuschen mit den Küchengerüchen und der rostigen Badewanne und dem großen eisernen Bett, in dem er mit Agnes schlief. Und als das Jahr um war, hatte er gesagt: „Ich such mir wieder ein Schiff.“
„Aber bei unserer Heirat hast du versprochen …“
„Ich hab’s versprochen, ich weiß“, hatte er erwidert. „Aber ich kann nicht anders, Agnes!“ Damit war er gegangen und hatte sich auf dem ersten Frachter anheuern lassen, der Mannschaft suchte.
Jetzt lag Keith Forrest in der kühlen Grashütte auf einer Matte und sah zu, wie die Brecher regelmäßig an den gelben Strand schlugen. Fein wie Spitze schimmerte der Schaum im Sonnenlicht. Zwei nackte Fischer, dunkelbraun vor dem hellen Sand, rannten lachend am Wasser entlang, die Speere zum Fischfang in den erhobenen Händen.
„Na-i-yai-ya-na-ei …“
Ihre Stimmen waren noch zu hören, als sie bereits außer Sichtweite waren. Einmal klang Lachen herüber, hell und triumphierend wie eine Glocke, und Keith Forrest sah im Geiste einen silbrig glänzenden Fisch am Speer zucken.
Er wandte sich zu Caroline: „Frau …“
„Kei, ja.“
„Komm her, ich will mit dir reden.“
Er redete zu ihr, die alles und nichts verstand, sprach von all den Dingen, die ihm im Kopf herumgingen: von Schiffen und Seeleuten, von Streiks und Schulden und Agnes‘ leerem Leben, von trostlosen Straßen mit dicht aneinandergezwängten Häusern, die sich nur durch ihre Nummern unterscheiden, vom Ruß, der von den Gaswerken kommt und in jede Spalte dringt, und von dem Husten, den sein Jüngster nicht los wird, weil das Haus immer feucht ist, besonders im Winter.
„Was hältst du von einem Mann, der seine Frau im Stich lässt?“, fragte er plötzlich. „Keinen Dreck wert, eh?“
Caroline versuchte aus seinem Gesicht zu lesen, was für eine Antwort er hören wollte. Schließlich schüttelte sie ganz leicht den Kopf.
„Du hässliches, pockennarbiges kleines Ding“, sagte er mit weicher Stimme. „Du glaubst nicht, dass ich sie verlassen habe, eh, vielleicht hast du recht.“
Für ihre Ohren war jedes seiner Worte eine Zärtlichkeit. Sie lachte leise, glücklich. Er zauste ihr hartes, krauses Haar. Sie presste die Brüste an ihn, schob die schmale braune Hand unter sein Hemd und streichelte ihn.“
Erstmals 1981 erschien im Verlag Neues Leben Berlin „Die Suche oder Die Abenteuer des Uwe Reuss. Erstes Buch“ von Wolfgang Schreyer: Hamburg, Frühjahr 1979. Uwe Reuss, als Chef einer Nordsee-Bohrinsel kürzlich entlassen, nimmt die Suche nach der Tochter seines besten Freundes auf: Gina Dahlmann ist mit einem verheirateten Grundstücksmakler angeblich nach Übersee geflogen und dort verschollen. Amateurdetektiv Reuss folgt der verwirrenden Spur; doch was treibt ihn an? Tut er all das nur den Dahlmanns zuliebe? Ist es Flucht aus dem Wartestand des Arbeitslosen oder der Reiz des Abenteuers, was den passionierten Sportsegler jetzt von Insel zu Insel weht? Oder steckt dahinter mehr, etwa der Wunsch, gänzlich auszusteigen? So schwierig diese Suche, so dunkel Reuss‘ wahres Motiv. Nur im Traum will es sich ihm enthüllen. Auf bizarren Umwegen endlich am Ziel, merkt Reuss, dass ihn, den Jäger, von den Gejagten wenig trennt. In der Weite des Ozeans und im Wagnis der Freiheit fühlt er sich den anderen und dem Sinn seines Lebens plötzlich nahe. Hier der Anfang des dritten Kapitels dieses spannenden Buches, in dem wir noch einiges mehr über den Helden und seinen Charakter erfahren – sowie über seine bevorzugte Lektüre:
„Die Ferne hatte Reuss schon immer gelockt. Soweit er zurückdenken konnte, zog es ihn an den Rand der Zivilisation. Bis zum Äquator war er auch gekommen. Früher, über all den Reiseberichten und Abenteuerromanen, hatte er gehofft, es möchte etwas von dem, das er selber unternahm, abenteuerlich verlaufen. Die Lust am Segeln, auch seine Nichtanpassung, die hingen damit wohl zusammen. Das große Fernweh! Der Ursprung blieb dunkel. Dahlmann stellte es als Teil des Nationalcharakters hin, wurzelnd in der Völkerwanderung. Heimatliebe und Wandertrieb, Ordnungssinn und Maßlosigkeit, Schwärmerei und Staatsräson des Deutschen – er liebte solche Gegensätze. Reuss aber hatten, noch ehe er lesen konnte, bunte Bilderfolgen begeistert: Seeräuber im Gelben Meer, ihre Beute, funkelnd im Licht der Sturmlaterne vor dem schwarz heraufziehenden Taifun; Goldsuche in den Anden, Überfall auf die Postkutsche, Strandung bei Kap Hoorn. Später der Trapper Lederstrumpf, Kara Ben Nemsi und der Musketier d’Artagnan.
Diese Geschichten waren ihm gefolgt; vielleicht brach er jetzt auf in das Reich seiner Tagträume? Jedenfalls, er musste sich zügeln. Gefragt war kein Detektiv, der losfuhr und zuschlug und Spesen machte auf Teufel komm ‚raus, sondern ein fleißiger Schnüffler und Rechner. Eine balancierte Persönlichkeit, wie es in seiner Branche hieß, mit Gaben, die sich auf ausgewogene Art widersprachen. Als Teamchef nämlich sollte man sesshaft und mobil, zupackend und taktvoll, einfallsreich und nüchtern sein. So wollte auch Dahlmann ihn haben – kein Platz für die rauen Burschen von einst.
Am besten fing er in Düsseldorf an, dem einzigen Fixpunkt der Suche; doch seine Reisetechnik schien verstaubt, durch das Pendeln zur Bohrinsel angerostet. Er scheute den Osterandrang auf der Bahn, zu spät für eine Platzkarte, das Auto also… Nur gingen Regenschauer nieder, verschmierten den Asphalt, vor seiner Stammtankstelle staute sich das Blech unter trommelnden Güssen. Bei der nächsten gab es kein Superbenzin, ein Tankwagen hatte irrtümlich Dieselkraftstoff in den Tank gepumpt. Die dritte war geschlossen, Beginn kalifornischer Zustände von Benzinmangel?
Es zog ihn zum Flugplatz, einfach weil er zur Arbeit immer flog. In der Maschine nach Düsseldorf sei noch etwas frei, hieß es am Telefon, falls er sich beeile. Beim Aussteigen in Fuhlsbüttel verdreckten ihm die Schuhe, unschön im Hinblick auf Frau Lersch. Nirgends in Hamburg war das Parken teurer, dabei schafften sie’s nicht, den Platz zu asphaltieren. Der Flughafen gab an mit seiner Citynähe und den vier Millionen Passagieren jährlich, um sie durch den Schmutz zu ziehen. Von Autos bespritzt, lief Reuss über die Straße, dann abseits des Zickzackwegs querbeet zur Abfertigung, auf dem schlammigen Trampelpfad.
Das Ticket lag bereit. Die Atempause an Bord reichte gerade für den Kaffee, einen Blick ins Notizbuch mit den drei Adressen und die Zeitung in der Sesseltasche: Iran, die Todesurteile. China, Ende der weichen Welle. Jimmy Carters Spar-Appell an die Nation, Energiefrage zum moralischen Äquivalent eines Krieges erhoben. Ölmultis warnen vor Staatseingriffen, Zwangslenkung stört Ölversorgung, entblößt die Nervenenden unserer Gesellschaft (das Land war gemeint, nicht Mobil oder Exxon).
Kaum stopfte Reuss das Blatt weg, da stieg die Maschine schon durch den Smog des Ruhrgebiets ab. Die Sonne schien, es war warm, der Flughafen ein Labyrinth. Reuss zog überschaubare Orte vor, wie den Flugplatz in Norwegen oder Port Harcourt in Nigeria, wo er nie eine Durchsage verstanden und sich, bis er heimisch wurde, den Leuten zugesellt hatte, denen dieselbe Bordkarte aus der Brusttasche sah. Sogar die Piste im Busch, beim Untergang Biafras, war menschlicher gewesen – mit ihren Leuchtkäfern, dem dürftigen Landelicht, das bis zum letzten Moment abgeschaltet blieb; in der klebrigen Schwüle, die Schuhe und Papiere schimmeln ließ, die Iroko-Bäume vor dem Nachthimmel Afrikas, der DC-4-Transporter mit hustenden Motoren, und über den Wolken das Pfeifen eines Abfangjägers der Regierung… Mehr Leben als in diesen Menschenströmen, gelenkt von Pfeilen und den internationalen Symbolen des Analphabetismus.
Die Telefone waren nicht schlechter versteckt als die Toiletten. Reuss hatte gestern schon angerufen und von einer Hausangestellten gehört, Frau Lersch werde daheim sein; jetzt aber meldete sich keiner. Vielleicht saß sie im Garten, zu weit weg vom Apparat? Er nahm ein Taxi, es brachte ihn nach Vogelsang, der Stadtrand im Dunst, nette graugrüne Gegend. Er ließ den Fahrer warten.
Das niedrige Haus mit der Rauputzfassade und dem geschnitzten Schild LERSCH am Jägerzaun enttäuschte Reuss: zu schlicht für einen Millionär, ein paar Nummern zu klein. Ein Mann im Grundstücksgeschäft mit kostspieligen Neigungen, Hochseejacht und Feriensitz im In- und Ausland begnügte sich mit einem Bungalow auf 600 Quadratmetern? Das Teuerste daran schienen die geschmiedeten Fenstergitter, sie schützten wohl Lerschs Kunstsammlung, falls es eine gab. Und wenn nicht – gerade als Spieler, als Lebemann hätte der nobler wohnen müssen. Dies passte nicht in das Bild, das Dahlmann da geliefert hatte.
Niemand öffnete. Beim zweiten Klingeln lugte jemand durch blühende Forsythien, ein Gesicht, das Neugier und Schwatzlust verriet. Der Nachbar teilte mit, Frau Lersch sei vorhin weggefahren, mit dem Sohn. Wohin? Entweder ins Grüne oder zu den Middendorfs. Reuss dankte, er stieg wieder ein. Der Name stand in seinen Notizen: ein Zahnarzt-Ehepaar, das ursprünglich mit von der Partie sein wollte, wie Dahlmanns Detektei erfahren hatte. Also zu den Middendorfs – über Vennhausen, irgendwo zwischen Ellerforst und Unterbacher See.“
Wie sich schnell herausstellt, werden die Ermittlung von Amateurdetektiv Uwe Reuss keineswegs einfach. Der Vorteil für den Leser ist jedoch, dass ihm Wolfgang Schreyer eine sehr spannende Geschichte serviert – und das nicht nur in einem Buch, sondern gleich in insgesamt drei Bänden mit den Abenteuern des Uwe Reuss.
Und wie schon eingangs des heutigen Newsletters festgestellt, lassen sich auch die vier anderen Sonderangebote wohl alle mit den beiden Begriffen abenteuerlich und spannend beschreiben, egal wann und wo sie spielen.
Viel Vergnügen beim Lesen, weiter einen schönen Herbst, bei dem ein Blick zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse nicht schaden kann, und bis demnächst.
EDITION digital war im Oktober 1994 ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden und kann somit auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ihr 25. Verlagsjubiläum feiern. Als erstes Produkt war 1994 eine CD-ROM über Mecklenburg-Vorpommern erschienen. Seit 2011 gibt EDITION digital auch E-Books (vorwiegend von ehemaligen DDR-Autoren) sowie Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, derzeit fast 1.000 Titel (Stand Oktober 2019).
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()