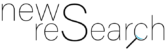Letzterer schickt in „Die Ruine der Raben“ drei Jungen auf eine Radpartie durch Irland. Keine große Sache, könnte man meinen. Aber es kommt anders. Und ein Mädchen spielt auch eine Rolle …
„Die Geister von Thorland“ lautet der Titel einer geradezu unglaublichen Geschichte von C.U. Wiesner.
Die spektakulären Erlebnisse einer jungen Kosmonautin stehen im Mittelpunkt des SF-Romans „Robinas Stunde null“ von Alexander Kröger.
Und gleich zwei Mal ist heute wie schon gesagt oder geschrieben Klaus Möckel hier vertreten – einmal gemeinsam mit seiner Frau Aljonna Möckel und einmal solo. Gemeinsam mit Aljonna Möckel hat Klaus Möckel insgesamt acht Bände ihrer erfolgreichen Nikolai-Bachnow-Reihe geschrieben. Diesmal steht Band 2 „Die Schlange mit den Bernsteinaugen“ zum Kauf. Der zweite Möckel-Titel ist eine märchenhafte Einladung ins Zauberland, zumindest in seinen Süden. Denn dort stand einst ein Schloss. Aber lesen Sie weiter unten weiter …
Soweit die aktuellen Sonderpreisangebote. Zum Normalpreis dagegen ist der aktuelle Beitrag der Rubrik Fridays for Future zu kaufen. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. Aus Anlass der 80. Wiederkehr des Beginns des von Hitler angezettelten Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 befasst sich der Fridays-for-Future-Titel mit dem Thema Krieg und Frieden: Wie und warum „entstehen“ eigentlich Kriege? Wie kann man sie verhindern? Und welche Auswirkungen haben Menschen im Krieg zu ertragen? Was gibt ihnen die Kraft, auch schrecklichsten Umständen zu wiederstehen? Eine besonders beeindruckende Antwort auf die letzte Frage liefert die letztlich erfolglose 900-tägige Blockade von Leningrad durch die deutsche Heeresgruppe Nord, finnische und spanische Truppen (Blaue Division) während des Zweiten Weltkrieges. Sie dauerte vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944. Ziel der von Hitler persönlich angeordneten, am Ende zweieinhalb Jahre dauernden Blockade, die zu den eklatantesten Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg gehört, war die Unterbrechung der Versorgung der nordrussischen Stadt und der grausame Hungertod ihrer rund 2,5 Millionen Einwohner. Tatsächlich stirbt mehr als eine Million Menschen. Beispielhaft waren und sind auf ewig Kampfesmut und Überlebenswille der Leningraderinnen und Leningrader, die damals natürlich auch mit dem Gedanken „Sa Stalinu“ – für Stalin widerstanden und starben, starben und widerstanden. Eindrucksvoll Zeugnis von dieser historischen Heldentat legt das 2017 als Eigenproduktion der EDITION digital sowohl als E-Book wie auch als gedruckte Ausgabe veröffentlichte Erinnerungsbuch „Das Wunder von Leningrad“ von Erwin Johannes Bach ab (Herausgegeben und mit einem Nachsatz sowie Kommentaren versehen von Aljonna und Klaus Möckel) – das völlig zurecht diesen Titel trägt: DAS WUNDER VON LENINGRAD, dieser Bericht eines Zeitzeugen, besticht durch große Bildhaftigkeit und Gedankentiefe. Erwin Johannes Bachs Leben verlief dramatisch, 1897 in Hildesheim geboren, verlor der spätere Komponist und Schriftsteller im Ersten Weltkrieg seinen Bruder – eine lebenslange Wunde -, musste auch selbst an die Front. Er studierte in verschiedenen Disziplinen, publizierte ein wichtiges musikwissenschaftliches Werk: „Die vollendete Klaviertechnik“, schuf vier Sinfonien, von denen drei durch Flucht und Krieg verlorengingen. 1934 mit seiner jungen Frau vor den Nationalsozialisten in die UdSSR geflohen, geriet er in die Stalinschen „Säuberungen“, erlebte Erniedrigung und Verbannung. Die Familie (drei Kinder wurden geboren) war zu einer Odyssee mit den Stationen Moskau, Odessa, Swerdlowsk im Ural, Tomsk in Sibirien, Taschkent in Usbekistan gezwungen. Bei Kriegsausbruch hatte es Bach nach Leningrad verschlagen, das schon bald einem der grausamsten Vernichtungsfeldzüge der deutschen Wehrmacht ausgesetzt war. Von dieser Blockade handelt der hier erstmals veröffentlichte Text, von den zerschossenen Häusern, den verhungernden, erfrierenden Menschen dieser einst so prächtigen Stadt. Und doch ist es keine Botschaft der Resignation oder gar Verzweiflung, denn Bach glaubte an die innere Kraft des Menschen. Ein Tschaikowski-Konzert im eisigen Winter 1941/42 wird ihm zum Beweis für Mut und Unbeugsamkeit gegenüber böswillig-mörderischer Zerstörung. Eine Botschaft, die durch ihre tiefen Wahrheiten überzeugt! Dieses Buch, das anlässlich des 120. Geburtstages von E. J. Bach erschien, ist ein Zeugnis menschlicher Standhaftigkeit in größter Not. Ergänzt wird der Text durch Artikel und Briefe über Leben und Werk dieses zu Unrecht vergessenen Künstlers. Herausgegeben wurde „Das Wunder von Leningrad“ von Aljonna Möckel, geb. Bach, eine Tochter des Verfassers, und Klaus Möckel. Aljonna Möckel ist eine bekannte Übersetzerin, die gemeinsam mit ihrem Mann auch schon schriftstellerisch tätig war. Klaus Möckel ist Autor zahlreicher Bücher verschiedener Genres (unter vielen, vielen anderen „Hoffnung für Dan“, „Die Gespielinnen des Königs“). Beide bemühen sich seit mehreren Jahren, das musikalische und literarische Erbe des Komponisten E. J. Bach dem Vergessen zu entreißen. Hier ein Auszug aus dem beeindruckenden Augenzeugenbericht:
„Die Russen sind ein strenges und verhaltenes Volk. Sie sind auch gütig. Sie machen nicht viel Wesens von ihrem Heldentum oder von ihren guten Eigenschaften. Die Russen haben es nicht gesagt, und in der Tat, die Zunge sträubt sich, es auszusprechen. Aber ich bin kein Russe: Dreißigtausend starben täglich in den schlimmsten Monaten, dreißigtausend in Leningrad allein am Hunger, nach den amtlichen Statistiken, nicht gerechnet der Toten durch Feindbeschuss, durch Bombardierung, der Toten an Erfrorenen, der in den Luftschutzkellern bei berstenden Wasserrohren Ertrunkenen.
Aber die Stadt kämpfte, sie kämpfte bis zum Äußersten, und weil sie bis zum Äußersten kämpfte, das Äußerste leistete, so wurde ihr das Äußerste erspart. Sie wurde gerettet, nein, sie rettete sich. Aber von diesem Wunder wollten wir nicht schreiben. Es ist uns hier nicht an dem gelegen, was historisch ist an Leningrad. Uns bewegt, was an Leningrad ewig ist. Leningrad hat nicht sich selbst gerettet, es hat die Menschheit gerettet, es hat den Menschen im Menschen zum Standbild erhoben für alle Zeiten. Leningrad zeigt uns den Menschen der neuen menschlichen Zeit, wie er sein wird, wenn unsere Urzeit und vormenschliche Zeit abgelaufen ist.
Gekämpft wurde auch bei Marathon und an den Thermopylen, gekämpft hat auch Madrid, dessen Kampf noch nicht beendet. Nicht dafür, d a s s die Stadt stand durch drei Jahre hindurch – dafür, w i e die Stadt stand, sei ihr ein Denkmal errichtet durch alle Zeiten. W i e hat Leningrad gekämpft? Was war es, das ihm die Kraft gab, und wie beschaffen waren Geist und Seele dieser Stadt? Was war ihr Ethos und welches ihr Antlitz in jenem beispiellosen Ringen? D a s ist das Wunder von Leningrad, von welchem gesprochen werden muss.
Aber wie lässt es sich in Worte fassen, dass es glaubhaft sei. Es lässt sich nicht anders ausdrücken: Für die Stadt existierte der Krieg nicht. Es gab einen geheimen Bezirk, ein Reservat der Seele in jedem Leningrader, in welchem der Krieg nichtexistent war. Das geistige Leningrad, ganz auf den Krieg eingestellt und umgestellt, ignorierte den Krieg. Das kulturelle und das schöpferische Leben dieser Stadt ging weiter, als gäbe es keinen Krieg. Der Geist Leningrads bemerkte nicht die dem Körper zugefügte Störung, oder er wollte von ihr nichts wissen. Er nahm sie nicht zur Kenntnis. Der Körper Leningrads schwand mit jedem Tag dahin, und der Geist Leningrads setzte sich über den Krieg hinweg. Die belagernden Landsknechte bekamen Kampfzulage, der Leningrader Kämpfer aus der Volkswehr sprengte unter Hungerrationen den Ring der Blockade.
Wie den Athenern alles, was von den Barbaren kam, suspekt war und außer der Diskussion stand, so war der Krieg für die Leningrader, mit allem an sie herangetragenen Grauen, eine Sache, die im Grunde genommen nicht da war. Ein Übel aus dummer und frevelhafter Hand, von dem man besser nicht Notiz nahm. Es war die stoische Lebenshaltung griechischer Philosophen verbunden mit der virtus der Römer, welche unter diesem Worte Tapferkeit und Tugend zugleich begriffen, ja nach welchem, wie zu verstehen sein mag, die Tapferkeit zugleich die Tugend schlechthin sei, Tapferkeit und Tugend als Synonym. Nicht die Bravour, nicht Kühnheit noch Wagemut, auch kein Siegfriedheldentum, sondern eine schöne und selbstverständliche Tugend, die Tapferkeit einer edlen und freien Menschenstirn. Allerdings eine Tapferkeit, vordemonstriert unter Bedingungen, wie sie die Menschheit noch nicht sah, eine Tapferkeit, beispiellos und beispielgebend, vorgelebt und richtungsweisend auf dem Wege, welcher aus der finsteren Vorzeit des Menschen hinaufweist.“
Und damit zu den ausführlicheren Präsentationen der aktuellen Fünf Sonderangebote. Beginnen wir mit einer ganz und gar unglaublichen Geschichte und einem unerhörten Vorfall, der sich noch zu DDR-Zeiten in der Ostsee zwischen der DDR und Dänemark ereignete.
Erstmals 1989 veröffentlichte C. U. Wiesner im Eulenspiegel-Verlag Berlin seinen Roman „Die Geister von Thorland“ – mit den Illustrationen von Bernd A. Chmura, der auch das Titelbild gestaltete: Anfang Juli 1985 brachten verschiedene Tageszeitungen folgende Meldung: „Dem Fährschiff Saßnitz, das an den Wochenenden zwischen Saßnitz (Rügen) und Rönne (Bornholm) verkehrt, fiel östlich des 14. Längengrades und südlich des 55. Breitengrades aus ungeklärten Gründen kurzzeitig die Radarortung aus: Die Radarantenne fuhr Karussell. Ebenso ungeklärt sind eine dichte Nebelwand bei strahlendem Sonnenschein und hohem Luftdruck sowie eine rätselhafte Wellenfront bei spiegelglatter See in der Höhe des Adlertiefs.“
Niemand wäre seinerzeit darauf gekommen, dass an dieser Stelle, mitten in der Ostsee, einst das nördlichste souveräne Herzogtum Thorland gelegen hatte. Es musste im Jahre 1885 untergehen wie einst die legendäre Stadt Vineta. Auch seine Bewohner hatten damals nicht gut getan. C. U. Wiesner erzählt die fesselnde und anrührende Geschichte vom Untergang und Wiederauftauchen Thorlands und fügt als Beweis einen reich bebilderten 32-seitigen Originalreiseführer des Herzogtums von 1885 bei. Aus diesem erfährt man u. a. von seltenen Tieren, die es nur auf dieser Insel gegeben hat, etwa dem Bockschwein, dem Feuerdingo oder dem Kurzschwänzigen Thorländischen Vielfraß. Bücher haben ihre Schicksale. „Die Geister von Thorland“ wollte der Eulenspiegel Verlag plangemäß im II. Quartal 1989 auf den Markt bringen. Dann aber verschlang der allerletzte Parteitag der SED soviel von dem ewig knappen Druckpapier, dass so manches Verlagsvorhaben zurückstehen musste. Vielleicht war das für die Sicherheit des Autors gut so, nicht jedoch für sein Werk, in dem er auf märchenhafte Weise den Fall der Mauer vorhersagte. Als es endlich in die Buchhandlungen gelangte, interessierte es jedoch niemanden mehr, denn knapp sechs Wochen vorher war tatsächlich die Mauer gefallen, und die DDR-Literatur war, wie man heute sagt, mega out. Nun aber hofft der Verfasser, dass sein Buch wie dermaleinst das kleine Inselreich Thorland eine Chance zum Wiederauftauchen bekommt. Hier nach allerlei Vorerläuterungen des vermeintlichen Herausgebers ein Auszug aus dem ersten Kapitel des eigentlichen Textes der, wie deren angeblicher Autor gleich im ersten Satz freimütig zugibt, schier unglaublichen Geschichte:
„Die Geister von Thorland
1. Kapitel
Ich erwarte nicht, dass man mir auch nur ein Wort meiner Geschichte glaubt. Wenn das wirklich mal an die Öffentlichkeit kommen sollte, gibt es keinen Klemens Klingsporn mehr. Gut so. Richtig so! Denn wenn es ihn noch gäbe, würde man ihn einen Lügenbaron heißen, schlimmer noch, einen Lügengenossen. Lügengenossen sind keine guten Genossen. Also ist es schon besser, es gibt sie nicht, so, wie ich, Klemens Klingsporn, aufgehört habe, als Klemens Klingsporn zu existieren. Dabei bin ich, der „aufgehörte“ Klemens Klingsporn, seit ich das erste Mal in meinem Leben einen Bleistift, einen Kugelschreiber, die Tastatur einer Schreibmaschine bedient habe, der Wahrheit noch nie so nahe gewesen wie diesmal.
Thore, Thore, lang mig din väldige hammer!
Junge, hör auf mit dem Selbstmitleid! Thore hilft nicht. Parduina hilft nicht! Corinna hilft nicht. Jytte kann nicht mehr helfen. Nur Beweise könnten es. Ich habe keine.
Es fing alles beinah genauso düster und langweilig an wie in diesen beliebten Partnergeschichten, die im Stadtbezirk Prenzlauer Berg spielen. Kinderwindeln, die Katze an den Müllkästen des sorgfältig rekonstruierten Hinterhofes, der arbeitsscheue versoffene Kerl und die um Selbstverwirklichung ringende Emanze mit Nickelbrille, mit der sie Volker Braun, Heiner Müller oder Christoph Hein liest. Na schön, das sollte ein Witz sein: Im Prinzip stimmt ’s schon, aber unsere Wohnung liegt nördlich vom Prenzlauer Berg und befindet sich in einem Neubau. Bei uns stinkts bloß nach Knoblauch und Letscho. Kinder haben wir nämlich nicht. Ich hätte schon ganz gern, von mir aus Vierlinge, schon wegen der Patenschaft. Aber Corinna will nicht. Ich kann ihr keine gesicherte Perspektive für eine Keimzelle der Gesellschaft bieten. Auch sonst stimmt so ziemlich nichts. Eine Katze hab ich bei uns noch nicht gesehen, bloß dicke fette Hunde, welche die Gehsteige und das bisschen Rasen – schöner unsere Städte, scheiß mit – für ihre Kreatürlichkeit (oder ist das Kreativität?) beanspruchen. Emanze – ebenfalls Quatsch. Corinna ist eine gepflegte Erscheinung, nach der sich alle Männer umdrehen. Nickelbrille? Von wegen. Wenn man die Vierzig hinter sich hat und trotzdem von den Studenten begafft werden will, darf man schon Haftschalen tragen. Tun zwar weh, die Dinger, (einmal hab ich im Bad aus Versehen eine zertreten), aber sie verleihen einem den absoluten Scharfblick auf unsere Literatur, auf die Literatur wohlgemerkt. Ich spar mir jetzt die Namen, nachher ist noch einer beleidigt, weil ich ihn ausgelassen habe. Obwohl ich mir nichts Komischeres wüsste als eine Beleidigungsklage gegen einen, den es amtlich nicht mehr gibt.
Was bleibt übrig vom Klischee? Der besoffene Kerl, ich, der damals noch real existierende Klemens Klingsporn.
Ach, Parduina, altes Mädchen, wenn du mich hören kannst, gib mir ein bisschen von deiner Weisheit! Mach mich gelassener und gerechter.
Es war ein ganz gewöhnlicher hässlicher Krach zwischen zwei Menschen, die wie Feuer und Wasser sind. Ein abgeschmacktes Bild? Ich weiß, wovon ich rede. Vor Jahren bin ich mal aus der Redaktion geflogen und kurzzeitig zur Bewährung in die Produktion gesteckt worden, genauer gesagt ins Gaswerk am Blockdammweg. Wenn wir den glühenden Koks aus den Öfen gestoßen hatten, wurde er in die Löschtürme gefahren. Unter den Wasserstrahlen schrie er förmlich auf. In den Dampfwolken stob der Teufel davon und hinterließ seinen Gestank von Pech und Schwefel.
Das Streiten war zwischen Corinna und mir schon fast zu einem Ritual geworden. Andere Leute spielten Canasta, Rommee oder Menschärgerdichnicht, wenn es im Fernsehen auf allen fünf Kanälen nur wieder mal Mist gab, wir spielten E und U, ein Spiel, in dem es am Ende keinen Sieger gab, sondern nur noch zwei Kaputte. Da diese Unterscheidung nur für Ästhetiker, Literaturwissenschaftler und Idioten von wirklichem Belang ist – Store Thore, hjaelp mig, ich werde schon wieder unsachlich! – sei der Blödsinn mal kurz für den gemeinen Mann erläutert.
E steht für Ernste oder Ernsthafte, U hingegen für Unterhaltende oder noch schlimmer für Unterhaltungskunst. Leider bleibt unser Kulturministerium da seit Jahrzehnten in den Ansätzen stecken. Konsequent wäre es doch gewesen, bei der Planung des neuen Berliner Stadtzentrums neben Nikolaiviertel und Palast der Republik, vielleicht zwischen Grandhotel und Schauspielhaus, gleich noch nach altteutschem Muster eine Walhalla oder nach französischem Exempel ein Pantheon der Unsterblichen der Nation zu projektieren: III. Klasse Gips, II. Klasse Marmor, I. Klasse Kupferbronze, gefördert von den dankbaren Kumpeln aus Mansfeld und Sangerhausen in Initiativschichten. Nun gut.
Die Amtsträger sind auch nur arme Teufel. Sie wissen nicht mehr, was gehaut und gestochen wird. Wie sonst konnten sie es wagen, den Rennsteigsänger, den Rinnsteinpoeten der Berge neben den Dichter mühseliger Ebenen zu setzen? Nun wieder sachlich.
Nein, sachlich waren wir beide nicht mehr an diesem Abend, weder Corinna noch ich. Wir fanden, wie üblich, nach einigen Umwegen zu unserm Standarddialog.
Sie: Merkst du nicht, wie du dich verplemperst? Wer auf die Mitte Vierzig zugeht, sollte dem Liedermacheralter entwachsen sein.
Ich: ‚Ich mein es doch nur gut mit dir‘, hast du vergessen. Is noch was drin in der Flasche, oder soll ich ’ne neue holen?
Sie: Jetzt gib mir auch ’n Schluck! Eine vernünftige, ernstzunehmende Sache, verstehst du? Dass man einmal sagt, der kann auch noch anders.
Ich: ‚Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.‘
Sie: Nimm dich doch mal ernst, verdammt noch mal. Du hast mal so gute Reportagen…
Ich: Ja, ja, erzähls mir zum Frühstück! Ich hab keinen Bock mehr auf grenzüberschreitenden Verkehr. Andere können auch nicht. Es stimmt, es kotzt mich an, aus dem Koffer zu leben und abends die paar Bunten zu zählen. Denn was kommt raus? Dass Schneewittchen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen genauso krumme Knie beim Kacken macht wie du auf deinem akademischen Lokus.
An dieser Stelle unserer rhetorischen Serenade angelangt, holte sich Corinna ihr Bettzeug aus dem Schrank und trug es ins Arbeitszimmer. In solchen Momenten bekam ich richtig Lust auf sie, aber ich wusste, es war zwecklos.
Weißt du eigentlich, rief ich und merkte, dass mir die Zunge schon nicht mehr gehorchen wollte, was die Abkürzungen U und E wirklich bedeuten? Keine Antwort aus dem Bad. U, schrie ich, heißt Unentbehrliche Kunst! Dann langte ich mir die Gitarre und sang (singen kann ich dann immer noch besser als sprechen):
E und U und U und E,
min Deern, di deit de Muschel weh?
U und E und E und U,
geff man din Muschel Ruh!
Ich sang noch eine paar schlimmere Verse, erntete aber keinen Applaus, obwohl ich mich kurzzeitig für den bedeutendsten Spielmann des Landes hielt.
Als mich Corinna am Morgen mit Kaffee und frischen Brötchen weckte, bemerkte sie eher freundlich als vorwurfsvoll: Wenigstens die Schuhe hättest du dir ausziehen können.“
Als Eigenproduktion der EDITION digital erschien 2014 „Lela Hundertschön, Krokodilkind und der schusslige Zauberer Prax“ von Klaus Möckel: Im schönen Land Prix, wo es noch Kobolde, Vampire und feuerspeiende Drachen gibt, lebt in einem kleinen Haus der Zauberer Tino Prax, ein lustiger Bursche mit langem Haar und großen Ohren. Da er in der Schule nicht richtig aufgepasst hat und überhaupt etwas schusslig ist, passiert es ihm oft, dass er beim Hexen etwas verwechselt. Zum Beispiel zaubert er Lela Hundertschön, die von ihm verehrt wird, Blumen in die Wohnung, die so große Büsche bilden, dass sie alle Zimmer ausfüllen. Lela muss immer wieder den Zauber-Reparaturdienst um Hilfe bitten, worüber sie sehr erzürnt ist. Sie will nichts mehr von Tino wissen und beginnt lieber ein Studium an der „Höheren Schule für Ahnenspuk“. Der Zauberer ist darüber sehr traurig, möchte gar nicht mehr leben. Doch dann beschließt er, sich einen kleinen Gefährten herbeizuhexen, einen sprechenden Hund. Aber wie vorauszusehen, bringt er wieder etwas durcheinander, und so sitzt ihm plötzlich ein kleines Krokodil gegenüber. Geschockt versucht er es loszuwerden, doch das kluge Tier hat etwas dagegen. Krokodilkind ist unternehmungslustig und erstaunlich gewitzt, sein „Papa“ möchte es schon bald nicht mehr missen. Dabei hat es die kleine Echse mit diesem Zauberer, der einen aus Versehen an die Decke klebt und sich selbst in einen Bottich hext, wirklich nicht leicht. Doch die beiden werden Freunde, und als Lela Hundertschön plötzlich verschwindet, ohne dass man weiß, weshalb und wohin, machen sie sich unverzüglich auf die Suche. Ein gefährliches Unterfangen beginnt, bei dem sie es mit wilden Hornissen, Riesenschlangen, Drachen und vor allem dem Meister aller Hexer, Wassilow Dongi, zu tun bekommen, der sich für den größten Magier im Lande Prix hält und für Lela ein schreckliches Schicksal vorgesehen hat. Doch die beiden finden auch Verbündete wie die gestrenge Schuldirektorin Tramora, die ihre ganz besonderen Gründe hat, gegen Dongi zu kämpfen, und sie wissen sich vor allem immer wieder selbst zu helfen. Spannende Abenteuer und eine Menge Überraschungen hält diese fantasievolle Geschichte für den Leser bereit. Mit dem schussligen Zauberer Prax und seinem schlagfertigen Freund Krokodilkind hat der Autor ein Gespann geschaffen, das Kindern wie Erwachsenen ans Herz wächst. Wir präsentieren das 3. Kapitel, in dem es um „Das Zauberbuch“ geht oder etwas genauer darum, was Tino, also Zauberer Prax, damit anstellt:
„Als Tino die losen Seiten eingesammelt, das Buch nach oben gebracht und es mit einem weichen Lappen vorsichtig gesäubert hatte, sah es wieder ganz ordentlich aus. Gewiss, die Schrift war hier und da verblasst, bei manchen Formeln fehlten Anfang oder Ende, doch ihm kam es im Moment ja nur auf ein einziges Kapitel an: auf die Anleitung zum Erschaffen eines sprechenden Vierbeiners. Er hoffte, dass die Ratte nicht gerade diese Seite zerfetzt hatte.
Mit Feuereifer begann Prax zu blättern. Am Anfang standen die einfachen Sachen: Wie man einen Rinderbraten auf den Tisch zaubert oder verschwinden lässt, wie man Feuer löscht, ohne Wasser, Sand oder eine Decke zur Hand zu haben, wie man eine Glühbirne ohne Strom zum Leuchten bringt. Schwieriger war es da schon, sich in ein Rad, einen Tisch oder eine Sitzgelegenheit zu verwandeln.
Tino erinnerte sich an eine Schulstunde, in der sie das geübt hatten, und musste plötzlich lachen. Wie lange war das nun schon her! Sie hatten die Aufgabe: „Werde zum Stuhl“ nicht richtig ernst genommen, deshalb hatte es bei keinem geklappt. Außer bei Korintus, ihrem Klassenersten, einem ziemlichen Streber. Der hatte sich in verschiedene Sessel verwandelt, und, um es ihnen zu zeigen, in der großen Pause gleich noch eins draufgesetzt. Da stand er plötzlich als ein prächtiger Fürstenstuhl vor ihnen, mit vergoldeter Lehne und zierlich gedrechselten Beinen. Er wollte zeigen, wie viel Fantasie er besaß.
Das Schönste aber: Er hatte den wichtigen Spruch für die Rückverwandlung vergessen – was für ein Gaudi! Zu zweit und zu dritt hatten sie sich auf ihn gesetzt, so dass er unter der Last fast zusammengebrochen war. Natürlich hatten sie ihm die Formel nicht verraten, sondern ihn anstelle des üblichen Stuhls hinters Lehrerpult geschoben. Der Lehrer der nächsten Stunde aber, ein zerstreuter alter Herr mit Namen Barnabil, merkte das nicht. Er ließ sich nieder und erzählte mit großen Gesten von der Hexenkunst der Vorfahren.
Irgendwann fiel Korintus die vertrackte Formal dann doch noch ein, und als sich der Lehrer einmal von seinem Sitz erhob, wurde er schnell wieder er selbst, schlich geduckt zu seinem Platz zurück. Barnabil aber setzte sich polternd auf den Hintern, und all das geschah so überraschend, dass die ganze Klasse in Lachen ausbrach.
Barnabil glaubte, Korintus habe ihm einen Streich spielen wollen, und verdonnerte ihn zu fünfzigmaligem Abschreiben der Abhandlung „Wie man aus einem Königssohn einen Frosch macht“. Zwei Stunden quälte sich der Angeber damit ab.
Aus einem Königssohn einen Frosch, dachte Prax jetzt, das ist immerhin ein Hinweis. Warum nicht statt diesem Kaltblüter einen sprechenden Hund herbeizaubern. Aber wo sollte er einen Königssohn hernehmen. Allzu viele davon gab es im Land nicht.
Er blätterte weiter, und die Aufgaben wurden verzwickter. Durch ein verschlossenes Tor gehen, ohne sich zu verletzen und ohne Spuren zu hinterlassen. Über Wasser schreiten, ohne die Schuhe nass zu machen. Mit einem Flugring auf zweihundert Meter Höhe steigen. Einen Schatz finden, der am Grund eines unbekannten Gewässers liegt.
Einen Schatz hätte Tino Prax gern gefunden, ganz gleich, ob das Gewässer bekannt war oder nicht. Aber dazu waren unendlich viele Vorbereitungen zu treffen und genaue Regeln einzuhalten, wofür ihm im Augenblick die Zeit fehlte. Nein, Zaubern war wirklich keine einfache Sache!
Prax schlug einige Seiten um und stieß auf ein in kräftigen Farben gemaltes Bild. Ein kleines Mädchen kniete auf einer Wiese und hielt drei Pflanzen in der Hand. Eine davon kannte der Zauberer, es war Sauerampfer. Eine zweite mit langen schmalen Blättern konnte Spitzwegerich sein – als Kind hatte er der Mutter welchen für den Salat gebracht. Die dritte hatte gelbe Blüten und kleine runde Blätter, er glaubte sie noch nie gesehen zu haben.
Es war ein bewegtes Bild, wie man sie bei Werbungen im Fernsehen findet. Plötzlich zerrieb das Mädchen die Pflanzen über einer Schüssel mit dampfendem Wasser, und ein kurzer Zauberspruch wurde sichtbar: „Oreni Reni Noreni Dux, werde zum Luchs!“ Das Mädchen schwang einen Stab, und ein Vierbeiner mit großen spitzen Ohren und schönem gefleckten Fell sprang aus der Schüssel. Das ist dann wohl ein Luchs, dachte Tino, der sich bei solchen Wildtieren nicht auskannte. Er begann die Erläuterung zu studieren, die unter dem Bild stand.
„Willst du ein Wesen erschaffen, mit vier, sechs oder acht Beinen, mit scharfen Zähnen oder einem Horn, schlank oder gedrungen, mit Fell oder glänzender Haut, dann suche diese drei Kräuter. Doch achte darauf, dass es bei abnehmendem Mond geschieht! Sprich die Formel, die im siebzehnten Kapitel verborgen ist, und schwinge den Stab. Aber wiederum Achtung, denn dem Tier muss das Zeichen entsprechen, das du im Kapitel siebenundzwanzig entdeckst.“
Tino kratzte sich den Kopf – das war wirklich kompliziert. Erst das siebzehnte und dann das siebenundzwanzigste Kapitel! Sehr geheimnisvoll das Ganze!
Zwei Tage und drei Nächte brauchte Prax, um die Formel und die jeweiligen Tierzeichen zu finden: Es gab eins für jede Gattung, für Pferde, Schweine, Rehe, Hasen. Er studierte und studierte, ein Durcheinander von Worten und Bildern, das er lange Zeit nicht entschlüsseln konnte. Zum Glück hatte die Ratte hier nur die Ecken abgenagt. Erst als er, vom vielen Grübeln und Kombinieren schon wirr im Kopf, auf die Idee kam, mit dem Zauberstab über die Seiten zu streichen, formierten sich die Buchstaben und ergaben einen Sinn:
„Lehm aus dem Graben,
Dreifach Arznein,
Schreibe mit Blut
Das Zeichen hinein.
Feuer und Wasser,
Sag deinen Spruch,
Im Morgennebel
Wag den Versuch.“
Der Spruch selbst lautete: „Assem, Axedem, sollst dich erheben aus totem Erdreich zu wachem Leben“.
Der Zauberer ging ans Werk. Er holte Lehm aus dem Graben hinterm Haus, stellte die größte Schüssel auf den Herd, die er in der Küche fand, füllte sie mit Wasser. Er legte einen großen Klumpen Lehm bereit, suchte bei abnehmendem Mond auf der Wiese Spitzwegerich und Sauerampfer. Doch dann gab es Probleme. Er hatte Schwierigkeiten, die dritte Pflanze zu finden, die im Buch abgebildet war, die mit den gelben Blüten. Er brauchte wiederum Stunden, um sie an einer sumpfigen Stelle nahe des Teiches zu entdecken. Wenigstens hoffte er, dass es die richtige war.
Zum Glück war Herbst, so dass morgens vorm Fenster der Nebel wallte. Als Tino alles bereit hatte, wurde er plötzlich nervös. Er bekam nachts kein Auge zu, stand lange vor Morgengrauen auf. Und genau da fiel ihm ein, dass er ja das Wichtigste vergessen hatte. Sein Hündchen sollte doch sprechen können! Davon aber hatte in der Anleitung kein Wort gestanden.
In fliegender Hast schlug Prax erneut das Zauberbuch auf, denn er durfte nicht warten, bis der sich Nebel verzogen hatte. Tatsächlich, kein Hinweis, wie dem zum Leben erweckten Wesen die menschliche Sprache vermittelt werden konnte. Erst an einer ganz anderen Stelle des Werks fand er in der Rubrik „Besonderheiten“ die Bemerkung:
„Willst du aber, dass ein Vierbeiner, ein Vogel oder ein Lurch redet, als wäre er deinesgleichen, so verdopple das Zeichen und wiederhole den Spruch. Aber sei sorgsam in deinen Ausführungen.“
Das werde ich, dachte Tino erleichtert, und schürte das Feuer im Ofen. Das Wasser in der Schüssel begann zu dampfen, es wurde Zeit, den Lehmklumpen hineinzuwerfen.
Zunächst aber musste er sich in den Finger schneiden, um etwas Blut zu erhalten. Klar, dass ihn das große Überwindung kostete, wer tut sich schon gern selbst weh. Schließlich griff er dennoch beherzt zum Messer und drückte die Schneide ins Fleisch. Der Schmerz trieb ihm Tränen in die Augen, doch zugleich trat ein dicker Tropfen aus der Wunde.
Mit der blutigen Messerspitze ritzte Prax zweimal das Zeichen für Hund in den Lehmklumpen, ein großes H mit einer Schleife unten. In seiner Aufregung verhedderte er sich jedoch, so dass aus dem zweiten H eine Art K wurde, was er freilich nicht merkte. Er bestreute den Lehmklumpen mit den Kräutern und warf ihn ins kochende Wasser. Dann schwang er seinen prächtigen Zauberstab: „Assem, Axedem, sollst dich erheben, aus totem Erdreich zu wachem Leben!“ Diese Worte wiederholte er, ganz wie es im Buch verlangt wurde.
Das Wasser brodelte und zischte, eine gewaltige Dampfwolke stieg zur Decke, sonst aber geschah nichts. Eine ganze Weile jedenfalls. Bis auf einmal mit einem Knall die Schüssel vom Herd sprang und scheppernd durch die Stube rollte. Auf dem Boden aber, in einer Pfütze, lag ein grünliches kleines Ding mit spitzer Schnauze, schuppigem Schwanz und vier zur Seite gespreizten Pfoten.
„Das … das ist kein … k…kein Hund“, stotterte Tino überrascht.
Die Spitzschnauze hob sich vom Boden. „Natürlich bin ich kein Hund“, sagte sie.
„Und wer bist du dann?“
„Krokodilkind.“
„Krokodilkind?“
„Was sonst? Das sieht man doch.“ Das grüne Ding richtete den Oberkörper auf, indem es sich auf die Vorderbeine stützte, und schaute sich neugierig im Raum um.
„Dich will ich nicht!“ Prax hatte sich etwas von seinem Schrecken erholt und griff zum Zauberstab.
„Und warum hast du mich dann herbeigeholt?“
„Offenbar ist mir da ein Fehler unterlaufen. Ich wollte einen Hund. Diesen Fehler werde ich jetzt korrigieren.“
Das Krokodilkind schien ein Stück gewachsen. Es richtete den Oberkörper noch weiter auf und sah Tino durchdringend an: „Auf meine Kosten! Das nenne ich eine feine Moral.“
Wider Willen fühlte sich der Zauberer von diesem Argument berührt. „Du willst mir ein schlechtes Gewissen machen.“
Die kleine Echse schwieg.“
Erstmals 1997 erschien bei der LeiV Buchhandels- und Verlagsanstalt Leipzig als Band 2 ihrer Nikolai-Bachnow-Bücher „Die Schlange mit den Bernsteinaugen“ von Aljonna und Klaus Möckel – damals allerdings noch unter dem russisch klingenden Pseudonym „Nikolai Bachnow“: Im Süden des Zauberlandes befindet sich ein Schloss, das einst der Hexe Bastinda gehörte. Doch Bastinda ist tot und das Schloss verfallen. Nach einem langen, heißen Sommer, in dem alle Bäche versiegten, entzündet sich das Gras im Hof, und von dem früher prächtigen Palast bleibt nur noch Glut und Asche. Aus der Asche aber kriecht die schöne und hinterlistige Schlange Lelia hervor, eine Kreatur Bastindas, und auch der Schatten der Hexe bekommt durch die Glut neues Leben eingehaucht. Im Zauberland geht inzwischen alles seinen friedlichen Gang, niemand ahnt etwas von diesen Geschehnissen. Bastindas Schatten jedoch sinnt auf Rache. Sein Ziel ist es, mit Hilfe der Schlange dem Weisen Scheuch sein Nadelgehirn, dem Löwen seinen Mut und dem Holzfäller sein mitfühlendes Herz zu rauben. Ahnungslos tappen der Herrscher der Smaragdenstadt und seine Freunde in die Falle. Aber da gibt es ja noch Prinzessin Betty – die Frau des Scheuch -, das mutige Mädchen Jessica, den Elefanten Dickhaut und nicht zuletzt Larry Katzenschreck, den blitzgescheiten Mäuserich, der sich auch mit Schlangen auskennt …
Mit seinen vielfältigen Abenteuern, seinen Überraschungen und dem immer wieder aufblitzenden Humor fügt sich dieser zweite Band der neuen Reihe nahtlos in die fantastische Geschichte des berühmten Märchenreiches ein. Dieses Buch, vor nunmehr fast einem Vierteljahrhundert mit Illustrationen von Hans-Eberhard Ernst unter dem Pseudonym „Nikolai Bachnow“ erschienen, ist das zweite von mehreren Büchern, die an die bekannte Reihe des Russen Alexander Wolkow anschließen. „Endlich befindet man sich wieder in Gefilden, die nicht mehr futuristisch oder abstrakt anmuten“, hieß es damals in einer Rezension der Literaturkritikerin Karolin Kullmann. Hier ein Auszug, der kurz nach dem Anfang des Buches zu finden ist:
„Erster Teil: Bastindas Schatten
Die Geburt der Schlange
Im Süden des Zauberlandes, dort wo alle Wege enden und schroffe Berge die Steppe begrenzen, erhob sich ein verfallenes Schloss. Das Dach war zum größten Teil abgedeckt, der Wind heulte in den geborstenen Schornsteinen und Regen floss durch die Fensterhöhlen. In einst prunkvollen Sälen wucherte Unkraut und die Mäuse tanzten auf morschen, wurmzerfressenen Möbeln.
Nach einem langen heißen Sommer, in dem die Pflanzen vertrockneten und alle Bäche versiegten, entzündete sich das Gras im Hof. Die Flammen griffen erst auf die Ställe und dann auf das ganze Gebäude über. Sie fraßen sich zu den Kellerräumen hinab und hinauf ins Dachgebälk. Am Ende war von dem einst so stolzen Bauwerk fast nichts mehr geblieben.
Danach breitete sich ringsum große Stille und Ödnis aus. Plötzlich jedoch regte sich etwas, bewegte sich in einem Winkel genau an jener Stelle, wo früher die Küche gewesen war. Es knisterte und knackte in der Erde, der Boden wölbte sich, riss mit lautem Knall auf und ein runder Kopf kam zum Vorschein. Er hatte die Größe dreier Fäuste und war von herrlich schimmerndem Blau. Zwei kleine bernsteingelbe Augen musterten die trostlose Umgebung und eine schmale spitze Zunge schoss aus einem breiten Maul, als wollte sie den Geschmack der Asche prüfen.
„Wer bin ich, und was soll ich hier?“, fragte der Kopf, offenbar in der Hoffnung, von jemandem Antwort zu bekommen. Er schob sich weiter aus der Erde und ein langer silbriger Leib wurde sichtbar. Es handelte sich eindeutig um eine Schlange.
„Du bist Lelia, meine Kreatur“, ertönte es von der rußigen Küchenwand her. „Erschaffen, um nach Jahren der Ohnmacht meinen Tod zu rächen. Du bist schön und hinterlistig.“
„Schön bin ich wirklich“, die Schlange betrachtete sich in einer Spiegelscherbe, die am Boden lag und die sie blitzschnell mit der Zunge blank geleckt hatte. „Und wer bist du?“
„Bastinda, die Hexe und Zauberin, die einst das Violette Land beherrscht hat. Ein kleines, lächerlich einfältiges Mädchen namens Elli hat mich seinerzeit mit Wasser übergossen, sodass ich sterben musste. Das Feuer aber hat mich wieder erweckt, das heißt, leider nur meinen Schatten. Immerhin war dieser Schatten mit seiner Zauberkraft stark genug, dich entstehen zu lassen, damit du meine Befehle ausführst.“
„Aber ich kann dich weder sehen noch riechen“, wandte die Schlange ein.
„Das brauchst du auch nicht, es genügt, wenn du mich hörst. Obwohl du meine Umrisse eigentlich erkennen müsstest, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Schau nur hierher, auf diese Mauer.“
Die Schlange wandte ihre Augen der Mauer zu, sie sah eine flirrende, leicht gekrümmte Gestalt.
„Du flirrst und glitzerst“, stellte sie fest, „trotzdem bist du hässlich.“
„Ich bin hässlich und böse“, gab der Schatten zu, „das ist meine Natur. Aber das soll dich nicht kümmern.“
„Es kümmert mich nicht.“
„Umso besser. Dann will ich dir jetzt meine Geschichte erzählen. Wie gesagt, einst war ich Herrscherin in diesem Land, und die Zwinkerer, dumme kleine Menschen, die ständig mit den Augen blinzelten, waren meine Untertanen. Sie dienten mir, haben Kröten, Spinnen und Blutegel für mich gefangen, aus denen ich meine Zaubertränke braute. Auch Schlangen und …“
„Schlangen?“, unterbrach Lelia sie.
„Ja, Schlangen“, erwiderte der Schatten ungerührt, „euer Gift kam mir sehr gelegen. Aber das brauchst du nicht krummzunehmen, diese herrlichen Zeiten sind sowieso vorbei.“
„Wo sind die Zwinkerer jetzt?“, wollte Lelia wissen.
„Keine Ahnung. Ich war ja gewissermaßen abwesend. Mein Gefühl sagt mir allerdings, dass sie in der Nähe sind. Mein Gefühl sagt mir so manches.“
„Was geht das mich an? Sollen die Zwinkerer bleiben, wo sie sind.“ Die Schlange zeigte sich plötzlich bockig.
Der Schatten Bastindas glitt auf Lelia zu.
„Du ärgerst dich, weil ich die Köpfe deiner Artgenossen in meinen großen Kochkessel geworfen und ausgepresst habe wie Zitronen, stimmt’s? Aber das hilft dir nicht. Du musst mir trotzdem gehorchen!“
Urplötzlich begann Lelia zu zischen. Ihr Kopf schnellte nach vorn, und sie versuchte die flirrende Gestalt zu beißen. Doch ihr Maul schnappte ins Leere.
Ein kicherndes Lachen ertönte:
„Du dummes Geschöpf, gegen mich kannst du nichts ausrichten. Also sei nicht so empfindlich. Wende deinen Zorn lieber gegen unsere wahren Feinde, die uns daran hindern, stark und mächtig zu werden. Sie sind es, die wir vernichten müssen.“
„Wer sind unsere wahren Feinde?“, fragte die Schlange etwas besänftigt. „Diese Elli?“
Bastindas Schatten krümmte sich, ihre Stimme war ein wütendes Krächzen.
„Sie war ein widerwärtiges Kind und viele Jahre sind seither vergangen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich noch im Zauberland aufhält. Aber es gab seinerzeit einen eisernen Kerl, der meine treuen Wölfe erschlagen hat, eine Strohpuppe, die meinen raubgierigen Krähen die Köpfe abriss, und einen Löwen, der mich fressen wollte. Das sind unsere Feinde. Die musst du aufspüren und zur Strecke bringen. Verstehst du?“
„Ja, ja, ich verstehe. Wenn ich auch nicht weiß, was deine Wölfe und deine Krähen mit mir zu tun haben.“
„Sie dienten mir damals, wie du mir jetzt dienen wirst. Und sie hatten ihren Vorteil davon. Wir waren sehr mächtig. Im ganzen Zauberland fürchtete man uns.“
Die Schlange Lelia, gerade erst geboren, wusste mit den Worten Vorteil und Macht noch nicht viel anzufangen.
„Und wo soll ich diesen Eisenmann, die Strohpuppe und den Löwen finden?“, fragte sie.
„Das weiß ich im Augenblick noch nicht“, erwiderte der Schatten. „Am besten, du kriechst hinaus in die Ebene und suchst die Dörfer der Zwinkerer auf, die es gewiss noch gibt. Dort erfährst du es bestimmt. Ich werde mich gleichfalls umtun, als Schatten gleite ich schnell von Ort zu Ort.“
Die Schlange schwieg einen Moment.
„Wollen wir uns hier wieder treffen?“, erkundigte sie sich schließlich. „Soll ich auf dich warten, wenn ich etwas in Erfahrung gebracht habe?“
„Das brauchst du nicht, Schätzchen“, krächzte der Schatten. „Keine Angst, ich werde dich zu finden wissen, wann und wo es mir gefällt.“´
Erstmals 2004 veröffentlichte Alexander Kröger im Eigenverlag KRÖGER-Vertrieb Cottbus als 2. Teil seiner Geschichten um Robina Crux „Robinas Stunde null“: Vagabundierende Raumfahrer erlösen Robina aus jahrzehntelanger Einsamkeit auf dem Kristallboliden. Doch sie begegnen ihr distanziert. Während der Reise zu einem lebensfreundlichen Planeten erfährt Robina vom abscheulichen Tun der Fremden. Robina kehrt nach Jahren zurück, aber wie findet sie ihre Erde vor! (siehe dazu „Der erste Versuch“ von Alexander Kröger) Doch hoffnungsvoll gesellt sie sich zu jenen, die einen Neubeginn wagen.
Der erste der zweiteiligen Robina-Crux-Serie von Alexander Kröger war unter dem Titel „Die Kristallwelt der Robina Crux“ erstmals 1977 als Band 137 der Reihe „Spannend erzählt“ des Verlages Neues Leben erschienen. Dem ebenfalls bei der EDITION digital veröffentlichten E-Book liegt die überarbeitete Auflage zugrunde, die Alexander Kröger ebenfalls 2004 im Eigenverlag KRÖGER-Vertrieb Cottbus herausgebracht hatte. Darin erfahren die schockierte Leserin und der schockierte Leser, durch welche Umstände die Heldin in ihr unfreiwilliges Exil gelangt war: Wie ein gewaltiger Spiegel ragt plötzlich die Fläche eines Riesenkristalls vor Robina auf. Und obwohl die junge Kosmonautin das Höhenruder zurückreißt, folgt nur Bruchteile von Sekunden später ein schmetternder Aufprall. Das Beiboot ist auf jenem geheimnisvollen Kristallboliden havariert, den die Besatzung der REAKTOM auf der Heimreise zur Erde entdeckt hat. Bestürzt sucht Robina Kontakt zum Raumschiff, um die Bergung zu veranlassen, doch die Funksignale bleiben ohne Antwort. Etwas Unfassbares ist geschehen. Die REAKTOM ist verschwunden, und Kernstrahlung deutet auf eine Katastrophe. Niemand wird Robina retten können; sie ist allein in dieser unwirtlichen Kristallwelt, viele Lichtjahre von der Erde entfernt. Tiefe Verzweiflung ergreift die junge Kosmonautin, der nur ein Hoffnungsschimmer bleibt: Da ist jenes fremde Funkfeuer, dessen kalte Lumineszenz den Boliden in rhythmischem Abstand aus der Schwärze des Alls reißt. Doch jetzt gibt es endlich Hoffnung:
„1. Teil
2. Kapitel
Robina stand mit gebreiteten Armen auf dem gläsernen See und starrte ins Firmament. Später hätte sie nicht zu sagen vermocht, was in diesem Augenblick in ihr vorging. Wie in Trance nahm sie überdeutlich die kleinen pulsierenden Lichtpunkte wahr, drei kurz, drei lang, drei kurz, die in ihr wie blendend strahlende Leuchtkugeln flammten. Gedankenleer murmelte sie wieder und wieder: „Sie kommen …“
Dann stand das Signal im Zenit. Robina achtete nicht auf die Schmerzen im überdehnten Nacken. Mechanisch drehte sie sich, den Blick starr mit den blinkenden Punkten verhaftet, bis die Rotation des Boliden diese hinter dem Kristallmassiv über der Grotte verschluckte.
Erst jetzt wich der ungeheure Druck von der Frau, setzte das Denken wieder ein. „Sie kommen“, flüsterte sie erneut. Tränen stürzten über ihre Wangen. Wie in dicker Watte schritt sie zu ihrem Sitzstein, sank darauf nieder und stützte den Helm in die Hände. „In hundertsiebenundsechzig irdischen Minuten gehen sie wieder auf!“ Sie wendete den Kopf: „Hörst du, in zwei Stunden und siebenundvierzig Minuten tauchen sie wieder auf, deine Leute.“
„Meine Leute“, echote die Maschine.
Robina lehnte sich zurück. Sie entspannte langsam; ein nie empfundenes Glücksgefühl durchströmte sie. Sie atmete tief. ,Es hat sich gelohnt’, dachte sie. ,Nach dreiundzwanzig Jahren und hundertsiebenunddreißig Tagen hat mein Ruf sie hergeführt, die Anderen …
Die Anderen? Und wenn es meine sind?’ Noch immer fühlte Robina sich fassungslos, keiner tieferen Überlegung fähig. „Das ist so gleichgültig!“, rief sie. Aber gleichzeitig pochte leise in ihr der Wunsch, es mögen die Anderen sein.
Robina starrte auf den Punkt am jenseitigen Ufer, an dem des Signal erneut erscheinen musste, obwohl, wie gerade dem Roboter mitgeteilt, noch Stunden vergehen würden.
Je zäher die Minuten tropften, desto mehr stellten sich Zweifel ein. ,Wenn mir meine Fantasie, mein Wunschdenken einen Streich spielt? Aber warum gerade heute? Hat mich das Sehnen nach einem solchen Augenblick nicht begleitet, seit ich wusste, dass die Gefährten mit der stolzen REAKTOM atomisiert wurden und ich nach der Havarie auf diesem todkalten, sterilen, wunderbaren Gesteinsbrocken allein sein werde?’
„Entschuldige!“ Robina strich zärtlich, so wie es die Handschuhe zuließen, über den Metallpanzer des Roboters. „Ohne dich und das Wissen um deine Abstammung hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt.“ ,Durch deine Hilfe geschieht das Ungeheure: Ich, Robina Crux, eine simple Feldoperateurin, eine verunfallte Raumfahrerin, eine Frau, die hundert Mal aufgegeben und einmal mehr Hoffnung schöpfte. Ich bin der erste Mensch, dem widerfährt, was Milliarden Menschen träumen, ich treffe mich mit anderen vernünftigen Wesen, bin Bote der Menschheit. Umsonst habe ich mir das Hirn zermartert, auf welche Weise ich von meinem Aufenthalt hier künde, habe jahrelang die wundervollen Flächen der Riesenkristalle mit meinen gebrannten Wörtern und primitiven Inhalten verdorben. Jetzt kann ich ihnen alles sagen, alle Fragen beantworten, kann ein Bild von meiner Erde vermitteln – wie es dort vor fünfunddreißig Jahren ausgesehen hat. Und wenn die, die da kommen, die Meinigen sind oder ich doch einer Halluzination erliege …?’
In Robina steigerte sich Spannung ins Unerträgliche. ,Und noch über zwei Stunden …’ Sie stand auf, wanderte ein Stück in die Ebene hinein, kehrte um. ,Ich muss sie begrüßen, sie empfangen. Wo werden sie landen? Hier, auf dieser Fläche? Kommen sie friedlich? Oder nehmen sie mir übel, dass ich ihr Funkfeuer manipuliert, mir ihren Roboter hörig gemacht habe? Nein! Sie würden kein Signal senden, sich nicht ankündigen.
Wie trete ich ihnen entgegen?’ Robina durchflutete eine heiße Welle. Ihre Gedanken gingen konfus. ,Dreiundzwanzig Jahre habe ich Zeit gehabt, mich auf dieses Ereignis vorzubereiten. Und wie stehe ich da? Warum habe ich nicht versucht, wenigstens einiges von ihrer Schrift zu entziffern – mit Birnes Hilfe? Zu einer Begrüßungsformel hätte es gereicht. Nein, deine Sprache hast du ihn gelehrt, arrogante Robina, bist, warst auch noch stolz darauf!’ Robina versuchte sich zu beruhigen. Sie ging zurück zur Grotte, schleuste sich in ihren Container, legte den Skaphander ab. Fahrig noch, dann gezielter, begann sie zu suchen. ,Wie lange? Zehn, fünfzehn Jahre habe ich keines genommen. Wo sind sie, die verfluchten Kügelchen?’ Robina spürte, wie sie mehr und mehr in Panik geriet. Sie erinnerte sich flüchtig, wie sie seinerzeit unter der Droge dahinvegetierte, gleichsam verkam, wie sie mit großem Kraftaufwand wieder ins Normale fand. ,Ein, nur ein Kügelchen …’ Sie fand die kleine Box hinter den üppigen Ranken ihrer Pflanzenecke. Als sie die Blätter berührte, befiel sie eine Ahnung von Wehmut, von Abschied. ,Welch ein glücklicher Augenblick damals, als aus den Samenkörnchen und der Hand voll Erde – Mandys sentimentales Amulett – die ersten Hälmchen sprossen.’ Robina breitete die Arme und strich liebkosend über Stängel, Blüten und Ranken, die ein Viertel ihrer Kemenate einnahmen. Dann riss sie sich los, schluckte ein halbes Kügelchen und zwang sich hinzulegen. Sie schloss die Augen; langsam begann die Droge zu wirken. Ein wenig Ruhe durchfloss die Frau. ,Ich lasse es einfach auf mich zukommen …’
Obwohl Erregung und Spannung kaum nachgelassen hatten, half ihr das Medikament, sich auf das Bevorstehende zu konzentrieren. Immer wieder mahnte sie sich, nicht in Hektik zu verfallen, zwang sich, den Raumanzug erst eine Viertelstunde vor dem zu erwartenden Durchgang des Schiffes anzuziehen. Aber dann eilte sie dennoch überhastet hinaus; der Schleusvorgang ging ihr nicht schnell genug. Und sie starrte zitternd vor Aufregung zum Horizont. Nervös strich sie mit der rechten Hand über den Metallkörper des Roboters, der unbeweglich, seine 30 Zentimeter über dem Boden schwebend, neben dem Grotteneingang stand.
Robina verfolgte die Ziffern der Uhr. Unendlich langsam tropften ihr die Sekunden.
‚Jetzt!’ Sie starrte, dass die Augen zu tränen begannen.
Nichts tat sich.
Nervös blickte Robina zum Chronometer und wieder zum Horizont. Die Zeit stimmte. ,Sollte er etwa kaputt …? Unsinn, es wäre das erste Mal und ausgerechnet jetzt, dass dieses Präzisionsding versagte!’
Robina bemächtigte sich Fassungslosigkeit. Sie stand und starrte, eine heiße Welle durchjagte ihren Körper. Ohne den Kopf zu wenden, schubste sie den Roboter, hieb mit der flachen Hand nervös auf dessen Panzer. „Wo bleiben sie?“, rief sie. „Warum kommen sie nicht? Verdammt!“ Sie lief etliche Schritte in die Ebene hinaus, breitete die Arme, schrie: „Hier bin ich, hierher! Verdammt, kommt hierher!“ Sie erstarrte förmlich in ihrer Pose, das Gesicht zum Horizont gerichtet. Dann ließ sie sich plötzlich auf die Knie fallen – noch immer mit abgespreizten Armen und starrem Blick. Endlich brach sie zusammen. Der Helm prallte auf den gläsernen Boden. Ihr Körper wurde hemmungslos von einem Weinkrampf geschüttelt, und sie schrie immer wieder mit erstickender Stimme: „Warum, warum …“ Mit den Händen schlug sie auf den harten Untergrund.“
Erstmals 1999 kam im Arena Verlag Würzburg das Kinder- und Jugendbuch „Die Ruine der Raben“ von Jan Flieger heraus: Als ob eine Radpartie durch Irland gruselig sein könnte. Daran haben Daniel, Jonas und Colin wohl zu allerletzt gedacht. Aber spätestens als ihnen das Mädchen Maureen von einem Spuk erzählt, da wird den drei Jungen doch etwas unheimlich. Und dann gehen sie auch noch hinein in die Burg, die so bedrohlich dasteht. Und man ahnt schon, dass bald etwas Geheimnisvolles und Gefährliches passiert. Schließlich ist Vollmond und noch manches mehr, was zusammenkommen muss, damit es spukt. Gruselig. Mitunter sogar sehr gruselig ist das Ganze. Wie man gleich sehen (also lesen) wird:
„DAS LABYRINTH
Und so betraten sie den Hof der Burg. Über ihnen flogen aufgeregte, kreischende Raben. Die Ruine war nahezu völlig zugewachsen. Es wirkte gespenstisch. Die Eingänge zu den Türmen hatte man zugemauert, nur die Schießscharten waren offen geblieben, allerdings lagen sie sehr hoch.
„Wir passen nicht durch“, maulte Jonas enttäuscht. „Hier ist überhaupt alles zugemauert. Hier kommt man nirgends in die Burg.“
Sie untersuchten das Gebäude neben dem Eingang. Jonas war es, der unter dichtem Blattwerk einen Spalt im Mauerwerk fand, durch den ein Junge passen konnte, wenn er nicht dick, sondern sehr schlank war. Als er Blätter und Ranken beiseiteschob, schrie er auf und sprang entsetzt zurück. Daniel und Colin zuckten zusammen.
„Was ist denn?“, wollte Colin wissen.
„Eine Kreuzspinne“, murmelte Jonas. „Beinahe hätte ich sie angefasst. Ein Riesending.“
Vorsichtig zwängten sie sich durch den Spalt. Die Schreie der Raben klangen ihnen auch, als sie eine schmale Treppe hinabstiegen, noch laut in den Ohren.
„Die kommen uns wohl nach?“, ließ sich Colin vernehmen. Aber da zuckte er zusammen, presste sich erschrocken an die Wand. Daniel und Jonas taten es ihm nach, denn ein dunkler schwarzer Blitz schoss an ihnen vorbei.
„Nur eine schwarze Katze mit einem Jungen im Maul“, grinste Daniel. „Wir haben mehr Angst gehabt als die blöde schwarze Katze.“
Sie stiegen tiefer hinab, gelangten in ein Gewölbe, das nur ein schwacher Lichtschein erhellte.
„Taschenlampe lässt grüßen“, sagte Daniel. Aber sie hatten nun mal keine mitgenommen. „Wollen wir nun umkehren?“, fragte Daniel spöttisch.
„Nein, nein“, wehrte Jonas die Frage ab. Wenn es um Burgen ging, hatte er nie Angst oder er unterdrückte sie.
Bald konnten sie sich nur noch tastend vorwärts bewegen, dicht beieinanderbleibend.
Plötzlich war im Dunkel die Stimme von Jonas zu hören. „Hier ist ein Loch in der Mauer. Da kann man durchklettern.“
„Jeder hält sich am anderen fest“, schlug Daniel vor. „So können wir uns nicht verlieren.“
Vorsichtig krochen sie durch das Loch. Jonas war der Erste. Er ließ seine Füße in das Dunkel hinabgleiten, fand felsigen Boden.
„Hier geht’s weiter“, flüsterte er.
Nun sprach keiner mehr laut. Sie waren umgeben von absoluter Dunkelheit und absoluter Stille. Sie standen reglos, ehe sie, sich weitertastend, dem Gang folgten.
„Es geht nach rechts“, flüsterte Jonas.
„Aber man kann auch nach links gehen“, stellte Daniel überrascht fest.
„Wir gehen nach rechts“, kam es von Jonas.
Tiefer und tiefer drangen sie in dieses seltsame Labyrinth ein.
„Irgendwann muss ein Ausgang kommen“, erklärte Jonas leise. Aber seine Stimme zitterte.
„Deine Worte in Gottes Gehörgang“, antwortete Daniel leise.
Ein Geräusch war plötzlich da, ein seltsames Geräusch.
Sie erstarrten, verharrten dicht aneinander gedrängt.
„Mich hat was ins Bein gebissen“, stöhnte Jonas auf. Offenbar wagte er nicht zu schreien. Welche Tiere konnten in den Gängen hausen? Ratten?
„Bestimmt ein Vampir“, lachte Daniel unsicher auf.
„Sehr witzig“, ärgerte sich Jonas.
Aber auch Daniel hatte plötzlich Angst. Sicher lag es an der Dunkelheit. Wenn es nun Wesen gab, die sie nicht kannten und die im Dunkel alles sahen?
„Quatsch“, machte er sich laut Mut.
„Was?“, wollte Colin wissen und seine Stimme bebte leicht.
„Weiter!“, kommandierte Daniel.
„Hier geht es nach links“, rief Jonas plötzlich. „Hier teilt sich der Gang wieder. Wir gehen nach rechts. Vielleicht gibt es einen alten Fluchtweg, der zur Burgmauer fuhrt. Jede Burg hat solche Gänge.“
Sie wussten nicht, wie lange sie schon in der Dunkelheit umhergeirrt waren, aber es musste einige Zeit vergangen sein. Colin schlug vor, doch lieber umzukehren und beim nächsten Mal Taschenlampen mitzunehmen. Jonas war einverstanden.
Plötzlich war dicht neben ihren Köpfen ein pfeifendes Geräusch zu hören.
„Fledermäuse“, vermutete Daniel, um die anderen, aber auch sich selbst zu beruhigen. Die Jungen tasteten sich zurück.
Doch sie mussten falsch gelaufen sein, denn plötzlich berührten ihre Hände eine Wand.
„Scheiße“, keuchte Colin. „Wir haben ein Problem.“
Jonas schrie auf. Es war ein gellender Schrei und Daniel packte die Schultern seines Bruders.
„Verdammt, ich bin gegen einen Felsvorsprung gerannt“, stöhnte Jonas auf.
Wieder ertasteten sie drei Gänge.
„Es muss nach rechts gehen“, meinte Daniel nachdenklich.
Erneut endete der Gang an einer Mauer.
„Das ist ein Labyrinth“, stöhnte Daniel auf. Und dann kam es leise von Colin: „Wenn wir Pech haben, findet man uns alle einmal als Skelette. Wenn überhaupt!“
Seine Worte waren nicht als Spaß gemeint. Keiner antwortete ihm, weder Daniel noch Jonas. Die Angst beherrschte die Jungen. Eine dunkle, unergründliche Angst.
Ihre Finger tasteten nun immer schneller über die Felswände und sie keuchten, als fehlte ihnen die Luft.
„Schneller!“, drängte Colin. „Macht doch schneller!“
Und wieder endete der Gang an einer Mauer. Und wieder tasteten sie sich zurück. Endlich sahen sie einen Lichtschein. Und sie hörten die Schreie der Raben. Erleichtert atmeten sie auf.“
Na, haben Sie auch mit aufgeatmet und sind froh, endlich wieder aus diesem gruseligen Labyrinth herausgefunden zu haben? Aber das war natürlich erst der Anfang! Aber wenn es Ihnen gar zu sehr Angst macht, dann können Sie ja im Gegensatz zu Daniel, Jonas und Colin zwischendurch das Buch zuschlagen oder vielleicht besser gesagt, den E-Book-Reader zur Seite legen. Um dann etwas später und etwas mutiger mit der Lektüre fortzufahren. Aber vielleicht brauchen Sie ja auch keine Tapferkeitspause …
Mindestens ebenso spannend sind auch die anderen vier Sonderangebote des heutigen Newsletters von C.U. Wiesner, Klaus Möckel und Alexander Kröger – so unterschiedlich auch Themen und Handschrift ihrer Verfasser sein mögen. Ein Lesevergnügen sind Sie allemal.
Viel Spaß beim Lesen, weiter einen schönen Sommer, dem bald der Lese-Herbst folgen wird, und bis demnächst.
EDITION digital wurde vor 25 Jahren von Gisela und Sören Pekrul gegründet und gibt Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, derzeit fast 1.000 Titel (Stand August 2019).
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()