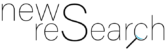Um eine ganz andere Dienstreise geht es in „Zurück zum Erdenball“ von Carlos Rasch.
„Autodiebe“ von Heiner Rank führt uns zurück in die fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts nach Berlin und in eine geteilte Stadt.
1983 war „Hoffnung für Dan“ von Klaus Möckel erschienen, eines der ersten Bücher über Menschen mit Behinderungen in der DDR. Daran schloss 2015 „Hoffnung, die zweite – Dan und seine Bilder“ von Aljonna und Klaus Möckel an – jedoch nicht als Fortsetzung, sondern als eine Einladung in eine verschlossene Welt.
Außerdem präsentiert dieser Newsletter wieder ein Angebot zum Supersonderpreis. Mehr dazu am Ende der Ausgabe. Und damit zu Büchner und in die Zeit, als es noch zwei deutsche Staaten gab.
Erstmals 2010 erschien im René-Burkhardt-Verlag Erfurt „Bonjour citoyen. Roman um Georg Büchner“ von Ulrich Völkel – dabei war das Buch sehr viel eher geschrieben worden. Mehr dazu erfährt man aus einer „Vorrede des Autors nach 20 Jahren“: Diesen Roman habe ich in den Jahren 1987 bis 1989 geschrieben. Mein damaliger Lektor, ein sehr freundlicher und aufrichtiger Mann, wusste manchmal nicht, ob er mir die Sache ausreden oder ob er mich ermuntern sollte, das Buch zu Ende zu bringen. Der Roman, darüber war ich mir im Klaren, würde in der DDR nicht erscheinen. Und ihn anderswohin zum Druck geben wollte ich damals nicht. Mit der Geschwindigkeit der sogenannten Wende hatte niemand gerechnet, weiter westlich noch weniger Leute als hierzulande. Ich unternahm gar nicht erst den Versuch, einen anderen Verlag zu finden. Das Thema war durch. Endgültig. Dachte ich. Nach mehr als 20 Jahren nahm ich mir das Manuskript noch einmal vor. Eigentlich war es eher Neugier als die Absicht, es erneut mit einem Verlag zu versuchen. Und dann verfolgte ich eine Diskussion im Fernsehen über die DDR von Leuten, die nicht in ihr gelebt hatten, und von Leuten, die in einer anderen DDR gelebt haben müssen. Vielleicht, dachte ich, könnte ich mit meiner Geschichte dazu beitragen, dass der eine oder andere ein Gespür dafür bekommt, was in einem vorgegangen ist, der dieses Land DDR gewollt hat – nicht so, wie es geworden ist, aber so, wie er meinte, dass es hätte werden sollen. Und der mit Bitternis erleben musste, wie katastrophal er sich geirrt hat. Ich habe diese 20 Jahre gebraucht, um Abstand zu gewinnen und eine gewisse Form von Freiheit, die vor allem darin besteht, dass ich mich an meiner Frau, an meinen Kindern und an meinen Enkelkindern wieder freuen kann. Und an ein paar wenigen Freunden. Das ist sehr viel. Ich denke an einen Titel von Willi Bredel: „Die Enkel fechten’s besser aus.“ – Schön wär’s. Ich habe an dem Manuskript wenig geändert. Vor allem sind es Kürzungen von Passagen, die des aktuellen Zeitbezugs bedurften, um verstanden zu werden, und des Landes, in dem ich lebte. Ich entdeckte Sätze, die mit Literatur wenig zu tun hatten, weil ich Dinge installieren wollte, die damals keine Zeitung gedruckt hätte. Es war häufig so, dass in der DDR Bücher Furore machten, weil in ihnen etwas stand, was anderswo nicht zu lesen oder zu hören war. Das gereichte der Literatur – und besonders den Literaten – schließlich zum Schaden, obwohl es dem einen oder anderen Leser geholfen haben mag. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt, der dieses Buch lesen will. Ich hoffe es aber“, schloss Ulrich Völkel seine damalige Vorrede aus dem Jahr 2010. Und damit sind wir schon am Beginn des 2. Kapitels und bei einer Reise der Hauptfigur in den Westen – nach Darmstadt:
„Der Zug lief pünktlich in Darmstadt ein. Das Theater hatte ihm mitgeteilt, in welchem Hotel er wohnen würde und den Weg beschrieben. Wenn er den Koffer auf dem Bahnhof einschloss, ließe sich das Hotel zu Fuß erreichen. Er war öffentlichen Verkehrsmitteln in einer fremden Stadt gegenüber skeptisch. Ein Taxi konnte er sich nicht leisten.
Lukas Stadl stieg aus dem Zug und blickte sich um. Er hätte schwören können, dass es hier anders roch als auf Bahnhöfen daheim. Ihm wäre lieber, er hätte alles vorgefunden, wie er es kannte. Und dies nicht, weil er es für besser hielt, wie es zu Hause war, aber es war sein Zuhause. Scheiß Paris, dachte er, Ringelnatz lässt grüßen.
Ein Mann kam direkt auf ihn zu. Er trug ein kleines Schild am Jackenaufschlag: Hessisches Staatstheater. Das enthob Lukas Stadl der Frage, was mit dem Koffer geschehen solle. Und es schaffte ein Gefühl von Vertrautheit in der fremden Stadt der fremden Welt. Er wurde abgeholt.
„Herr Stadl?“
Er nickte. „Ja.“
„Schubak. Ich bin Ihr Dramaturg. Willkommen in Darmstadt. Sie hatten eine angenehme Reise?“ Er reichte ihm die Hand. Dann bückte er sich nach dem Koffer, den er die Treppe hinauftragen wollte. „Ich habe den Wagen mit.“ Lukas Stadl protestierte. Er könne sein Gepäck durchaus selbst tragen.
Joseph Schilpe hatte ihm das erzählt. Joseph war schon in der halben Welt gewesen. In Boston hatte ihn ein – ja, wie sagt man korrekt zu einem Schwarzen? – also ein farbiger Amerikaner, ein dunkelhäutiger Taxifahrer jedenfalls angefaucht, als er seinen Koffer selbst in die Hotelhalle tragen wollte. „That’s my job!“ Man muss umdenken. Er ließ Schubak den Koffer tragen.
Sie fuhren die kurze Strecke zum Hotel. Schubak erklärte, was rechts und links zu sehen war, die Hände kaum am Steuer. Der Dramaturg hatte eine leise, unaufdringliche Stimme. Da hielten sie bereits vor dem Hotel.
Schubak nahm den Koffer und trug ihn in die Hotelhalle. Man schien ihn an der Rezeption zu kennen. Der Schlüssel für den Gast wurde vom Haken genommen. Zimmer 314. Die Anmeldung? Das hat Zeit. Er bliebe doch zehn Tage.
„Sie werden sich etwas frisch machen wollen“, sagte Schubak. „Ich warte in der Halle. Dann können wir die erforderlichen Imponderabilien gleich hinter uns bringen. Kaffee?“
Ein Hotelpage trug den Koffer zum Lift.
„Überredet“, antwortete Stadl locker. Leise summend öffnete sich die Lifttür. Gediegene Atmosphäre. Beruhigendes Rauschen. Freundlicher Glockenton. Die dritte Etage. Der Page trug den Koffer zum Zimmer, schloss auf, ließ dem Gast den Vortritt, stellte das Gepäck ab. „Haben Sie bestimmte Wünsche, Herr Stadl?“
Er meinte, den Sinn der Frage begriffen zu haben. Bakschisch, hatte der häufig dienstreisende Schilpe gesagt, überall musst du Bakschisch geben und kannst es auf keiner Reisekostenabrechnung belegen. Lukas Stadl griff in seine Tasche. Die letzten fünf Mark, weil er sich noch einen zweiten Kaffee und eine Wurst im Zug geleistet hatte. Er hatte es nicht kleiner. Wechseln lassen ging schlecht. Er gab das Geldstück mit einer großen Geste. Mit fünf Mark sind Sie dabei. Und war pleite.
Allein, sah er sich prüfend im Zimmer um. Es gefiel ihm. Er öffnete die Tür zum Bad, hellgrün gefliest, Ton in Ton. Er spülte die Hände ab und probierte das Eau de Cologne von der Konsole. Schubak, fragte er sich. Kenne ich den Namen irgendwoher? Freundlicher Mensch. Ihr Dramaturg. It’s my job. Die Bilder liefen ihm durcheinander.
Er verließ das Zimmer. Der Lift brachte ihn nach unten. Schubak hatte in der Halle einen Platz nahe der großen Scheibe zur Straße hin ausgesucht. Der Kaffee stand bereits auf dem Tisch, zwei große Cognac dazu. Schubak erhob sich und nahm erst wieder Platz, als Lukas Stadl saß. Höflichkeit? Unterwürfigkeit? Es gefiel ihm.
Der Dramaturg ergriff sein Glas und prostete Lukas Stadl zu. „Herzlich willkommen im Wilden Westen!“ Spott oder Spaß?
Der Cognac tat ihm gut. Er setzte sich bequemer in den Ledersessel und harrte der Dinge, die als Imponderabilien angekündigt worden waren.
„Professor Beuel erwartet Sie morgen gegen zehn Uhr, wenn es Ihnen recht ist. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit. Waren Sie schon einmal in der Bundesrepublik?“
Er war noch nicht. Die Verunsicherung machte sich wieder bemerkbar. Ich bin ein Exot für sie, dachte Stadl. Ich soll ausgestellt werden. Damen und Herren, Sie sehen hier einen aus dem Osten. Keine Angst, er tut Ihnen nichts. Wir haben ihm einen hübschen Käfig gebaut. Füttern erwünscht. – Oder bildete er sich das alles nur ein?
„Wenn Sie, bitte, quittieren würden, Herr Stadl?“ Schubak legte ihm einen Zettel und einen Briefumschlag hin.
Fünfhundert Mark? „Wie komme ich dazu?“, fragte er erstaunt.
„Sie müssen doch liquide sein, Herr Stadl“, erklärte er geradezu entschuldigend. „Sie sind unser Gast. Das Hotel geht natürlich auf unsere Kosten. Ein Vorschuss, der selbstverständlich verrechnet werden kann bei Vertragsabschluss. Wenn Sie darauf bestehen.“
Es wäre ihm entschieden lieber gewesen, wenn er hätte sagen können, dass er das Geld vorerst nicht brauche, er habe auf der Staatsbank ausreichend umgetauscht. Reisegeld? – hatten sie im Vorstand erstaunt gefragt. Sei froh, dass Du ein Dienstvisum bekommen hast. Mehr geht nicht. Du wirst doch irgendwo eine Tante mit etwas Westgeld haben oder so. Er setzte seinen Namen unter die Quittung. Stolz muss man sich erst einmal leisten können.
Schubak tat, als habe er das kurze Zögern Stadls nicht bemerkt. Er ging schnell zu unverbindlichen Themen über, das Wetter, die Fahrt hierher, Floskeln. Und unerwartet die Frage: „Sie haben mir die Sache von damals hoffentlich verziehen, Herr Stadl? Ist außerdem verjährt. Wir sind alle Heißsporne gewesen.“
Da fiel es ihm ein. Schubak, natürlich, Wilhelm Schubak! Der Verriss auf seine Inszenierung von LEONCE UND LENA. Und da musste er plötzlich lachen. „Schubak! Entschuldigen Sie, mir war der Name wirklich entfallen, weil Sie seither Schubiak für mich hießen. Halten zu Gnaden!“ Es war ein befreiendes Lachen. Der Druck löste sich endlich, der die ganze Zeit auf ihm gelastet hatte. Lukas Stadl legte die Rolle ab und war wieder er selbst.
Der Dramaturg lächelte schief. „War damals eben so. Trinken wir einen darauf?“ Sie waren alte Bekannte. Sie hatten sich zwar nie persönlich getroffen, aber sie hatten ein Stück gemeinsame Geschichte. Dass die irgendwann einmal auseinandergedriftet sein muss, war ihm noch gar nicht bewusst.
Als sich Schubak verabschiedete, war die Zeit für einen Stadtbummel schon zu fortgeschritten. Lukas Stadl sah noch, wie der Dramaturg in seinen Wagen stieg, nach vier Cognac. Er hätte sich jetzt nicht einmal mehr auf ein Fahrrad gewagt. In der Brusttasche seines Jacketts knisterte der Briefumschlag mit den fünfhundert Mark West. Sie wollen es schließlich verrechnen, sagte sich Lukas Stadl. Und im Übrigen haben sie mich eingeladen.
In sein Zimmer zurückgekehrt, fühlte er sich bereits etwas heimischer. Er nahm sich Zeit, die Einrichtung zu taxieren. Es war kein erstklassiges Hotel, aber ein gediegenes. Der Zimmerpreis ließ ihn die Augen heben, einhundertzweiundvierzig Deutsche Mark, allerdings einschließlich Frühstück. Das ist die Gelegenheit, hatte ihm Joseph Schilpe auf den Weg gegeben, sich ordentlich satt zu essen, um das Geld für ein teures Mittagessen zu sparen. Fünfhundert Mark sind hierzulande kein Vermögen.
Er nahm die Wäsche aus dem Koffer und legte sie in den Einbauschrank im Vorraum. Den Inhalt seines Reisenecessaires stellte er auf die Konsole im Bad und in den Spiegelschrank. Er ließ Wasser in die Wanne laufen und schüttete den bereitstehenden Badezusatz hinein.
Er hätte müde sein müssen, aber er fühlte sich hellwach. Er dachte unvermittelt an Johanna. Wenn ich um diese Stunde ein Gespräch anmelde, müsste es eigentlich bis dreiundzwanzig Uhr durchgestellt sein. Um diese Zeit ist sie meistens noch wach. Er nahm den Hörer auf und wählte die Hotelzentrale an, der er seine Nummer von zu Hause und die seines Hotelzimmers nannte. „Wird es länger dauern?“, fragte er vorsichtshalber.
„Wieso?“, klang es leicht pikiert zurück, als habe er Trägheit unterstellt. „Ich verbinde Sie. Außerdem können Sie von Ihrem Zimmer aus direkt anwählen.“
Ehe er begriffen hatte, meldete sich Johanna am anderen Ende der Leitung. „Stadl.“ Es schwang die Frage mit, wer um diese Zeit noch anrufe.
„Hier auch.“´
Erstmals 2009 druckte der Projekte-Verlag Cornelius Halle Band 1 der Raumlotsen-Reihe von Carlos Rasch „Zurück zum Erdenball“: In dem auf vier Bände angelegten Werk zeichnet Carlos Rasch in episodenhaften Abenteuergeschichten eine nicht zu ferne Zukunft: den Raumfahreralltag im Sonnensystem, Bedrohungen aus der Tiefe des Alls, die Dinge, welche unsere Nachkommen bewegen könnten. Die Geschichten sind größtenteils unveröffentlicht, neun von ihnen wurden für die Reihe überarbeitet. Während die Science Fiction die Leser meist von der Erde weg in den Kosmos entführt, geht dieser Buchband in sechs Geschichten über RAUMLOTSEN den umgekehrten Weg: Sie erzählen mit „Und ringsum nur die Sterne“ von der Erkundung des Trümmergürtels zwischen Mars und Jupiter, in „Vandalus“ von treuer Kameradschaft bei einer Mission am Rande des Sonnensystems, und in „Diamanten von Pupurgrazia“ über die Beschaffung seltener Rohstoffe mit Hilfe von Mutanten. In den drei Geschichten „Verlobung im Orbit“, „Raumschlepper HERKULES“ und „Absturz beim Prüfungsflug“ treten die menschlichen Probleme erdnaher Raumfahrt in den Vordergrund. Die Hauptakteure sind ein Dreigestirn: Der legendäre Altraumfahrer Ben, die Raumfahrtpsychologin Cora und der Kadett der Raumflotte Jan. Und so beginnt der kosmische Ausflug:
„Und ringsum nur die Sterne
Wenn Abendrot Sternenschein entflammt
über den dunklen Hügeln der Erde,
beugt, sonderbar umspielt vom Licht,
unter aufquellender Träne sich,
zur Erde der Astronaut
und küsst zum Abschied sie.
Tagebuch der Astronautin Cora
Vorstoß zum Trümmergürtel
Die gesamte Besatzung hatte sich in der Kommandozentrale des Raumschiffes versammelt. Auf den Gesichtern lag ein Ausdruck gespannter Erwartung, denn der erste Höhepunkt ihrer Mission stand bevor: Das Eintreffen im Operationsgebiet der Asteroidenjäger! Als letzter betrat Kommandant Axel Kerulen, ein kräftiger, mittelgroßer Mann, den Raum. Gewohnheitsmäßig warf er einen prüfenden Blick auf die Kontrollinstrumente am automatischen Astro-Piloten, Pilotron genannt. Der Flug verlief planmäßig. Auch die Radarkonsole zeigte keine beunruhigenden Tänzchen mit Kurven und wechselnden Diagrammen. „Unser Raumschiff hat seine Einsatzposition erreicht“, sagte er zu Norbert Franken an der Funkkonsole. „Sende unser Rufzeichen und stelle Kontakt zur Leitrakete her.“
Norbert richtete sich in seinem Konturensessel auf. Seine Finger huschten über die Tastatur, um die gewünschte Verbindung herzustellen. Er wusste, dass außen am Raumschiff nun eine Antenne ausgefahren wurde. Sie kreiste langsam und suchte ihr Ziel: Die Leitrakete AJ-401, die, für menschliche Maßstäbe unendlich weit weg, fern in eiskalten, schweigenden Abgründen des dunklen Universums hing. Aus dem Kreis der wartenden Besatzung hatten sich inzwischen auch der Ingenieur für die Düsenaggregate und der Navigator gelöst, um ihre Plätze am Triebwerkspult und am Navigationsschirm einzunehmen. Die leisen Gespräche verstummten. Stille breitete sich in der Kommandozentrale aus. Auf dem Monitor interpretierte die Elektronik den Kontakt. Ein heller Punkt wanderte vom Rand zur Bildmitte. Dann verdeutlichte die Apparatur den Punkt zu einem Raumschiffsymbol mit den Buchstaben AJ-401. Eine Stimme wurde hörbar, schwach, aber bald deutlicher. Auf dem Monitor ordneten sich die Farben zu einem Gesicht.
„Hier Leitrakete der vierten kosmischen Flottille!“, sagte der Mann. Er schmunzelte. „Ich dachte, ihr Narren von der Wimmelwelt Erde habt es verschlafen, euch in unsere Suchgruppe einzugliedern. Erwartet haben wir euch bereits vor 72 Stunden.“
Axel Kerulen ignorierte diese ironische Kritik, denn es handelte sich bei einer Reise von der Erde zum Mars und über dessen Bahn hinaus nicht um den Linienflug einer Mondfähre, die nach Fahrplan flog. Es war ein gefährlicher Bereich des Alls, in dem man sich befand, wo oft wegen Meteoritenschwärmen zeitraubende Abweichungen vom Kurs in Kauf genommen werden mussten. Er hielt sich an seine Rolle als Kommandant und fragte in offiziellem Tonfall: „Hier AJ-408. Ich möchte dem Kommodore unser Eintreffen im Operationsgebiet mitteilen und den Statusbericht geben.“
„Steht neben mir. Ich übergebe.“
Das Gesicht auf dem Monitor wechselte zu einem Mann mit eisgrauem, kurzem Haar. Schweigsam musterte der die Frauen und Männer hinter und neben Axel Kerulen. Der meldete ihm: „Alle wohlauf und gut trainiert. Schiff einsatzbereit. Technisch keine Probleme. Funkwarnfeuer für Asteroiden und Ausrüstungen zur Vernichtung von Meteoriten an Bord, Kommodore.“
„Wieso Schiff? Das Wort Raumkreuzer scheint neuerdings verpönt zu sein. Wessen Idee war denn auf der Erde die Umbenennung unseres Verbandes von Raumkreuzern zu Asteroidenjägern?“, fragte der Befehlshaber. „Sicherlich irgendwelche Klugschnäbel, die das den Leuten vom Kosmischen Rat eingeredet haben.“
„Taktische Sprachregelung zur Kostenbegründung, Kommodore. Raumkreuzer heißen jetzt nur noch jene Raumschiffe, welche die Solarkraftwerke in der Erdumlaufbahn vor Meteoriten schützen.“
„Aha. Reden wir später noch mal über dieses Thema. Zurück zu den Dienstvorschriften.“
„Wir sind Ihrem Kommando für 19 Monate unterstellt. Nahrung und Energie für die Triebwerke sind, wie vorgeschrieben, in dreifacher Menge gebunkert. Unsere Geschwindigkeit beträgt, auf die Sonne bezogen, derzeit 45 Kilometer pro Sekunde. Anschließend übermittle ich Ihnen unsere Besatzungsliste. Sie werden auf ihr bewährte Leute finden, die bereits mehrmals im All eingesetzt waren.“
Der Kommandant machte eine kurze Pause. Er drehte sich nach seinen Leuten um und nickte ihnen aufmunternd zu, bevor er wieder den Kommodore auf dem Bildschirm ansah. „Vier meiner Frauen und Männer möchte ich Ihnen aber gleich vorstellen, nämlich unsere Neulinge, die zum ersten Mal in ihrem Leben Irdien verlassen haben. Es sind dies die Chemikerin Filitra Goma aus dem südamerikanischen Kulturbereich, der Informatiker Rai Raipur aus dem indischen Kulturbereich, der Japaner Kioto Yokohata aus dem fernöstlichen Kulturbereich, Pilot unseres Kolibri-Shuttles, und der Mathematiker Oulu Nikeria aus dem zentralafrikanischen Kulturkreis. Diese jungen Raumfahrer sehen mit Ungeduld ihrem Einsatz im Trümmergürtel entgegen. Jüngster Aspekt unserer Mission hier auf Mars-Vorposten ist es auch noch, das Herannahen der Strahlungsfront des Crabnebels – nach den Asteroiden die zweitgrößte Gefahr für die Menschheit – zu messen. Diese neue Order dazu für den ganzen Suchverband habe ich, gesiegelt, mitgebracht. Ich hoffe, wir haben bald mal eine Annäherung auf kurze Distanz, damit ich Ihnen, Kommodore, dieses Siegel persönlich übergeben kann.“
Die vier Genannten waren vorgetreten. Die Nennung der beiden Hauptgefahren für die Menschheit bewirkte, dass sie sich alle in ihrer Haltung unwillkürlich strafften, denn ihnen war bewusst, dass man auch anderswo im solaren Raum, etwa durch den Bau eines Observatoriums auf Merkur zur Direktbeobachtung der Sonne, heldenhafte Anstrengungen unternahm, um Vorbereitungen zum Eintreffen jener gefährlichen Front harter kosmischer Strahlung als Folge einer Supernova zu treffen, deren Ausbruch vor rund tausend Jahren in China am Himmel beobachtet worden war.
„Allzeit heiße Düsen“, sagte der Kommodore zur Begrüßung der im Operationsbereich eingetroffenen Mannschaft mit standesgemäßem Raumfahrergruß.
„Allzeit. Allzeit. Allzeit“, erwiderten die Frauen und Männer um Axel Kerulen. Einigen von ihnen war bei der Grußfloskel ein Schauer über den Rücken gelaufen, weil es für jeden Raumfahrer das Todesurteil war, falls das Gegenteil eintreten sollte und die Düsen bei einer Zündung kalt bleiben würden.
„Ich heiße euch Astronauten von AJ-408 im Operationsgebiet Mars-Vorposten herzlich willkommen. Möge jeder seelisch und körperlich unversehrt von hier eines Tages wieder zur Erde heimkehren. Ihr wisst alle, auf was ihr euch eingelassen habt, nämlich: Wenn uns hier etwas zustößt, sind wir auf uns allein angewiesen. Der Trümmergürtel zwischen Mars und Jupiter ist grundsätzlich schwieriger für die Navigation als die Region zwischen den Parkbahnen auf Erdumlauf mit ihren Raumstationen und Solarkraftwerken. Wir erfüllen hier im All fern von unserer Heimatwelt eine wichtige Aufgabe zur Sicherung der Flugrouten. Indem wir im Bereich der Meteoritenströme zwischen Mars und Jupiter das All nach Trümmern eines vor undenklichen Zeiten geborstenen Planeten durchsuchen, um sie zu registrieren, helfen wir, die schlimmste aller Gefahren für die Menschheit zu mindern. Unsere Aufgabe ist, Asteroiden, Felsbrocken und Trümmer aufzuspüren und mit Bahnberechnungen auf Jahrhunderte im Voraus zu katalogisieren. Daraus gewinnen wir Gewissheit, welche eines Tages Kurs auf die Erde einschlagen. Aber wir machen damit auch den Trümmergürtel für jene Raumschiffe passierbar, die Stargates zu künftigen Siedlerwelten transportieren. Wir haben eine Suchkette gebildet. Der Abstand von Raumschiff zu Raumschiff beträgt etwa zwei Millionen Kilometer. AJ-408 wird AJ-417 auf der äußersten, erdfernsten Position ablösen.“
Damit war die Begrüßung vorbei. Es wurden noch praktische Hinweise zwischen den beiden Besatzungen ausgetauscht. Dann schaltete Norbert den Kontakt ab. Die Buchstaben AJ-401 mit dem Raumschiffsymbol auf dem Monitor der Funkkonsole erloschen. Die Richtantenne wurde wieder eingezogen. Man reduzierte die Geschwindigkeit des Raumschiffes um 60 Prozent als Angleichung an die Suchgruppe. Während der Kommandant mit dem Navigator Ben und dem Triebwerksingenieur die Kursänderung einleitete, ging Filitra, die Freizeit hatte, zum Gemeinschaftsraum. Eine Verstrebung der Konstruktion, die ihn durchzog, war geschickt als Marmorsäule gestaltet. Ein Hauch von Meer und Salz aus der Klimaanlage durchwehte ihn und bewegte die Blätter echter Kübelpflanzen. Natürlich hielten sich bei Freizeit alle gern in diesem Raum auf, denn die nur sechs Kubikmeter großen Kabinen mit dem Schubfach der Schlafbox waren beklemmend eng.
Filitra setzte sich an den Konzertflügel, der aber, genau genommen, gar nicht existierte, sondern aus Gründen der Gewichtseinsparung nur die Illusion eines solchen Musikinstrumentes darstellte. Filitra spielte das „Largo Andalusio“ von Bartoll Lysandros. Als Freizeitpianistin stellte sie keine Ausnahme dar, denn an Bord spielte fast jeder ein Instrument, bevorzugt ein kleines, das nicht nur virtuell, sondern tatsächlich gehandhabt werden konnte.
Bald nach ihr betraten noch die Geschwister Norbert und Sagitta, sie die Ärztin und er der Funker an Bord, den Gemeinschaftsraum. Ihr Lieblingsplatz war die antike Säule, an die sie sich lehnten. Die schlanke Säule weitete die Dimension des Raumes und ließ ihn größer erscheinen, als er es wirklich war. Wenn Norbert so mit verschränkten Armen dort bei Sagitta stand, vermeinte Filitra, er blicke enttäuscht vergeblich durch die Hülle des Raumschiffes in den Glanz der Sterne, auf der Suche nach dem blauen Erdball. Filitra machte sich über das Geschwisterpaar so ihre Gedanken. Zum Beispiel war ihr aufgefallen, dass beide im Umgang mit anderen lebhaft und gesprächig, aber miteinander gedankenverloren, schweigsam waren. Sie verfügten wohl über eine sensitive Begabung, denn sie konnten, wie Filitra meinte, Stimmungen an Bord erkennen und besser darauf eingehen als alle anderen.
Miteinander verstanden sie sich deshalb fast wortlos. Auch jetzt waren sie wieder in diese Eigenart verfallen: Ein gerauntes Wort hier, ein Blick oder eine Bewegung der Hand dort genügten, damit sie sich verstanden. Sagitta sagte grade zu Norbert: „Ich wüsste gern, warum Raumfahrer die Erde oft als Wimmelwelt bezeichnen? Vorhin bei der Ankunft im Operationsgebiet geschah das wieder.“
„Liebevoll oder verächtlich gemeint?“, wollte Norbert wissen.
„Beides“, sagte sie. „Ob bald auch wir so?“
„Also formt uns das All mit Stille und Einsamkeit“, setzte er fort.
„Werden wir bei Heimkehr menschenscheu sein?“, überlegte sie.
„Oder krank vor Sehnsucht nach Irdien?“, ergänzte er.
„Hat uns niemand vorhergesagt.“
„Blauer Erdball wärmt mehr als heiße Sonne.“
„Ist eben Heimat.“
„Hört auf“, sagte Filitra und lachte. Dabei stieß sie die beiden kameradschaftlich an. „Eure Sätze werden immer kürzer. Gleich sprecht ihr nur noch in Silben miteinander oder verwandelt euch in Augensprecher, unterstrichen von Schnaufzeichen und veränderten Nasenwinkeln“, scherzte sie. „Aber ich habe eine andere Frage an Norbert, sozusagen als lernbegieriger Neuling. Ihr habt wenigstens schon Erfahrung durch Dienst auf Mondfähren. Ich aber erhielt gleich einen Fernflug verpasst.“
„Lass hören“, sagte Norbert und zwinkerte Sagitta zu, als wolle er damit sagen: Fili ist zwar eine geschwätzige Elster, die viel Worte um eine Sache macht, aber wir mögen sie trotzdem. Sie hat sogar unsere sensitive Eigenart bemerkt.
„Nach dem Kontakt zur Leitrakete hast du an deiner Funkkonsole ein vorbereitetes Datenpaket ausgelöst. Was ging da weg?“
„Ich habe unsere Nabelschnur versorgt. Es sind im Datenpaket Informationen für den Operativstab der Raumflotte auf Irdien via Marsstation enthalten. Dazu die Koordinaten unserer Position jetzt. Das hilft den Relaissatelliten, den Richtstrahl mit Raumpost für uns präziser unserem Bahnverlauf nachzuführen. Außerdem können uns dadurch Nachschubraketen besser zugeleitet werden.“
„Alles klar: Nahrungsmittel, Wasser, Energie, Sauerstoff und Ersatzteile, um allen nur erdenklichen Notfällen vorzubeugen und unsere Vorräte möglichst immer auf dem gleichen Stand zu halten. Du kannst ja doch reden wie ein Wasserfall“, spöttelte Filitra.
„Notfälle? Macht dir der Trümmergürtel Angst?“, konterte er.
„Jeder auf Erden weiß, dass das All lebensfeindlich ist, erst recht bei Flügen in den Trümmergürtel“, sagte Filitra. „Andererseits ist es ringsum leer, selbst hier im Gürtel, nach menschlichen Maßstäben, meine ich. Überall nur ferne Sterne. Wo ist da die Gefahr? Ich wette, wir werden trotz modernster Messmittel monatelang suchen müssen, ehe wir einen Asteroidenprotz mit heikler Flugbahn finden, der ein Funkwarnfeuer bekommen muss, weil er vielleicht in 500 Jahren mal dem Erdball bedenklich nahe kommt.“
Inzwischen waren weitere Besatzungsangehörige in den Freizeitraum gekommen und hatten sich zu ihnen gestellt. Ihre Unterhaltung weitete sich zu einem allgemeinen Disput darüber aus, wann man die erste Begegnung mit einem „Reigen der Bröckel“, wie es Sagitta ausdrückte, haben würde. Während die Erde jährlich nur einige Male einen Meteoritenschwarm durchquerte wie etwa das Partikelband der Leoniden regelmäßig im November oder der Perseiden im August, mussten Asteroidenjäger häufiger damit rechnen. Das würde dann mit heftigen Flugmanövern verbunden sein, um solchen „Reigen der Bröckel“ auszuweichen statt auf die Laserkanonen zu vertrauen.“
Erstmals 1959 veröffentlichte Heiner Rank im Deutschen Militärverlag Berlin seinen Kriminalroman „Autodiebe“: Oberleutnant Paul Wiener von der Ostberliner Kriminalpolizei wurde erschossen und sein Freund, Leutnant Joachim Marzinek, wurde mit der Ermittlung beauftragt. Der Tod seines Freundes hing sicher mit dessen letztem Fall zusammen, der noch nicht abgeschlossen war und über dessen Ermittlungsstand nur wenige Stichworte aus dem Notizbuch Wieners zu ersehen sind. Nur langsam kommt Marzinek der Bande von Autodieben auf die Spur. Im geteilten Berlin Mitte der 1950er Jahre werden fast neue Volkswagen in Westberlin gestohlen und zu Höchstpreisen in der DDR verkauft. Ein einträgliches Geschäft, bei dem Menschenleben keine Rolle spielen. Ein spannender Kriminalroman von 1959, dem man das Alter nicht anmerkt. Hier der Beginn des 2. Kapitels, das uns mit der Gegenseite der ermittelnden Volkspolizei bekanntmacht und mit einer aber sogleich wieder niedergeschlagenen Revolte:
„Es war am frühen Nachmittag desselben Tages.
In einem fensterlosen, lang gestreckten Raum hockten etwa fünfzehn Männer um zwei zusammengerückte Billardtische. Tief hängende Lampen mit kleinen runden Porzellanschirmen schnitten weiße Lichtkegel durch die rauchgeschwängerte Luft. Die Gesichter der Männer blieben im Dunkeln, sie hoben sich nur undeutlich von den unverputzten, weiß getünchten Wänden des Zimmers ab.
Auf einem hölzernen Hocker am Kopfende der Tische saß ein schlanker, elegant gekleideter Mann. Er hatte ein markantes Gesicht und kühle graue Augen. Die harten, von der Nase zu den Mundwinkeln laufenden Falten und das in leichten Wellen sorgfältig nach hinten gelegte Haar, durch das sich schon viele graue Fäden zogen, ließen eine Vermutung auf sein Alter zu: Er mochte etwa fünfzig Jahre alt sein. Auf den ersten Blick wirkte er wie ein gut situierter Geschäftsmann, doch seine tadellose, etwas zu straffe Haltung verriet den ehemaligen Offizier. Vor ihm auf dem grünen Tuch des Billardtisches lagen in Bündeln Fünfzigmarkscheine.
Seine gepflegten Hände griffen mechanisch ein Geldpäckchen und warfen es, immer wenn ein rechts von ihm sitzender kleiner Kerl aus einer Liste einen Namen vorlas, dem Manne zu, der am Tisch die Hand hob.
Der Kleine fungierte als Buchhalter. Doch war das nur eine Nebenbeschäftigung, die er als Vertrauter des Chefs ausübte, dem er in einer Mischung aus Dankbarkeit und Angst vorbehaltlos ergeben war. Schon als Zehnjähriger war er das erste Mal als Taschendieb auf frischer Tat ertappt worden, und seitdem hatte sich in seinem Strafregister eine Unzahl kleinerer Eigentumsdelikte angesammelt, denn zu seinem Kummer trug er ein unverwechselbares Gesicht, das für ihn stets berufsschädigende Folgen hatte. Kleine, eng zusammenstehende, unstete Augen, einen Schopf wirrer dunkler Haare, die wegen ihrer natürlichen Krause nie zu bändigen waren, wulstige Lippen, lange gelbe Pferdezähne und als besonderes Charakteristikum eine verknorpelte Nase, aus deren Öffnungen eine üppige Flora schwarzer Härchen spross.
Vor einiger Zeit fand er Anschluss an die Bande und bezog nun ein festes Gehalt, sodass er auf gewagte Einzelaktionen, die ihn immer wieder ins Kittchen brachten, verzichten konnte. Er beugte sich eifrig über den nicht ganz sauberen Bogen. Durch seine großen abstehenden Ohren schimmerte das Licht und ließ sie wie Kinderdrachen im Sonnenschein rot erglühen. Die Stille, die in dem Raum herrschte, wurde nur durch seine ordinäre, monoton die Namen herunterleiernde Stimme und das Klatschen der Geldbündel unterbrochen.
„So, das war’s für heute! Hassel, Sie nehmen das Gehalt für die Kundenwerber mit“, sagte der Mann am Kopfende des Tisches. Seine Aussprache war genauso korrekt wie seine Kleidung.
Die letzten beiden Päckchen flogen auf einen jungen Mann zu. Der hatte die Ellbogen auf den Tisch gestemmt und stützte das Kinn mit beiden Händen.
Mürrisch starrte er vor sich hin und rührte keinen Finger, um das Geld an sich zu nehmen.
„Morgen früh müssen Sie sowieso zu Nemitz fahren. Schärfen Sie ihm nochmals ein, er soll sich hier auf keinen Fall sehen lassen. Er soll auch nicht anrufen.“
Jetzt endlich bequemte sich der junge Mann, den Mund aufzumachen. „Hier ist doch was faul“, begann er. Bei seinen ersten Worten hoben die Männer erstaunt die Köpfe, denn sie hörten nicht die gewohnte Zustimmung, sondern Widerspruch. „Unser Laden funktioniert, der Umsatz wird immer größer“, fuhr er fort. „Ich möchte mir die Frage erlauben, warum dann die Gewinnbeteiligung immer kleiner wird? Im März waren es zweitausendfünfhundert, im April zweitausend und jetzt nur noch achtzehnhundert. Außerdem sind wir keine Beamten, die am Schreibtisch pennen und dafür Gehalt hinterhergeschmissen kriegen.“
Ein zustimmendes Murmeln wurde laut, und Fred Hassel fügte ermutigt hinzu: „Wir halten alle den Hintern hin, und darum sollte auch der Gewinn in gleiche Teile gehen.“
Ein stiernackiger Kerl mit rötlichem Borstenhaar und fettem Gesicht, der links neben dem Chef saß, rieb seine roten Finger, die er sich vor Jahren an der Fleischbank erfroren hatte und die zu jucken begannen, sobald er in Erregung geriet. Er hatte die Beine weit ausgestreckt, sodass er auf seinem Stuhl mehr lag als saß. Jetzt richtete er den Oberkörper auf. „Halt die Klappe, du Miesmacher!“, sagte er und starrte Hassel wütend an. „Wenn dir vor Angst die Hosen schlottern, kannst du ja …“
Der Chef brachte seinen Leibwächter mit einer ungeduldigen Handbewegung zum Schweigen. „Was soll denn dieser Unfug, Hassel?“, wandte er sich an den jungen Mann. „Malkowski hat doch vorhin die Einnahmen und Ausgaben vorgerechnet. Wenn Sie es nicht glauben, bitte, Sie können es nachprüfen.“ Er nahm ein Buch vom Tisch und reichte es seinem stiernackigen Nebenmann, der es mit missmutigem Gesicht weitergab.
Hassel schlug es auf. Es war ein einfaches blaues Diarium, in das Malkowski eine primitive Buchführung gekritzelt hatte.
In der Mitte des Blattes war ein senkrechter Strich gezogen. Auf der linken Seite standen die Einnahmen, auf der rechten die Ausgaben. Die Endsumme rechts war von der Endsumme links abgezogen, und was übrig blieb, war durch zwanzig geteilt, pro Mann einen Anteil. Die Bande zählte zwar nur achtzehn Mitglieder, aber man hatte vereinbart, dass der Chef zwei Anteile bekommen sollte und seine beiden Handlanger, „Orje“ Malkowski und Ferdi Gross, zusätzlich je einen halben.
Hassel fuhr mit seinem Finger über die Zeilen und verglich die Zahlen. Er sah, dass die Einnahmen im Verhältnis zu den Vormonaten gestiegen waren, aber gleichzeitig waren auch die Spesen gewachsen und hatten den Löwenanteil der Einnahmen wieder aufgefressen. Einen Rechenfehler konnte er nicht entdecken. Ärger stieg in ihm auf, denn er begriff, dass seine Attacke den Schwung verloren hatte. Der Chef war geschickt und hatte ihn auf ein Gebiet abgedrängt, wo er sich verheddern musste, weil er von Buchhaltung nichts verstand. Wütend klappte er das Buch zu. „Dieses Geschmiere scheint in Ordnung zu sein“, sagte er widerwillig.
Auf den Gesichtern der Männer malte sich ein wenig Enttäuschung, die sich aber bald in hämische Schadenfreude verwandelte. Nur die Miene des Chefs blieb völlig undurchsichtig, als er sagte: „Wenn es Sie beruhigt, können Sie auch noch die übrigen Unterlagen einsehen. Malkowski, geh ’runter und hole die Mappe mit den Quittungen.“
Hassel winkte müde ab. „Nicht nötig, Chef. Der Kram wird schon irgendwie stimmen. Wenn Sie mir nur erklären könnten, warum unsere Anteile immer kleiner werden? Wir leisten doch nicht weniger als früher.“
„Hassel, Sie müssten das doch langsam wissen. Eben hatten Sie die Abrechnung noch einmal in der Hand. Aber schön, ich sehe, Sie haben es wirklich nicht verstanden. Ich werde Ihnen also die Geschichte zum zweiten Mal erklären.“
Er machte eine Pause, nahm aus der Brusttasche ein silbernes Zigarettenetui und klemmte sich eine „North State“ zwischen die Lippen. Von Ferdi Gross wurde ihm Feuer gereicht. Er machte einige tiefe Züge und blickte auf die Männer, die sich um die grünen Billardtische drängten und ihn erwartungsvoll anglotzten.
Für einen Augenblick schien ihm die Szene unwirklich. Der kahle Raum mit den zugemauerten Fenstern, die einst einen trostlosen Ausblick auf einen Berliner Hinterhof gewährt hatten, die grellen Lichtkegel der tief hängenden Lampen, die abgestumpften oder brutalen Gesichter der Bandenmitglieder und seine beiden Leibwächter, die nach grotesken Gangsterkarikaturen aussahen.
Er musste ein schmerzliches Lächeln unterdrücken. Welch ein Abstieg, dachte er. Vom Mitarbeiter des Deutschen Geheimdienstes, der bis zum Zusammenbruch nur in den „besten Kreisen“ verkehrt hatte, zum Bandenchef nach importiertem Muster. Nun, er würde zurückkehren in die Welt der „oberen Zehntausend“. Die schmutzige Arbeit, die andere für ihn machten, brachte Riesensummen ein. Denn nie zuvor hatte er es mit so armseligen Köpfen zu tun gehabt. Die Burschen waren seinem scharfen und skrupellosen Verstand in keiner Weise gewachsen und bemerkten nicht, wie schamlos sie um ihren Beuteanteil betrogen wurden. Er wollte ihnen schon ein Märchen auftischen, das seine Wirkung nicht verfehlte.“
Erstmals 2015 erschien als Eigenproduktion der EDITION digital „Hoffnung, die zweite – Dan und seine Bilder“ von Aljonna und Klaus Möckel: 1983 erschien Klaus Möckels aufrüttelndes Buch über seinen gehörlosen Sohn „Hoffnung für Dan“, einer der ersten Berichte über Behinderte in der DDR. Dieses authentische Zeugnis, Dans Mutter gewidmet, erzählt vom schwierigen Alltag mit solchen Kindern und von den schier unlösbaren Problemen, vor denen die Eltern oft stehen. Es löste damals heftige Diskussionen aus und fand bis in die neunziger Jahre hinein eine breite Leserschar. In dem Buch, inzwischen wieder als E-Book bei Edition digital vorliegend, wird das Heranwachsen des Kindes bis zum vierzehnten Lebensjahr geschildert. Es endet mit dem Wunsch der Eltern, für den Sohn ein zweites Zuhause zu finden, das ihm auch nach ihrem Tod Sicherheit bietet – ein Wunsch, der seinerzeit großen Optimismus erforderte. Durch „Hoffnung, die zweite“ erfährt der Leser, dass der Optimismus, wenn auch anders als damals gedacht, begründet war. Inzwischen erheblich älter, lebt Dan unter Betreuung in einem Behindertenwohnheim in Potsdam und arbeitet in einer geschützten Werkstatt. Seine Eltern achten darauf, dass der Kontakt erhalten bleibt: Sie holen ihn regelmäßig zu sich und verbringen oft den Urlaub mit ihm. Dieses zweite Buch ist aber kein weiterer Lebensbericht, sondern eine Sammlung von Bildern, die Dan über die Jahre hinweg geschaffen hat. Mit kleinen humorvollen Geschichten versuchen die Autoren, die Sprache ihres „sprachlosen“ Sohnes zu verdeutlichen, der sich wegen eines frühkindlichen Hirnschadens weder über Gebärden noch über Lesen und Schreiben mit seiner Umwelt verständigen kann. Es entstand ein verführerischer Band voller naiver Kunst und prächtiger Farben, voller dunkelgrüner Wälder, bunter Blüten, japanisch anmutender Zweige, blauer Häuser, roter oder gelber Himmel. Ein Buch vor allem, das dem Betrachter Einblick in eine vielfach verschlüsselte Welt gewährt. Und hier der Text des 1. Kapitels:
„Am Anfang war das Chaos. Das Ungeordnete, Verwirrende: Die Elemente suchten nach Formen und Verbindungen. Hier ist der Pinsel, dort die Farbe – was fange ich damit an? Erste abstrakte Konstruktionen entstehen; Gelb leuchtet auf, von roten, braunen, grünlichen Rändern umgeben, vor allem aber von waberndem Schwarz. Ein anderes Bild zeigt zwei große rote Kugeln, dazwischen das Blau eines Sees und ein Stück Himmel. Ein Gemenge von Rosa, Blau und Grün ergibt andernorts eine bunte Landschaft, die aus der Vogelperspektive gemalt scheint.
Ist Letzteres dem Blick aus dem Flugzeug zuzuschreiben, wo wir ihm einen Fensterplatz besorgten, wenn wir mit ihm eine Reise nach Süden wagten? Zu seinem 30. Geburtstag schenkten wir Dan dieses Abenteuer zum ersten Mal. Seither ist Fliegen, zumal das nicht allzu oft vorkommt, für ihn das Größte. Dabei fragten wir uns anfangs, ob er nicht Angst bekommen und sich weigern würde, die frühzeitig gebuchte Maschine zu besteigen. Zwar sah er die Flugzeuge ständig hoch über unserem Wohnhaus, aber woher sollte er wissen, dass darin Menschen saßen. Deshalb fuhren wir vor unserem ersten Flug mit Dan nach Tegel und zeigten ihm von der Aussichtsplattform aus das Treiben auf dem Platz: das Heranrollen der Gangway, das Einsteigen und Aussteigen der Passagiere, den Koffertransport, den Start und die Landung der großen metallenen Vögel. Er nahm alles aufmerksam zur Kenntnis und war später kein bisschen unruhig, als es ernst wurde. Auch Serpentinenfahrten mit dem Bus zum Großglockner oder die Seilbahn zur Zugspitze genoss er sichtlich. Manche Wälder auf seinen Bildern könnten aus dieser Sicht gemalt sein. Sein langanhaltendes Staunen beim Blick in die Tiefe gibt jedenfalls Anlass zu derlei Vermutungen.
Genug der Abschweifungen – andere, offenbar fröhlich bemalte Zeichenblätter zeigen eine Art roter und blauer Gitter, Zinken, die ineinander greifen, irgendwie den Blick fesselnd. Eindringlich auch der Flammenball mit seinen hellen und dunklen Schattierungen, das ganze Blatt ausfüllend, ein purpurner Feuerwirbel, der sich schneller und schneller dreht, ein Tornado, der alles mit sich fortreißt.
Klar, das ist Interpretation. Dan kennt solche Begriffe nicht, er würde sich wundern, wenn er das hier lesen könnte. Und doch: Es geschieht etwas im Kopf des „Sprachlosen“. Bilder formen sich, beginnen zu leben. Die Farben finden zueinander, nicht nur der bunten Drucke wegen, die ihm Frau D., eine ausgebildete Kunsterzieherin und spätere Leiterin des Malzirkels, manchmal zeigt, um die Fantasie anzuregen, sondern auch, weil er die Welt ja nicht in Schwarz und Weiß sieht. Da ist das Grün der Gärten vor unseren Fenstern und rings um sein Zuhause im Wohnheim, da ist der blaue, orangene, lila dräuende Himmel mit dem Feuerball der Sonne abends, der wirbelnde Wind auf der Straße, hell oder dunkel bei Regen und Sturm. Als Dan noch ein Kind war, brauchten wir keinen Wetterbericht. Schon Tage vorher zeigte er durch seine Unruhe und innere Verspanntheit jedes nahende Tief an.
Langsam mischen sich Gegenstände und Gestalten ins Bild. Bäume, Häuser, Vögel … Was ist das für ein Geist, was für ein sonderbarer Geselle, der mit langen Armen die Dinge zu umfangen und an sich zu ziehen scheint? Warum hängt der Reiter vorn am Hals des klotzig-schemenhaft in eine gelbrote Wüstenlandschaft verbannten Pferdes? Manches ist hingehuscht, hingekrakelt, nicht die Handschrift eines Künstlers, der mit expressionistischen Figuren verblüffen will, sondern die Sprache eines Menschen, der auch als Erwachsener noch kindlich fühlt und denkt. Ohne den Anspruch, Kunst zu fabrizieren! Der sich aber dennoch von den Farben inspirieren lässt und somit ganz Erstaunliches zustandebringt.“
Und wie am Anfang dieses Newsletters bereits angekündigt, folgt hier noch ein weiteres Angebot zum Supersonderpreis von nur 99 Cents. Noch fast druckfrisch ist der Titel „Die Germanen von Piowar“ von Dagmar Bulmann – ebenfalls eine Eigenproduktion der EDITION digital aus Pinnow (oder auf Germanisch Piowar): Im Jahr 18 unserer Zeitrechnung muss Aldemar in einem kleinen germanischen Dorf die Kriegerweihe abbrechen, weil er fast erstickt wäre. Er ahnt lange nicht, welche Rolle sein Bruder Ekwin dabei gespielt hat. Seit diesem Tag wird er nicht nur von seinem Vater, sondern vom ganzen Dorf verachtet. Weil seine Ehre beschmutzt ist, will er nicht mehr in Piowar leben. Aldemar flieht gemeinsam mit seinen Freunden, die sich ebenfalls nicht von ihren Vätern verstanden fühlen und das Abenteuer suchen. Ihr Ziel ist Rom, weil ein Händler ihnen von dieser Stadt vorgeschwärmt hat. Im von den Römern besetzten Germanien trennen sich die Wege der Freunde. Aldemar erreicht als Einziger Rom und lebt dort über zehn Jahre. In dieser Stadt erlebt er Verrat und Intrigen, aber auch die Freundschaft mit dem jungen Seneca. Doch dann verliebt er sich in eine außergewöhnliche Frau, bis er auch von dort wieder fliehen muss. Zur selben Zeit passieren in dem kleinen Dorf Piowar merkwürdige Dinge. Der Roman folgt weitestgehend den historischen Tatsachen und zeichnet ein interessantes Bild über das Leben der einfachen Menschen im freien Germanien. Und so geht es los:
„Die Freunde – Im Jahr 18 n. d. Z.
Schrill hallte der Klang der Trommeln aus dem stillen Wald wider. Die Nachmittagssonne blinzelte verschlafen durch die Lücken im Blätterdach der Bäume, denn die nächsten dicken Regenwolken zogen bereits heran. In einem mit Speeren abgesteckten Halbkreis tanzten die Jungmänner. Die an Armen und Beinen befestigten Klappern und Rasseln erklangen im Rhythmus der Bewegungen. Mit dem zunehmenden Tempo der Trommeln beschleunigte sich auch der Tanz der Jungmänner. Immer schneller stampften und drehten sie sich im Kreis und immer unheimlicher klangen die Töne, die sie erzeugten. Nach einer ganzen Weile war der Tanz so laut und so schnell, dass er sich nicht weiter steigern ließ. Über die nackten Oberkörper perlte der Schweiß und glänzte in der Sonne.
Mit einer Handbewegung gebot der Oberpriester den Spielern aufzuhören. Schlagartig verstummten die Trommeln und die Jungmänner verharrten in der Position, in der sie sich gerade befanden. Mit einem Mal war es gespenstisch still auf der Waldlichtung. Die erwachsenen Krieger knieten hinter den Speeren nieder und baten um das Wohlwollen ihres obersten Gottes.
„Wodan, Gott der Krieger und der Ekstase, die hier versammelten Jungmänner sind bereit für die Kriegerweihe“, begann der Priester seine Beschwörung. „Sie werden jetzt an Donars Baum hängen, so wie du einst neun Nächte am Weltenbaum gehangen hast, vom Speer verwundet, dir selbst geweiht ohne Speise und Trank, um die unendliche Weisheit zu erlangen. Oh, Wodan, gib ihnen die Kraft, den Schmerzen zu widerstehen und sich deiner würdig zu erweisen.“
Jeder Jüngling wurde von einem Mentor zu einem Baum geführt, von dem bereits ein Seil herabhing. Einige waren vom Tanz noch so weit entrückt, dass sie keine Gefühlsregung zeigten. Trotzdem gab jetzt jeder Mentor seinem Schützling einen Trank, von dem niemand verriet, was er wirklich enthielt. Doch wurden die Jungmänner dadurch ruhiger und schmerzunempfindlicher. Beim Anblick des Seiles und der im Feuer liegenden Spitzen der Framen, die bereits zu glühen begannen, durchlief Aldemar ein Schauer. Er begann zu zittern und je mehr Mühe er sich auch gab, es zu verbergen, umso heftiger wurde es. Er versuchte einen Blick auf seine Freunde Roland und Isbert zu erhaschen, doch die schienen nicht wahrzunehmen, was um sie herum geschah. Er versuchte sich zu beruhigen, doch es wollte ihm nicht gelingen. Dann kam sein älterer Bruder Ekwin, der sein Fürsprecher und Mentor war und legte ihm die Schlinge um den Hals. Verwundert blickte Aldemar seinen Bruder an. Warum gab der ihm nicht auch endlich den Trank, den seine Mutter extra für dieses Ereignis gebraut hatte? Da es den Jungmännern verboten war zu reden, stupste Aldemar seinen Bruder mit dem Fuß an. Doch der wich seinem Blick aus, was Aldemars aufkeimende Panik noch vergrößerte. Schließlich gab es jedes Jahr junge Männer, die das Ritual nicht überlebten! Gerade wollte Aldemar seinen Bruder noch einmal anstoßen, als der Priester das Zeichen gab, mit dem Hängen zu beginnen.
„Ich bin noch nicht so weit“, wollte er schreien, aber das wäre das Ende für ihn gewesen. Es kam natürlich nicht in Frage, diese heilige Handlung zu stören. Er musste sich endlich zusammenreißen, dann würde er es schon überstehen.
Die Schlinge um seinen Hals wurde enger und enger. Manch einer wurde bewusstlos, während er in die Höhe gezogen wurde. Aldemar merkte noch, dass seine Beine nicht mehr die Erde berührten. In dieser Position mussten die Jungmänner die Speermarkung über sich ergehen lassen. Dabei wurde ihnen mit einer im Feuer erhitzten Frame ein Schnitt von der Größe einer Hand in die Brust geritzt, bis das Blut zu Boden tropfte. Isbert und Roland stöhnten leise. Aldemar konnte nicht mehr atmen und nicht mehr schlucken. Die Beklemmung ergriff den ganzen Körper. Im Kopf begann es erst zu summen und dann zu hämmern. Er konnte nicht mehr klar denken, wollte nur noch Luft holen, aber das ging nicht mehr. Gierig riss er den Mund auf, aber keine Luft strömte in die Lungen. Als der Druck unerträglich wurde, glaubte er, seinen Körper zu verlassen, wobei er sich selbst am Baum baumeln sah. Die Anspannung wich einer fernen Leichtigkeit, bis der brennende Schmerz und der Gestank von verbranntem Fleisch, den der glühende Speer in seinem Körper hinterließ, ihn wieder zurückholte. Aldemar wurde von Panik ergriffen, denn jetzt wurde ihm wieder bewusst, dass er keine Luft bekam. Ich sterbe, dachte er, die lassen mich einfach sterben. Die Angst ließ ihn alle Vorsätze vergessen, er wollte nicht sterben. Wild zappelnd befreite er seine gefesselten Hände, um die Schlinge um seinen Hals zu lockern. In diesem Moment ließ sein Bruder Ekwin das Seil los, bis er zu Boden stürzte. Er hatte die Probe nicht bestanden.
Die beiden Freunde saßen schweigend am Ufer des Piowaer Sees. Aldemar und Roland hatten sich von zu Hause fortgeschlichen, um Pläne für die Zukunft zu schmieden. Nun warteten sie auf Isbert, der immer etwas ängstlich war und sich vermutlich nicht traute, so einfach von zu Hause zu verschwinden. Dabei war die Erntezeit vorbei und auf den Höfen war die schwerste Arbeit verrichtet. Die Tage wurden schon merklich kürzer und empfindlich kühl.
Die Glitzerstunde war hereingebrochen und tausend Sterne schienen auf dem Wasser zu tanzen. Die Jungen saßen auf einer umgestürzten Weide und ließen die Beine herunterbaumeln, ohne dass sie nass wurden. Sie beobachteten die Fische, die unbeschwert durch das glasklare Wasser glitten. Der Wind kräuselte die Wellen, die in goldenen Schlangenlinien den Seegrund streichelten. Ein Entenpaar schwamm vorbei, änderte den Kurs und steuerte auf sie zu, um dann doch im Schilf zu verschwinden. Sie hielten inne und lauschten, ob in der Stille der herannahende Freund zu hören war.
Unberührt dehnte sich die vom Wald eingerahmte Lichtung vor ihnen aus. Der Tau perlte noch immer in den Spinnweben über dem Gras und an den Büschen, deren Blätter sich langsam zu verfärben begannen. Von weit aus den Tiefen des heiligen Haines hörte man Hundegekläff und den Brunftschrei eines Hirsches.
Am Himmel bildete sich eine Wolkenformation, die aussah wie eine Bärentatze.
„Sieh mal“, ängstlich zeigte Roland mit dem Finger in Richtung Himmel. „Das ist ein schlechtes Omen, wir sollten uns das alles noch einmal überlegen.“
„Quatsch, das sind nur Wolken, sonst nichts!“, entgegnete Aldemar. „Wenn wir uns davon schon abschrecken lassen wollen, brauchen wir gar nicht erst aufbrechen. Auf uns warten noch ganz andere Abenteuer.“
„Ich weiß nicht recht, vielleicht senden uns die Götter ein Zeichen, eine Warnung“, antwortete Roland und seine Stimme klang besorgt.
Im Dickicht, hinter der Lichtung, raschelte es und man hörte das Knacken von kleinen Ästen, die unter den Fußtritten einer sich eilig fortbewegenden Person zerbrachen.
„Na endlich, das wird Isbert sein, der alte Hasenfuß.“ Aldemar war froh, von dem Thema abgelenkt zu werden.
Doch zum Vorschein kam Gotmar, ein hochgewachsener, etwas schlaksig wirkender Jüngling, der genauso scharfsinnig war, wie er anmaßend auftrat, weil er sich etwas darauf einbildete, dass sein Vater der reichste Bauer im Dorf war. Schon sein Name, der „bei den Göttern Berühmte“ bedeutete, sollte auf die Stellung der Familie im Dorf hinweisen. Während die beiden anderen jungen Männer um diese Jahreszeit noch barfuß liefen, um die Stiefel für den Winter zu schonen, bedeckten Gotmars Füße nicht nur lederne Schuhe, die mit Riemen über der enganliegenden Hose um die Waden gebunden waren, sondern er trug über seinem Kittel auch noch eine Weste und einen Gürtel aus Schweinsleder, an dem ein mächtiger Dolch hing. Um zu zeigen, wie erfolgreich er bereits bei der Jagd gewesen war, trug er protzig den Zahn eines Ebers an einem Band um den Hals. Gotmar war zwei Winter älter als die Jungmänner und fühlte sich ihnen gegenüber überlegen.
Aldemar und Roland sahen sich entgeistert an und sagten wie aus einem Mund: „Du?“ Aldemar fuhr fort: „Was machst du denn hier und woher wusstest du, dass wir uns hier treffen?“
„Man muss schon der Dorftrottel sein, um nicht zu bemerken, dass ihr drei was vorhabt“, antwortete Gotmar.
„Schon seit dem letzten Vollmond, als ihr durch das heilige Ritual zu den Kriegern Wodans geworden seid und endlich in den Männerbund aufgenommen wurdet, war mir klar, dass ihr nicht, wie eure Väter, brave Bauern werden wollt. Da unsere Sippe schon seit unzähligen Monden keinen Krieg mehr geführt hat, ist nicht davon auszugehen, dass es in nächster Zeit für uns eine Möglichkeit geben wird, uns im Kampf zu erproben. Deshalb wollt ihr fortgehen, stimmt´s?“
„Ja!“
„Nein!“
„Na, was denn nun?“, erkundigte sich Gotmar mit einem Ton, der die beiden Freunde aufhorchen ließ.
Sie wussten, dass Gotmar ein Hitzkopf war, und deshalb hatten sie ihn auch nicht in ihre Pläne eingeweiht. Jemand brauchte nur ein falsches Wort zu sagen und schon schlug er zu. Seine Nase war von den vielen Raufereien schief zusammengewachsen und gab seinem Gesicht ein markantes Aussehen, was durch seine wilden, struppigen Haare noch verstärkt wurde.
Bevor Aldemar und Roland antworten konnten, war ganz leise, und von allen unbemerkt, Isbert aufgetaucht.
„T-tu-tu-ut m-mi-ir l-lei-eid“, stotterte Isbert. Er war nur mit knielangen Hosen und einem Hemd aus grobgewebtem Stoff bekleidet, unter dem sich ein leichter Rundrücken abzeichnete. Da stand er mit herabhängenden Schultern und mit zu einem Schwanz gebundenem Haar, aber mit einer aufrichtigen Seele. Wegen seines Sprachfehlers traute er sich kaum, an den hitzigen Diskussionen seiner Freunde teilzunehmen. Weil es ewig dauerte, bis er in der Lage war, einen Satz zu vollenden, antworteten die anderen schon, bevor sich die Worte von seiner holprigen Zunge in den Raum bewegten. Aldemar war der einzige, der geduldig wartete, bis seine Worte bei ihm angekommen waren.
Isbert schien etwas zu beunruhigen und das war nicht die unerwartete Gegenwart von Gotmar. Aufgeregt zeigte auch er zum Himmel, an dem die Bärentatze noch deutlich zu erkennen war, obwohl sie sich allmählich zu verzerren begann.
„W-Wo-da-an d-dr-o-oht u-un-ns, g-gl-lau-bt m-mi-ir!“
„Für unser Unternehmen brauchen wir Männer und keine Memmen. Geh zu deiner Mama und versteck dich hinter ihren Röcken“, ergriff Gotmar das Wort und verzog dabei den Mund zu einem spöttischen Grinsen.
„Was heißt hier unser Unternehmen“, fauchte Aldemar ihn an und begann vom Baumstamm zu klettern. Roland folgte ihm und wechselte einen besorgten Blick mit Isbert, dann sagte er:
„Isbert hat Recht, ich halte es auch für eine Vorwarnung. Wir dürfen nicht gegen die Sitten unseres Stammes verstoßen und gegen den Willen unserer Väter handeln. Wir müssen die Alten achten, weil sie heute sind, was wir morgen sein werden. Deshalb dürfen wir uns nicht heimlich davonschleichen. Die Götter haben uns eindeutige Zeichen gesandt.“
„Welcher Dämon hat denn deinen Verstand verwirrt“, konterte Gotmar in einem aggressiven Ton. Er hatte in seinem kurzen Leben bereits die Erfahrung gemacht, dass man mit Stärke alles erreichen kann. Die Mutproben, die die Jungmänner vor Kurzem bestehen mussten, um in den Kreis der Krieger aufgenommen zu werden, hatte er als Bester bestanden.
Genau dieses Ritual war Aldemar zum Verhängnis geworden. Aldemar zählte fünfzehn Winter und war der Sohn des Sippenältesten Notker, ein gut gewachsener junger Mann, mit blondem Haar. Die ersten Bartstoppeln wucherten bei ihm, im Gegensatz zu Roland, wie Unkraut, was ihm auch den Spitznamen Krautgesicht einbrachte. Doch darauf war Aldemar eher stolz, als dass es ihn ärgerte.
Durch Gotmars Auftreten wurde Aldemar das Zerwürfnis mit seinem Vater wieder vor Augen gehalten. Früher hatte er sich mit seinem Vater stets gut verstanden. Stundenlang tauschten sie sich über Geschehnisse im Dorf aus und darüber, wie Recht zu sprechen war, während sein älterer Bruder Ekwin scheinbar kein Interesse an diesen Dingen hatte. Aldemar glaubte, dass sein Vater ihn für den geeigneteren Nachfolger hielt und er irgendwann einmal der neue Sippenälteste werden würde. Doch dann geschah die Katastrophe. Als die acht Jünglinge des Dorfes, die die Geschlechtsreife erreicht hatten, ihre Waffenfähigkeit beweisen mussten, war er gescheitert. Er war der Versager, der, der es nicht schaffte durchzuhalten, was vor ihm Generationen von Jungmännern durchlebt hatten, und das konnte ihm sein Vater nicht verzeihen. Und er verstand bis heute nicht, warum ausgerechnet er gescheitert war, während selbst der ängstliche Isbert die Probe bestanden hatte.
Doch dann folgte etwas, was für Aldemar noch schlimmer war als die Jungmännerprobe. Sein Vater verachtete ihn, konnte die Enttäuschung nicht verkraften und so entschied er, dass Ekwin nach seinem Tod neuer Sippenältester werden sollte. Aldemar versuchte mit seinem Vater zu reden, doch es half nichts, der blieb hart.
„Du hast große Schmach über unsere Familie gebracht und unsere Ehre beschmutzt. Jeder andere hätte die Probe abbrechen können, aber nicht du. Wie konntest du mir so etwas antun?“, warf Notker seinem Sohn an den Kopf.
„Aber Vater, ich wäre erstickt, so wie Albin vor ein paar Jahren, ich hatte keine Wahl!“, rief Aldemar verzweifelt.
„Das wäre wenigstens ein ehrenvoller Tod gewesen. Sogar deine beiden Freunde Roland und Isbert, diese Schlappschwänze, diese winselnden Ratten, haben es durchgehalten. Du warst der einzige Versager von acht Jungmännern.“
„Meine Freunde hatten zu große Angst vor den Folgen, sie wären lieber in den Tod gegangen.“
„Das hättest du auch tun sollen, statt dich vor dem ganzen Dorf zu bepissen. Alle haben deine nasse Hose gesehen. Wie konntest du es wagen, nicht nach Wodans Gesetz zu handeln? So kannst du nicht mein Nachfolger werden, du kannst nicht einmal mehr mein Sohn sein.“
„Aber Vater, du bist doch immer stolz auf mich gewesen, ich habe doch nur dieses eine Mal versagt. Beim nächsten Mal halte ich es durch, ich verspreche es.“
Doch Notker beachtete ihn nicht mehr, nicht an diesem und nicht an den folgenden Tagen. Aldemar konnte den Gesichtsausdruck seines Vaters nicht mehr ertragen, diesen Blick, der durch ihn hindurch ging und nichts als Verachtung beherbergte. Egal, was Aldemar seinen Vater fragte oder zu ihm sagte, er erhielt keine Antwort von ihm. Aldemar existierte für ihn nicht mehr.
Nun gab es für Aldemar kein erstrebenswertes Ziel mehr, in seinem Dorf zu bleiben. Die Verachtung der Männer aus dem Dorf lastete auf ihm wie ein Haus auf seinen Pfählen. Seine Zukunft war gestorben und er bereute schon, nicht mit ihr gestorben zu sein. Ein ehrloses Leben war schlimmer als Schimmel auf dem letzten Stück Brot, deshalb musste er fortgehen.“
So geschah es dem jungen Germanen Aldemar, und aus diesem traurigen Anfang entwickelt sich eine höchst abenteuerliche Geschichte, während der der Jugendliche sogar bis nach Rom kommt und viel Aufregendes erlebt. Und ob er wohl jemals wieder zurückkommt nach Piowar?
Aber auch die anderen vier Deals des heutigen Newsletters laden dazu ein, sie sich näher anzusehen und den darin erzählten Geschichten zu folgen – sei es, um sich mit Georg Büchner und den beiden deutschen Staaten zu beschäftigen, mit kosmischen Ausflügen oder kriminellen Machenschaften im noch geteilten Berlin oder mit einer ganz besonderen Form von Hoffnung und Menschlichkeit.
Viel Spaß beim Lesen, weiter einen schönen Mai, auch wenn es zumindest im Moment immer noch kein richtiges Sommerwetter gibt, und bis demnächst.
EDITION digital wurde vor 25 Jahren von Gisela und Sören Pekrul gegründet und gibt Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, derzeit fast 1.000 Titel (Stand Mai 2019).
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de