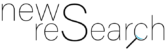Davor aber kommen weitere fünf Empfehlungen zum Sieben-Tage-Sonderpreis und zwar zwei von Erik Neutsch und drei von Joachim Nowotny: In „Tage unseres Lebens“ fragt Erik Neutsch nach Tradition und Innovation, nach dem menschlichen Maß von Veränderungen.
Konfliktreich wie immer geht es auch in einem anderen der frühen Bücher von Neutsch zu – „Die Regengeschichte“ setzt sich mit dem Begriff „sozialistische Gemeinschaftsarbeit“ auseinander und fragt, was das eigentlich bedeuten sollte.
In „Hochwasser im Dorf“ von Joachim Nowotny geht es um viel mehr als nur um Hochwasser im Dorf.
Winzige Begebenheiten sind der literarische Ausgangspunkt für den Band „Labyrinth ohne Schrecken“ von Joachim Nowotny.
„Schäfers Stunde“, der dritte der drei Titel von Joachim Nowotny, lädt zu ganz unterschiedlichen Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen ein.
Und jetzt zurück zum Anfang, nicht zu vergessen das empfehlenswerte Weihnachtsbuch von Lutz Dettmann. Zunächst aber hat Erik Neutsch den Vortritt:
Erstmals 1973 erschien im Reclam Verlag Leipzig – der DDR-Hälfte des traditionsreichen Editionshauses – „Tage unseres Lebens“ von Erik Neutsch: Ein Mädchen ist verschwunden, Oberschülerin, Tochter eines Straßenbahnfahrers – Brüdering lässt dieses Mädchen suchen. Dabei sollte man meinen, dass ein Oberbürgermeister andere Sorgen hat in diesen drei Tagen unseres Lebens: Konz ist gekommen, der neue Parteisekretär. Er will durchsetzen, was der OB für undurchführbar hält: Schneisen hauen quer durch die Stadt, die in Jahrhunderten gewachsen ist und angefüllt mit Menschenschicksalen, Verkehrsadern schlagen quer durch Häuser und Wohnungen und Plätze. Eine Stadt ist kein Wald. Man kann nicht mit einem Federstrich ausstreichen, was Generationen geschaffen haben. Gibt es einen anderen Weg als den der Feindschaft zwischen den Genossen Brüdering und Konz? Und dann fragt sich einer, was die wahren Geschichten hierzulande sind. Aber gehen wir hübsch der Reihe nach und beginnen wir mit dem Anfang:
„ERSTER TAG
„Die Stadt muß verändert werden“, sagte Konz. „Ich wüßte nicht, weshalb ich hierhergeschickt worden bin, wenn die Stadt nicht verändert wird.“
Der hat klug reden, dachte ich, eine Woche ist er nun hier, nicht einmal eine Woche, seit Montag erst, heute ist Freitag, und schon nimmt er den Mund voll, spielt sich auf, und eigentlich will er mir nur beweisen, mit jedem seiner gesalbten, gepfefferten Worte, daß ich ersetzbar bin, auswechselbar, wenn nicht gar fehl am Platze. Ich sollte ihm den Gefallen tun und abdanken. Kurzen Prozeß sollte ich machen, aufstehen, durch die Tür gehen und abdanken. Ich bin nicht der Mann, der sich seine Papiere in Raten auszahlen läßt. Ich pfeif auf die Blumen. Wenn ich nicht mehr von Nutzen bin, wenn ich nach deiner Ansicht, Konz, die Zeichen der Zeit nicht mehr begreife, bitte, sag es. Grabstein, und darauf eine Inschrift: Er fiel im Frieden. Das wäre ehrlich. Doch nun?
Die Sitzung dauerte seit dem Morgen. Einen Schluck Kaffee, Konz ging durch alle Zimmer, und dann begann sie. Jetzt leuchtete schräg schon die Abendsonne in alle Fenster, übergoß den Raum mit einem rosigen Licht, spiegelte sich auf den Brillengläsern von Konz, bedeckte sie mit einer silbrigen Folie, so daß man nicht mehr erkennen konnte, wen er gerade mit seinen Blicken aufs Korn nahm, und außerdem hatte er eine verdammte, ich möchte sagen: beinahe ehrenrührige Art, unsere Geduld auf die Probe zu stellen. Sprich es doch aus, Konz. Mach ein Ende. Ich bin mürbe inzwischen wie ein Hefeteig, auf dem einer stundenlang herumgeknetet hat. Deine Beweisketten. Deine Rechnerei mit jedem Kubikmeter Erde. Was werden denn unsere Frauen sagen? Wie wird mich Herta empfangen, wenn es wiederum Nacht wird, bevor ich nach Hause komme?
Konz hat keine Frau. Der ist vierzig oder erst fünfunddreißig, jung, glaube ich, und das genügt ihm, um mal hier und mal dort…
„Natürlich schaffen wir’s nur, wenn alle an einem Strang ziehen“, unterbrach er meine Gedanken. „Allein ist der Tod. Also, Genossen, macht es der Partei nicht zu schwer.“
Ich meldete mich zu Wort. Er übersah mich nicht, und ich sagte: „Seit zwanzig Jahren lebe ich hier. Seit zehn Jahren bin ich Bürgermeister dieser Stadt. Sie ist nicht zu verändern. Das Alte ist nur zu verschönern.“
Konz erwiderte: „Ich hoffe, Genosse Brüdering, du kennst den Unterschied genau zwischen alt und neu. Ich weiß nicht, ob das Neue auch immer schön ist. Aber notwendig ist es. Schön ist keine Alternative zu alt. Neu jedoch, das trifft.“
Es war seit seiner Ankunft kein Tag vergangen, an dem er uns nicht mit solchen oder ähnlichen Philosophien attackierte. Immer hielt er ein Spruchband bereit, wenngleich mich oft, ich muß es gestehen, der Text darauf überraschte. Woher nahm Konz seine Sicherheit? Ich dachte darüber noch nach, als ich bereits auf dem Nachhauseweg war. Nein, an diesem Tage war die Entscheidung noch nicht gefallen. Morgen würden wir weitersehen. Weiter und klarer. Für morgen hatte Konz die Ingenieure und Architekten eingeladen. Die Stadt muß verändert werden. Er nannte seit seiner Antrittsrede das Was. Und alle anderen wollte er darauf trimmen, ihm das Wie zu liefern. Doch ohne mich, mein Freund. Trotz der Sonne auf deinen Brillengläsern konntest du deine Augen vor mir nicht verstecken. Ich saß an deiner Seite. Ich sah dir in die Pupillen. Eine Farbe hat deine Iris, grau und kalt wie die Pfennigstücke. Vielleicht rührt es nur daher, von diesem Grau, daß jeder deiner Blicke eine Rechnung aufzumachen scheint. Denn nichts anderes an dir, die abstehenden Ohren nicht unter den blonden Haarfransen, die vollen Lippen mit den schiefgewachsenen Zähnen dahinter, die runden Wangen nicht und das wenig energische Kinn, nichts ist an dir so sachlich wie deine Augen. Wäre die graue Sachlichkeit deiner Augen nicht, hätte sogar dein Gesicht, möchte ich meinen, etwas einnehmend, anziehend Lustiges.
Ich nahm die Bahn. Ich kenne den Fahrer. Wenn er Nachtschicht hat, bin ich manchmal sein letzter Begleiter, fährt er nur meinetwegen bis an die Endhaltestelle in Staubnitz. Dann kommen wir ins Gespräch. Zehn Minuten, nicht länger. Doch über zehn Jahre nun schon, im Schnitt zehn Minuten je Woche, das reicht, um einen anderen Menschen kennenzulernen. Über den Austausch von Höflichkeitsfloskeln sind wir hinaus. Und so verspürte ich denn auch nach dieser Sitzung das Bedürfnis, mit ihm zu sprechen. Ich weiß, daß er in der Großen Leipziger wohnt. Zwei Zimmer, vier Kinder, fünfhundert Mark im Monat, seine Frau, Austrägerin für die Nachmittagspost, winters wie sommers auf einem Fahrrad, verdient noch ein bißchen dazu. Sind sie glücklich? Ich frag es mich jedesmal. Wenn es nach Konz ginge, würde die Große Leipziger fallen. Er stand heute früh vor der Karte und entwarf seinen Plan. Die neue Nord-Süd-Achse legte er quer durch die Stadt. Kein Pardon für das Zentrum. Aufreißen, Abbruch, Rekonstruktion. Wir hatten die Straße bisher außen herum, durch die versumpften und sauren Wiesen der Saale führen wollen. Die Stadt ist tausend Jahre alt. Fünfmal, berichten die Urkunden, brannte sie nieder. Im Krieg allerdings, und bis heute weiß niemand, warum, blieb sie verschont. So ziemlich verschont. Und jetzt?
Konz steht vor der Stadt wie Tilly und will sie zum sechsten Mal in den Erdboden äschern. Ich mußte erfahren, was Paul dazu sagt, der Straßenbahnfahrer. Zehn Minuten am Park entlang bis zur Endhaltestelle. Die Hyazinthen werden schon in den Perron hinein duften. Und wenn’s nicht genügt, so helfe ich ihm beim Rangieren.
Eine Antwort auf eine Frage. Ich lebe bei Gott nicht so schlecht, als daß ich mir nicht auch was leisten könnte, sagt Seidensticker. Fernseher und Kühlschrank, wenn’s Dinge sind, woran sich der Mensch heute mißt, die hab ich. Auch ein Paar Schuhe jährlich fallen für jeden ab, ein Anzug für mich und ’n Kleid für die Frau und die Tochter zu Weihnachten und zum Geburtstag. Nur, Bürgermeister, du müßtest mehr Kindergärten errichten. Dann könnte Ellen ganztags zur Post gehen. Hundertundfünfzig mehr, auf die hohe Kante, man könnte auch mal wieder ein Möbelstück kaufen, neue Matratzen und Bettbezüge, auch ’n Bier trinken, nach Feierabend, versteht sich. Die Große sind wir bald los. Sie macht jetzt ihr Abitur. Doch was dann? Sie liegt uns nicht mehr auf der Tasche, gut. Das ist das eine. Bisher aber hat sie nachmittags immer, zwischen Shakespeare und Mathematik, kenn mich darin nicht aus, unseren Jüngsten betreut. Die FDJ wird schon böse, weil sie nicht hingehen kann, und manch einen gibt’s, Söhnchen von einem Arzt oder einem Direktor oder was sonst aus einer verwöhnten Familie, der sie hänselt. Die fahren schon in die Schule mit eigenem Roller. Sie aber sitzt zu Hause, weil einer auf den Kleinsten aufpassen muß. Und dann lernt sie, wird soviel verlangt heutzutage, und dann geht das große Gejammer los. Bürgermeister, bau einen Kindergarten in der Leipziger. Uns allen wäre geholfen, auch dem Mädchen…
Doch Konz erklärte am Morgen, daß an Kindergärten demnächst nicht zu denken ist. Die Stadt braucht einen Aufbruch. Durchbrüche braucht sie von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. Anschlüsse an die Autobahnen. Das frißt Geld, gewiß. Aber wenn wir uns heute dazu nicht entschließen, sagt Konz, zahlen wir morgen das Doppelte, wird es sich rächen in fünfzehn Jahren, noch im Prognosezeitraum. Paul Seidensticker, begreifst du das? Auch dein Bürgermeister wird im Beton vergraben. Ich hab mich gewehrt. Das Alte läßt sich nur verschönern. Bau eine neue Stadt, Konz, draußen, nach Wolfen und Bitterfeld zu, vor den Toren, wo die Erde so flach und so breit ist wie der Himmel darüber. Dort hast du Platz. Dort kannst du wirtschaften aus dem vollen. Und vielleicht springt sogar noch etwas heraus dabei für den Fahrer der Linie sieben.“
Erstmals bereits 1960 hatte Erik Neutsch im Mitteldeutschen Verlag Halle (Saale) „Die Regengeschichte“ herausgebracht: Nachdem der erfahrene Betriebsleiter der Chlorfabrik klammheimlich die DDR verlassen hat, wird der junge Wissenschaftler Dr. Bellmann, der keine Praxiserfahrung besitzt, an seine Stelle gesetzt. Nachdem ein Arbeiter durch eigenes Verschulden tödlich verunglückt, wiegelt Meister Kelle, der in der Fabrik alt geworden ist, seine Arbeiter gegen den jungen Chef auf und fordert mit einer Unterschriftenaktion seine Absetzung. Nur einer unterschreibt nicht. Josef Urbanczyk, dessen Rat der Betriebsleiter für eine bedeutende technische Verbesserung einholt, schämt sich später seiner Unterschrift. Ehe das Buch mit der eigentlichen Handlung einsetzt, hat der Autor einen „Vorspann“ eingebaut:
„Wir gehen zu Heinrich Kelle. Wir gehen auf Geheiß der Tagschichter aus dem Chlorbetrieb. Sie haben uns gebeten, Heinrich Kelle zu ihrem ersten Brigadeabend einzuladen. Sie schicken Dr. Bellmann, den Betriebsleiter; Josef Urbanczyk, den Anlagefahrer; Fritz Klingbiel, den Nippeleingießer; Günter Glück, den Gewerkschaftsvertrauensmann. Die Mitglieder der Brigade sagten zu ihnen: Wir wollen Heinrich Kelle nicht vergessen; er gehört zu uns, trotz allem. Und sie schicken auch mich, den Parteijournalisten, der zur Zeit bei ihnen arbeitet. Zu mir sagten sie: Geh auch du mit; wenn die anderen ihn nicht überzeugen können, dann redest du.
Unsere Abordnung ist mit dem Omnibus hierhergefahren, hierher in das Städtchen, dessen einstmals rote Dächer wie die Lungen der Bergleute, die hier wohnen, jahrelang den Staub der Tagebaue geatmet haben und nun grau und schwarz aussehen, als litten auch sie an Silikose. Günter Glück führt uns; seit frühester Kindheit kennt er Heinrich Kelle; er wohnt nur zwei Häuser von ihm entfernt. Fritz Klingbiel, breit und dickbäuchig, hat sogar ausnahmsweise sein faltiges Gesicht ausrasiert. Das tut er sonst nur dreimal im Jahr, zum Ersten Mai, zum Tag der Republik und zu seinem Geburtstag. In der übrigen Zeit läßt er unbekümmert die Stoppeln wachsen und schneidet sie nur sonntags mit der Schere ab. Sein Gesicht wurde daher von der plötzlichen Wohltat mächtig erschreckt. Es hat sich über und über mit Schrunden und Kratzern bedeckt, als habe sich eine Katze mit ihm herumgebalgt. Er aber hält es uns stolz entgegen, als wollte er sagen: Seht her, für den Auftrag der Brigade scheue ich nicht die blutigsten Opfer.
Aus zweierlei Gründen wollen die Tagschichter des Chlorbetriebes ihren Brigadeabend feiern. Vor Wochen haben sie sich zusammengeschlossen, um fortan gemeinsam sozialistisch zu arbeiten, zu lernen und zu leben. Und vor einigen Stunden erst wurde die neue Großraumzelle angefahren, das erste Ergebnis gemeinsamer Forschungen von Chemiearbeitern, Schlossern, Elektrikern, Meistern, Konstrukteuren und Chemikern. Die neue Zelle wurde ganz hinten in der weiten Elektrolysehalle aufgebaut, sie überragt wohl über einen guten halben Meter die anderen, nunmehr herkömmlichen Bäder. Ihren Vorfahren ist sie in allem überlegen, sie verfügt über eine doppelt so hohe Stromstärke, ihre einzelnen Glieder sind breiter, wuchtiger, sie schluckt die doppelte Menge an Salzlösung, und natürlich stößt sie auch die doppelte Produktion aus. Der chemische Prozeß freilich vollzieht sich in ihrem Innern wie in all den anderen Zellen, wie diese hat sie ebenfalls die Form einer langgestreckten Zigarrenkiste. Über den Boden gleitet das Quecksilber, das von einem zentnerschweren Motor durch die Wanne gepumpt wird, sich an einem Ende des Bades sammelt, von dort durch eine schmale, verschlossene Rinne, die die Arbeiter Pile nennen, zurückfließt, gereinigt wird und von neuem seinen Kreislauf beginnt. Unterhalb des mächtigen Deckels, der mit fingerdicken Schrauben auf der Wanne befestigt ist, hängen die Graphitplatten. Durch Zufuhr elektrischer Energie wird das Quecksilber zur Kathode und das Graphit oder die Kohle zur Anode. Ein gesonderter Kanal beschickt die Zelle mit Kochsalz, das zuvor in Wasser gelöst wurde. Zwischen Anode und Kathode wird diese Lösung nunmehr elektrolytisch zersetzt, und es entstehen Natronlauge, Wasserstoff und Chlor, sämtlich für die verarbeitende chemische Industrie unentbehrliche Grundstoffe, die in langen Rohren abgeleitet werden.
In diesem Betrieb war Heinrich Kelle einmal Meister, geachtet und gefürchtet zugleich, wie ich erfuhr, bis zur Stunde seiner Niederlage. Jetzt lebt er als Rentner in einem verräucherten Häuschen, einsam und still, wie uns Glück berichtete.
Josef Urbanczyk klopft an die Scheibe, dreimal zaghaft.
„Nicht dort“, sagt Glück. „Das ist die gute Stube. Er wird in der Küche sitzen. Das Fenster daneben.“
Urbanczyk klopft ein zweites Mal, härter.
Wir hören einen Stuhl im Zimmer schurren. Eine knochige Hand verschiebt die Gardine. Hinter dem Glas erscheint ein altes, verhutzeltes Gesicht. Es hat einen Bart, fein gezwirbelt, und Augen, müde in den Höhlen. Ich sehe den Doktor an. Er räuspert sich verlegen. Fritz Klingbiel streicht sich über das glattrasierte Kinn. Das Gesicht hinter der Scheibe ist starr.
Die Hand an der Gardine zittert. Urbanczyk macht Zeichen. Der Mann soll das Fenster öffnen. Doch er rührt sich nicht. Die Augen mustern mißtrauisch Klingbiel, den Doktor, Urbanczyk und Glück. Allmählich scheinen sie die Situation zu erfassen. Ihr Blick ist mehr erstaunt als müde. Die Gardine fällt wieder zurück.
Wir warten. Wir stehen ungewiß. Jemand sagt: „Alt ist er geworden. ..“ Der Doktor flüstert wie zu sich selbst: „Ich glaube, wir sind umsonst gekommen.“
Doch da vernehmen wir schlurfende Schritte. Die Hoftür wird aufgeriegelt. Heinrich Kelle tritt heraus, krumm, gebeugt.
„Mensch, Heinrich“, sagt Urbanczyk. „Du hast dich kaum verändert…“ Seine Stimme soll fröhlich klingen. Aber ich kenne Urbanczyks Stimme und weiß, daß er ihr die Ungezwungenheit aufzwingt.
„Wollt ihr ins Haus?“ fragt Kelle gurgelnd, als sei ihm die Kehle zugeschnürt.
„Uns schickt die Brigade“, sagt Urbanczyk.
„Die Brigade?“
„Wir wollen Sie einladen, Meister, zum Brigadeabend…“, flötet Glück und tritt von einem Bein auf das andere.
„Bei uns hat sich vieles verändert, Herr Kelle“, erklärt der Doktor. „Sie sollten sich einmal ansehen, was wir in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit geschafft haben, die neue Großraumzelle zum Beispiel…“
Der Meister murmelt: „Ich hab schon in der Zeitung gelesen. Und immer nachgegrübelt darüber…“
Nur Klingbiel schweigt. Aber er reicht Kelle die Hand hin. Kelle zögert, schluckt laut, dann schlägt er ein. Schwere Tropfen schwimmen über seine vertrockneten Wangen. Die beiden söhnen sich aus.
Doch jetzt muß ich wohl erzählen, wie die sozialistische Arbeitsgemeinschaft im Chlorbetrieb des Kombinats ihren Anfang nahm, damals, neunzehnhundertsiebenundfünfzig.“
Nur drei Jahre später als „Die Regengeschichte von Neutsch, also 1963, erschien erstmals im Kinderbuchverlag Berlin das spannende Jugendbuch „Hochwasser im Dorf“ von Joachim Nowotny: Heino, der lange Bartel, Brocken-Theo und der kleine Belo langweilen sich in den Winterferien, weil nichts passiert. Den alten Hubein lachen sie aus, weil er vor einem Hochwasser warnt. Der träge dahinfließende Bach überschwemmt zwar die Wiesen, aber die Häuser im Dorf sind nicht betroffen. Doch diesen Winter ist alles anders. Voller Eifer unterstützen die Jungen die Erwachsenen bei der Bekämpfung des Hochwassers. Als das Eis sich staunt und das Sprengkommando keine Zeit hat, hat der lange Bartel eine großartige Idee. Die Erwachsenen finden diese aber gar nicht so gut und verordnen den Jungen Stubenarrest, gerade jetzt, wo das Hochwasser schon das Dorf umschließt. Wird man ihnen die Sache mit dem Karbid nicht endlich verzeihen und ist ihre tatkräftige Hilfe deshalb ganz vergessen? Noch aber ist das Hochwasser entfernt, weit entfernt:
„1. Kapitel
Der lange Bartel ärgert sich über die Ferien und die Stare. Heino träumt von einem gelbbäuchigen Tier. Alle wünschen sich ein großes Unglück Der lange Bartel lässt seine Schultasche einfach fallen.
„Los“, hetzt er, „machen wir Ringkampf! Wer will die Jacke voll haben?“
Wir sehen uns an. Der kleine Belo tritt von einem Bein auf das andere. Dann verdrückt er sich hinter meinem Rücken. Brockentheo aber winkelt die Arme an. Ein Weilchen umkreist er den Hetzer wie ein aufgeplusterter Truthahn. Auf einmal macht er einen Satz nach vorn. Er packt den langen Bartel um den Leib, hebt ihn hoch und lässt ihn dann fallen. Beide wälzen sich auf dem Boden.
„Lass los“, stöhnt der lange Bartel, „ich hab keine Lust.“ Komisch, auf einmal hat er keine Lust mehr.
„Feigling!“, ruft der kleine Belo hinter meinem Rücken.
Nicht einmal das kann den langen Bartel heut erschüttern. Er bleibt ruhig auf dem grauen Februargras sitzen. „Ihr könnt mir’s glauben, Leute“, sagt er, „ich hab einfach zu nichts mehr Lust. Die Sache mit dem Ringkampf war bloß so ein plötzlicher Einfall. Aber sonst? Früher, da hab ich mich gefreut, wenn Ferien waren. Und heute? Was soll man mit den vierzehn Tagen anfangen, frag ich euch. Im Sommer, ja, da stellen sie sich auf den Kopf, bloß um uns zu beschäftigen. Ferienlager, Fahrten und Geländespiele, alles wird organisiert. Aber wer kümmert sich jetzt um uns? Niemand.“
Wir hocken uns neben ihn. Recht hat er. Diese Ferien im Februar sind großer Quatsch. Schnee liegt nicht mehr. Und das Eis auf dem Mühlteich ist weich wie nasse Pappe. Man kann sich nicht mehr drauf wagen. Im Walde herumzustromern macht auch keinen Spaß. Alles ist dort nass und klebrig. Was soll man also tun?
„Man müsste …“, sagt Brocken-Theo, „man müsste …“ Er weiß auch nicht, was man müsste. Theo schnippst mit den Fingern. So macht er es immer, wenn er beim Gedichtaufsagen nicht weiter kann.
„Mensch, die Stare“, sagt der kleine Belo plötzlich. Er zeigt mit seinem roten Zeigefinger auf eine Weide, die am Graben steht.
Tatsächlich, dort sitzen die ersten Stare. Sie haben ihr Federkleid dick aufgeblasen. Aus ihren gelben Schnäbeln quetschen sie quengelnde Töne heraus. Dann hocken sie wieder stumm und trübsinnig beieinander und horchen in die Welt. Aber da ist noch niemand aus der Vogelschar, der ihnen was vorpfeifen könnte. Also können sie auch nichts nachpfeifen. Von selbst fällt den Staren keine Melodie ein. Das wissen wir längst.
Der lange Bartel starrt ein Weilchen zu der Weide hinüber. Dann sagt er: „Langweilig, die Biester. Sitzen zusammen wie die alten Weiber beim Federnschleißen.“ Damit sind die Stare für uns erledigt. Was der lange Bartel sagt, das gilt.
Ich sehe mich um. Hinter meinem Rücken liegt das große Dorf. Es heißt Reicha. Dort gibt es den Bahnhof, die Post, das Gemeindeamt und die Schule. Vor mir kann ich in der Ferne ein paar Häuser erkennen. Sie gehören zu unserem kleinen Dorf. Wir sitzen mitten auf der großen grauen Wiese, die zwischen den beiden Ortschaften liegt.
Immer wenn wir aus der Schule kommen, machen wir an dieser Stelle halt. Hier entscheiden wir, welchen Weg wir wählen: Entweder gehen wir auf dem Dammweg, der kurz vor unserem Dorf eine Spitze des großen Kiefernwaldes durchschneidet, oder einfach quer über die Wiese. Das ist der kürzeste Weg. Aber es gibt noch eine Möglichkeit. Auf der Südseite wird die Wiese von einem Graben begrenzt. Am liebsten würden wir immer am Grabenrand entlang spazieren. Aber das ist verboten. Keiner weiß weshalb. Es ist einfach verboten, und fertig. Dabei gibt es in den Dämmen, die das Wasser von der Wiese trennen, Bisamratten. Tatsache. Wir haben sie schon mehrmals beobachtet.
Der lange Bartel rappelt sich plötzlich auf. Mit einem Ruck haut er sich die Schultasche über den Kopf auf den Rücken. „Los“, sagt er, „wir gehen am Graben lang.“
Keiner hat etwas dagegen. Heut ist schließlich der letzte Schultag. Und wenn sie schon sonst nichts mit uns anstellen, dann müssen sie uns wenigstens das erlauben. Wer weiß, vielleicht finden wir gar einen Bisamrattenbau.
Wir gehen im Gänsemarsch. Vor mir stakt der lange Bartel. Eigentlich heißt er Werner – aber wir sagen fast immer Langer zu ihm oder auch langer Bartel. Denn er ist dünn und gut anderthalb Kopf größer als der Brocken-Theo, der hinter mir über die Maulwurfshaufen stolpert. Dafür hat Theo einen mächtigen Brustkorb und harte Muskelballen an den Oberarmen. Der kleinste von uns aber geht hinten. Das ist der kleine Belo, und er muss schon immer trippeln, wenn wir noch einen ganz normalen Schritt drauf haben.
Und ich? Ich bin mittel. Nicht zu groß, nicht zu klein. Nicht zu breit, nicht zu dünn. Ich habe gar nichts Besonderes an mir. Manchmal ärgere ich mich darüber. Ich möchte auch einen Spitznamen haben. Aber den anderen fällt nichts Passendes ein. So sagen sie ganz einfach Heino zu mir. Bloß, das ist mein richtiger Name.
Wenn ich erst schneller als der kleine Belo rennen kann, dann hab ich was Besonderes. Vielleicht werden sie dann Flitzer-Heino zu mir sagen oder so ähnlich. Im Augenblick bin ich erst der Zweitschnellste. Aber ich trainiere fleißig. Nicht ausgeschlossen, dass ich es in den Winterferien schaffe. Jedenfalls sollten sich die anderen schon jetzt den Kopf darüber zerbrechen, welchen Namen sie mir verleihen wollen. Aber sie denken gar nicht dran. Sie stampfen durch das harte Gras vom vorigen Jahr.
Der lange Bartel kommandiert: „Links, zwei-drei!“ Plötzlich ruft er: „Halt!“
Vor uns erhebt sich ein dichtes Erlengebüsch. Die trockenen Sträucheräste sind mit gelben Schilfstängeln zu einer festen Wand verknüpft. Man könnte das Hindernis leicht umgehen. Aber wir haben keine Angst vor den paar lächerlichen Sträuchern.
„Belo vor“, ruft Bartel.
Weil Belo der kleinste von uns ist, kann er wie ein Wiesel durch das Gestrüpp flitzen und uns einen guten Weg suchen. Schon ist er im gelben Schilfgesträuch verschwunden. Wir hören, wie er sich keuchend vorwärts arbeitet, Äste knacken. Manchmal seufzt der Boden tief auf, wenn der kleine Belo in den Morast getreten ist und seinen Schuh wieder herausziehen muss.
Auf einmal ist es ganz still. Es rührt sich nichts mehr im Gebüsch. Dann schlüpft ein leiser Pfiff durch das Gewirr von Ästen und Schilf. Wir bleiben stehn – mucksmäuschenstill. Was war das? Der Pfiff bedeutet: Ruhe – ich belauere jemanden! Wir haben das so ausgemacht.
Aber wen belauert der kleine Belo? Die Ungeduld zwickt uns in den Beinen. Sollen wir hier draußen stehen bleiben und nichts erleben? Und der kleine Wicht flunkert uns später was vor? Schon hebt der lange Bartel die Hand: Achtung, gleich geht’s los. Aber dann lässt er die Hand wieder fallen. Aus dem Gestrüpp kommt ein leises Geräusch: Tapp, tapp, tapp.
Irgendetwas läuft auf vier Füßen, ganz vorsichtig – kein Ästchen knackt. Langsam nähert sich das Tappen. Endlich steckt der kleine Belo seinen weißen Haarschopf aus dem gleichen Loch, in das er vorhin gekrochen war.
„Was ist los?“, zischt der lange Bartel aufgeregt.
Der kleine Belo steht immer noch auf allen Vieren. Mit der rechten Hand fährt er sich an den Mund. Er legt den schlammigen Zeigefinger an die Lippen. Pst! Aber dabei verliert er das Gleichgewicht. Wie eine Walze rollt er seitwärts in das knisternde Schilf.
„Dussel“, knurrt der lange Bartel. Recht hat er. Wir sollen uns nicht mucken, und er macht einen Spektakel wie eine Schar Teichenten.
Endlich hat sich der kleine Belo aufgerichtet. „Da drin sitzt der alte Hubein“, flüstert er. „Ich hab ihn beobachtet.“
„Na und?“, sagt der lange Bartel. „Vor dem haben wir keine Angst.“
„Er sitzt ganz nahe am Grabenrand. Manchmal stiert er ins Wasser. Dann steckt er den Finger rein und verdreht dabei die Augen wie ein gestochenes Kalb. Zuletzt hat er eine Handvoll Wasser geschöpft und daran gerochen.“
„Vielleicht wollte er kosten?“ Der lange Bartel grinst.
„Hat er auch“, berichtet Belo weiter. „Ich trau meinen Augen nicht: Auf einmal nimmt er einen tiefen Schluck. Und schüttelt den Kopf.“
Wir lassen uns auf den Damm fallen. Was hat das nun zu bedeuten? Ein bisschen wunderlich ist er ja, der alte Hubein. Früher, wie es noch den Baron gegeben haben soll, ist er mal Schäfer gewesen auf so einem Rittergut. Heute bekommt er Rente und vertreibt sich die Zeit mit Angeln. Manchmal, wenn im LPG-Stall eine Kuh kalbt, holen ihn die Bauern. Er versteht sich drauf, und mit dem Tierarzt ist er sich auch einig. Aber schrullig ist er doch. Wenn wir Kinder ihn ärgern, hebt er beide Hände über den Kopf. „Fass sie, Hasso“, ruft er, „Fass sie! Jag sie von der Wiese, sie zerlatschen das ganze Futter.“
Dabei hat er schon jahrelang keinen Schäferhund mehr.“
Noch einmal vier Jahre später, also 1967, legte Joachim Nowotny erstmals im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig Erzählungen unter dem Titel „Labyrinth ohne Schrecken“ vor: Das Erzähltalent Joachim Nowotnys ist unbestritten, die poetische Originalität seiner Kinderbücher zeigt dies ebenso wie die vorliegende Sammlung von Erzählungen. Nowotny hat mit diesen Geschichten den Versuch unternommen, die Farbigkeit des Lebens einzufangen. Meist wird in diesen Erzählungen erst eine Barriere des Alltäglichen durchbrochen, ehe man zu dem Eigentlichen, Bewegten, zu den prallen Vorgängen kommt. In Fabeln von außerordentlichem Reiz wird hier gezeigt, dass Lebensfülle und Vitalität nicht nur in exotischen Bereichen zu finden, sondern unvermutet hinter den Ereignissen des Alltags zu entdecken sind. Joachim Nowotny hat selbst einmal von der Bedeutung der winzigen Begebenheiten unseres Lebens gesprochen – hier finden sich solche Situationen und Verhaltensweisen. Es sind Geschichten von starker Überzeugungskraft und voll echtem Humor, Beweise, dass die Erzählung in unserer Zeit nicht nur nötig ist, sondern auch wirksam werden kann. Eine Sammlung für Freunde poetischer und eigenwilliger Geschichten. Und hier ist die erste davon:
„Ein Ohr für alte Geschichten
Also gut: Wir leben. Aber das zu wissen, reicht nicht immer. Wenn wir irgendwo auftauchen, gibt’s Bewegung. Wir reißen Bäume aus, trinken Fässer leer, singen und lieben, manchmal vergessen wir uns auch, Gott ja, wir wollen es schließlich spüren, dieses Leben. Wollen es packen, in uns aufnehmen, aus uns herausströmen lassen. Kurz gesagt: Gewöhnlich machen wir allerhand Wind.
Manchmal freilich gibt es triste Stunden. Da sind wir uns selbst zu viel. Ein Wunder ist es nicht. 12 Kerle, keiner älter als fünfundzwanzig, seit Jahren bei einer Truppe, mal an der Oder, mal an der Küste, nun hier in der Lausitz und immer zusammen. Und kein Handschlag Arbeit ohne den anderen, kein Schluck Bier ohne ein allgemeines „Prosit!“, kein Kuss und kein Verhältnis, von dem nicht alle wüssten. Dazu diese Einöde. Sand, Schmälgras, prasseldürre Kiefernheide, ein milchiger Himmel über dem stumpfen Wipfelgrün, Rinde, Harzgeruch und wieder Sand. Wir mittendrin mit unseren Motorsägen – Tag für Tag die gleiche Arbeit: Das rechte Bein knickt zur Erde, der Körper senkt sich darüber, der Finger bewegt den Hebel der Säge. Aber die Ohren hören nicht das Sekundengekreisch, die Nase reagiert nicht auf den jähen Ansprung des Holzgeruchs, und die Haut bleibt unter dem Trommelfeuer der Späne gefühllos. Auch das Gemüt ist verhornt. Es verharrt unbewegt, wenn zähe Fasern endlich platzen, wenn der Stamm zu zittern beginnt, eine Vierteldrehung auf dem abgetrennten Stock beschreibt, wenn er fällt, anfangs sacht, als entschließe er sich eben zu einer Verbeugung, später mit Getöse und Geprassel hinein ins Heidekraut wie ein schlechter Schauspieler.
Und doch sind wir am Abend wie gelähmt. Kein Funke ist in uns. Blinden Hühnern gleich, sehen wir aus den Barackenfenstern auf die verwüstete, um und umgekehrte Rodefläche, in die Sandkrater, auf die zottigen Wurzelbärte und geschundenen Stubbenklötze. Manchmal fällt uns dabei ein, dass wir die ersten hier sind, dass andere kommen werden, die hier ein Kraftwerk bauen wollen. Irgendwo da drüben wird vermutlich die Bereitschaftssiedlung entstehen. In zwei, drei Jahren spielen dort schon Kinder, küssen sich junge Leute in den Kellernischen, dehnen sich nachts schlafwarme Glieder unter den Decken. Wir aber glauben nicht, was wir wissen. Das ist dann unser ganzes Problem. Und es ist auch die Stunde des alten Bregula, Plötzlich haben wir ein Ohr für seine Geschichten. Wir, die wir viel lieber selbst welche machen, hören ihm zu.
Seht den Baum da, sagt er, die große Kiefer mein’ ich, links an der Schneise, diesen mächtigen Apparat, das ist euch ein Kerl, was? Wie viel Jahre wird er stehen, zweihundert, dreihundert oder mehr? Ah, das ist eher ein Stamm, drei Mann müssten die Arme ausstrecken, wollten sie ihn umfassen. Sein Wipfel beschattet im Mittag einen halben Morgen Land. Was sag’ ich Wipfel, eine Krone ist das! Ein Königreich! Jede Astregion ist eine Provinz, jedes Zweiglabyrinth eine Residenz, jedes Zapfennest ein Weiler. Und wie er dasteht, frei und gerade gewachsen wie eine Dampfwolke bei Windstille …
Sonderbar. Wir hören den alten Bregula so eigenartig schwärmen, und es kommt uns nicht sehr komisch vor. Merkwürdig ist nur, dass wir jetzt erst den Baum entdecken. Ein einbeiniger Riese, so reckt er sich aus der Tausendschar der halbwüchsigen Kiefern, diesen charakterlosen Mimen, die dünnstämmig und langweilig sind, bloß für das Fließband gepflanzt. Sie alle fallen klaglos unter unseren Sägen.
Und wir verspüren plötzlich eine leise Lust, uns an den Riesen heranzuwagen. Wie lange würde der Hobel brauchen, ehe im Stamm das letzte Zittern begänne? Zehn Minuten? Länger? … Schätz einer, wenn Bregula seine alten Geschichten erzählt! Von Liebe und Tod ist die Rede, von Menschen früherer Jahre, von schönen Frauen und rauflustigen Staatskerlen, von blutigen Händeln, rauschenden Festen, von Trauer, tief wie ein Brunnen – und vom Wald, immer wieder vom wilden, mächtigen, hoch aufragenden Kiefernwald. In ihm erschlägt der Knecht seinen Herrn, in ihm liebt die schöne Reiche den armen Tropf, in ihm trauert das alte Holzweibel der Jugend nach.
Diese alten Geschichten! Wir können sie nicht ausstehen. Sie prahlen mit Blut und Kraft, strotzen vor Zufällen, lügen hinten und vorn. Der alte Bregula hat es schwer mit ihnen. Wir fallen über seine Worte her, reißen sie aus dem raunenden Zauberton, bringen die Ungereimtheiten und falschen Töne ans Licht. Nein, da ist uns so schnell nichts heilig.
Den Baum aber, den Riesen, werden wir vielleicht stehen lassen. Mögen sich später die Mädchen mit den Rücken an seinen Stamm lehnen, wenn sie sich gegen den Kuss wehren, den sie so gern haben wollen.“
Erstmals 1985 erschien im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig ein weiterer Band mit Erzählungen von Joachim Nowotny – „Schäfers Stunde“: Ist sie glücklich, ersehnt? Gar eine Schäferstunde? Immerhin hat Schäfer ja wohl drei Frauen kennengelernt bei jenem Heiratsball in Herberts Kneipe, als das Bier so gewaltig floss. Oder eine Stunde der Gefahr, der Bewährung? Die letzte Stunde? Eine gute, eine geschlagene? Auf jeden Fall: Schäfers Stunde. Geschichten werden hier erzählt, über Schäfer und andere, aus der Heidelandschaft und der Großstadt, von Liebe und Arbeit, den Sorgen und Freuden des Aufwachsens und Altseins. Ein Stift – er fühlt sich schon beinahe als richtiger Zimmermann – muss von einem Tag zum andern „unter lauter Weibern“ bestehen. Und: Die alte Patzeln zittert vor Anstrengung, weil sie den Schutzgeist eines unschuldigen Kindes zu ihrem letzten Sohn an die Front auf den Weg zwingen will. Ein Achtzigjähriger blickt manchmal bekümmert an seinem Sohn vorbei; woher rührt seine Enttäuschung? Die alte Hanna – sie hat es gut bei ihrer Enkelin – „streuselt“ an einem unfreundlichen Januartag durch die Großstadt und sucht: Zuwendung. Heiteres und nachdenklich Stimmendes, Komisches und Tragisches, große Zeitfragen und Alltag vermischen sich in diesen Lebensstunden. Die Erzählung „Weiberwirtschaft“ aus diesem fesselnden Buch von Joachim Nowotny wurde bereits 1983 von der DEFA verfilmt (Regie und Drehbuch: Peter Kahane). Hier ein erster Eindruck:
„Kurzer Weg
Der Großvater lacht in meinen Traum hinein. Die Strömung ist kalt und schwarz. In ihr treibe ich dem Wehr zu. Die Schützen, eine Wand aus schwerem Holz, stehen unter Druck. Es gibt kein Durchkommen. Ich stoße Luft aus. Mein Blick folgt den Blasen, die quälend langsam zur Eisdecke steigen. Mit letzter Kraft schleudere ich mich unter das Loch, das Siggi gestern gehackt hat. Auch das ist wieder fest überfroren. Oben steht der Großvater.
Er bedeutet mit gehobener Schulter, dass er mir nicht helfen kann. Er lächelt. Ich erwache, atme stoßweise. Den Traum werde ich vergessen, das Lächeln nicht. Es ist früher Morgen. Draußen hat der Frost die Welt fest zwischen seinen Zähnen. Auch das Klingeln, das vom tröpfelnden Wasser kam und allein vom Rauschen des Wehres übrig geblieben war, ist verstummt. Selbst die Mäuse halten still. Ich lausche hinüber in die Küche. Im Ofen krachen die Scheite. Der Großvater suppt. Er bläst über den Löffel und schlürft ohne Behagen. Er muss zur Schicht. Es könnte immerhin Sonntag sein. Der Großvater muss auch sonntags zur Schicht, doch ich nicht in die Schule.
Knirschende Schritte bewahren mich vor einem weiteren Traum. Ich fahre aus dem Halbschlaf und puste ein Loch in die Eisschicht des Kammerfensters. Im Licht des kaltenMondes steht die alte Patzeln auf der anderen Bachseite. Nicht groß zum Ausgehn angetan. Das schwarzwollene Kopftuch fest unter dem Warzenkinn geknotet, hält sie die Hände krampfhaft unter der Schürze. Sie wagt das Äußerste, hebt den Fuß, setzt den Pantoffel auf den Wall aus körnigem Schnee, den wir von der Schlittschuhbahn geschoben haben, zieht den anderen Fuß nach und steht schwer atmend auf dem Eis. Ein Blick zurück, ein zweiter zur Mühlbrücke. Der Weg durchs Dorf ist geschleppt, aber weit. Der Frost hat unsere Katen zu Nachbarhäusern gemacht. So nimmt die alte Patzeln den Blick herunter und geht los. Setzt Pantoffel vor Pantoffel und bespöttelt ihre Angst, indem sie das Eis leise bespeit. Brich ok, brich ok! Ein Schritt auf dem Damm, ein rasselnder Seufzer, und sie ist auf unserer Seite. Ich falle zurück ins Bett, höre die Schritte hinter dem Giebel leiser und auf dem griesigen Hofpflaster schneller werden. Als trüge die alte Patzeln eine Last, die sie endlich abwerfen möchte.
Die Haustür klappt, die Schwelle ächzt. Noch ehe es an der Küchentür donnert, hält der Großvater inne. Die alte Patzeln klopft nie mit dem Knöchel. Sie nimmt immer die ganze Faust. Ich weiß gleich: Heut’ ist es so gemeint. Auch die Großmutter muss es ahnen. Sie ruft: Herein! Ihre Stimme steigt an und bleibt oben. Die alte Patzeln fällt durch die Tür, sie stimmt ein und steigert den Ton zu einem gellenden Schrei. Dabei ringt sie die Hände, dabei schießen die Tränen. Die Großmutter fasst sich ans Herz, und der Großvater hält den zitternden Löffel vor dem geschlossenen Mund. Ich sehe das alles trotz der Wand, die die Kammer von der Küche trennt. Ich sehe es genauso, wie ich den lautlosen Schrei höre. Damals, als Krautschicks Siggi mit Spuckeblasen im Lippenwinkel im Viehfutter rührte, während seine Mutter unter der Kuh schrie. Der Milchstrahl fuhr aus dem Euter und brachte die Eimerwand zum Singen. Warum schreit sie, fragte ich. Siggi sagte: Vater ist gefallen. Aber sie soll nicht denken, dass ich mir das länger anhöre. Ich meld’ mich freiwillig. Auch die Witfrau Ruschke schrie, als ihr der Ortsbauernführer die Nachricht gebracht hatte. Es war alles zu, Hoftor, Haustür, Fensterläden. Zu und dunkel. Unterm Dach gurrten die Tauben. Aber sie wurden vom lautlosen Schrei der Witfrau Ruschken aufgeschreckt. Nach dem Mann hatte sie auch den Jungen verloren. Und die Frau Janke aus der Mühle ging überall herum und las aus dem letzten Brief ihres Stalingradkämpfers: Heut’ haben wir die Liese erschossen. Ich hab’ nicht hinsehen können. Das Pferd hat mich bis hierher gebracht, nun musste es dran glauben. Ich werd’ auch nichts vom Fleisch essen können, obwohl ich Kohldampf genug habe … Frau Janke hat erst geschrien, als alles vorbei war und der Landjäger ihr den Brief wegnahm.
Man hörte es nicht auf gewöhnliche Weise, aber das Wasser im Mühlgraben kräuselte sich vor Grauen. Bloß die alte Patzeln schreit richtig. Mei Eitel, schreit sie, mei gutes Eitel. Sie meint ihren jüngsten Sohn. Die beiden älteren sind gefallen. Der eine in Polen, der andere in Afrika. Eitel steht im Osten, der letzte Brief kam aus der Gegend von Shitomir.
Wenn der Großvater auf Schicht war, haben sich die beiden Frauen den Namen so oft zugeseufzt, dass ich ihn jetzt glatt hersagen kann. Aber da musste die alte Frau Patzel noch durchs Dorf.
Patzeln! schreit nun auch die Großmutter. Es ist ein leiser Schrei, einer, der schon eher in die Zeit passt. Der Großvater öffnet den Mund. Er schiebt den Löffel erst hinein, als auch die alte Patzeln leiser wird.
Er war da, schreit sie leise, in der Nacht war er da, mei Eitel.
Needoch, stößt die Großmutter hervor.
Jadoch, stöhnt die alte Patzeln. Und redet nun schnell, aber so, dass es in den vier Wänden bleibt. Der Eitel soll direkt aus dem Trommelfeuer gekommen sein. Ist geflogen, so schnell wie ein Seufzer, über Böhmen und Mähren oder auch umgekehrt, war da und hat ans Fenster geklopft. Mutter, hat er gerufen, Mutter, hilf! Wie einer, hinter dem sie her sind. Und die alte Patzeln hat gelegen, stumm und dumm, hat sich vor Schreck nicht zu rühren gewusst, hat schreien wollen, aber der Mund hätte ihr offen gestanden und das Herz den Hals mit seinen Schlägen abgeklemmt. Es hat sie geschüttelt und hin und her geworfen, und als es vorbei war, ist sie im Nachthemd ‚raus, barfuß, trotz Schnee und Eis. Doch da hatte es den Eitel schon wieder abberufen, zurück über Böhmen und Mähren und hinein in die Kesselschlacht. Die alte Patzeln will in der Kälte gestanden und sich ins Gesicht geschlagen haben. Den Hals hab ich mir aufgekratzt, hier seht’s euch an, seht’s euch um Gottes willen an, wie ich mich zugerichtet habe.
Großmutters Stuhl ächzt. Der Großvater beginnt zu schlürfen; ob er lächelt, kann ich nicht sehen, plötzlich spüre ich die Wand. Ich sehe nur, was ich der Großmutter abhören kann. Ihr ist es ernst mit diesen Dingen, die zwischen Himmel und Erde sind. Sie hat sich dem Tisch zugewandt und redet der alten Patzeln auf Umwegen zu. Tu dich ok fassen, sagt sie.
Fass dich um Himmels willen, er lebt ja noch, dein Eitel, er lebt, sonst hätt er nicht geklopft. Das weiß nun wirklich jedes Kind. Erst wenn es das dritte Mal gekommen ist und nächtens geklopft hat, dann muss er sterben. Es hat freilich bei keinem nur zweimal geklopft. Wenn es einmal losgegangen war, ging’s auch zu Ende. Dann klopfte nichts und niemand mehr.
Der alten Patzeln muss das keiner sagen. Sie lässt sich auf den Holzkorb fallen. Ich höre die Scheite unter ihrem Hinterteil stöhnen. Es ist ihr Platz, sie sitzt, den Kopf zwischen den aufgestützten Händen, den Rückenbuckel vor der Wand, wo er im Feuerschein zuckende Schatten schlägt. Sie hat den Schrei verschluckt; er stößt von Zeit zu Zeit aus der Mitte des Leibes. Dann würgt sie ihn in der Kehle ab und verdünnt den Druck zu einem jämmerlichen Wimmern. Es ist schieres Mitleid, was die Großmutter herumreißt. Ich höre es dem ächzenden Stuhl ab. Sie beugt sich übers Knie und redet der alten Patzeln zu.
Nunu, murmelt sie, tu dich ok nie grämen. Ist wohl noch nicht aller Tage Abend. Ist wohl noch nicht alles verloren. Er war ja nicht selber da, dein Eitel, es war sein Geist und Schemen. Wenn man ihn festhalten kennte …
Der Großvater legt den Löffel hart aufs Holz. Vorsicht! heißt das. Es sind keine Zeiten für wenn und aber. Die Leute sind außer Atem, sie nehmen den Zweifel als Hoffnungsschimmer. Aber es ist zu spät. Die alte Patzeln springt vom knisternden Korb, sie bekommt Großmutters Schürze zu packen, sie knetet den grauen Warbstoff und presst ihre Bitte mit beiden Händen. Ach Martha, Martha, wenn du was machen kenntest!
Nun sehe ich Großvaters Lächeln doch. Das muss man sich vorstellen: Zwei alte Weiber, das eine vor Kummer krumm, das andere aus Mitleid zu Versprechungen geneigt, die es nicht halten kann. Beide wollen dem Schicksal in den Rachen greifen. Der Großvater glaubt nicht an Schnickschnack und Firlefanz, ihn können die Geister kreuzweise. Aber er muss einräumen, dass es tausendmal wahrscheinlicher ist, dass der Eitel umkommt, als dass er heimkommt. Und dagegen weiß auch er kein Kraut. So ist das Lächeln schnell weggesteckt; außer mir hat es vermutlich keiner gesehen.
Aber weshalb vermutlich? Was hier gespielt wird, spielt alles noch im Finstern. Ich sollte es nicht mit Mutmaßungen verdunkeln. Ich stehe doch lieber auf und nehme an, es ist kein Sonntag. Wenn ich selber am Tisch sitze und meine Suppe löffle, kann ich alles viel deutlicher sehn. Es ist wohl auch nicht so schlimm. Es ist eher so, wie es oft war, wenn die alte Patzeln kam und sich doch lieber aufs Sofa setzte. Im Radio spielen sie eine Polka mit Gesang. Die alte Patzeln wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel und beginnt mitzusummen. Wir hören fast immer Prag, Praha jedna, wie sich der Ansager meldet.
Manchmal abends den Zeitspiegel vom Deutschlandsender. Dann hat der Großvater Nachtschicht, und wir liegen nebeneinander auf dem Sofa und passen auf, dass niemand schläft. Die alte Patzeln kommt immer, sobald Musik angesagt ist. Ihr Mann war früher Straßenmeister im Böhmischen, im Biemschen, gewesen. Der Großvater behauptet, das sei eine Gegend, in der sich jeder Feger Meister nennen dürfe. Doch die alte Patzeln hat dort als junge Frau manche Polka getanzt. Nicht nur mit dem eigenen Mann, wie die Großmutter durchblicken lässt. Da muss ich aufpassen, dass ich das richtige Gesicht mache. Sonst gibt sie mir eins übern Mund. Vielleicht glaubt sie, ich könnte die alte Patzeln fragen, mit welchem Mann sie gerade tanze, wenn sie auf unserem Sofa sitzt und sich zu den Klängen der Polka wiegt. Ein schönes Stücke, sagt die Großmutter, aber alles biemsch. Wenn man wüsste, wovon sie singen. Die alte Patzeln schließt die Augen. Vom Abschiednahmen, schnieft sie. Sie singen immer vom Abschiednehmen, sooft man auch fragt. Weiter hat sie nischt gelernt, sagt der Großvater. Und er lächelt ein Lächeln, von dem er selber nicht mehr weiß, dass er noch darüber verfügt.
Aber mit mir ist es nun Zeit in die Schule. Ich nehme den Weg bachaufwärts übers Eis. Wo es der Wind blank gefegt hat, schlittere ich auf den kostbaren Sohlen. Abwärts rutscht es besser. Ich trödle so lange, bis ich zu spät komme. Fräulein Krain verzieht die dicken Lippen, als ich meine Entschuldigung stammle. Das will nun ein Pimpf des Führers sein. Der Führer steht in schwerem Abwehrkampf gegen den plutokratisch-bolschewistischen Feind.
Er kann Trödelei nicht dulden. Fräulein Krain befiehlt mir, mich zu setzen. Sie kommt dicht an die Bank und drückt ihr Knie auf meinen Oberschenkel. Dann zieht sie mich am Ohr hoch. Ich bin noch einmal gut weggekommen. Krautschicks Siggi hat sie über den ganzen Schulhof geohrfeigt, nachdem sie ihn in der Turnstunde aus dem Jungenabort geholt hatte.
Und Piepe musste fünfundzwanzig Liegestütze machen, weil er wieder mal dumm vor der Tafel stand und nicht wusste, wie die Hauptkampflinie verlief. Als er nicht mehr japsen konnte, zog sie ihn am Ohr hoch.
Auf dem Heimweg fragt mich Piepe, ob ich’s gespürt habe. Es feuert ganz schön, gebe ich zu. Ich spür’s oben nicht mehr, sagt Piepe, ich konzentriere mich aufs Knie. Wieso, frage ich. Wenn du’s nicht spürst, kann ich dir’s nicht erklären, antwortet Piepe. Man hat ihn wegen des Bombenterrors aus Berlin zu uns aufs Dorf evakuiert. Wir können uns manches nicht erklären.
Schon von Weitem hören wir Großvater im Schuppen rumoren. Trotz der Schneedecke dröhnt die Erde unter den Schlägen des Vorschlaghammers. Der Großvater hat schon den zweiten Eisenkeil in den Stubben gedroschen. Der wehrt sich mit allen Fasern. Den dritten Keil hebt sich der Großvater auf. Er wird es erst mal mit dem aus Eichenholz versuchen. Saugt der sich fest, hat der Stubben verloren. Aber er springt aus dem Spalt an Großvaters Schienbein. Er reibt sich die schmerzende Stelle und flucht in sich hinein. Das Lächeln spart er sich für den Moment, in dem der Stubben trotz allem kapitulieren muss. Piepe sieht in den Schuppenmulm und wundert sich. Bis unter die Decke alles voller Scheitholz. Das langt doch Jahre, Mann! Er spürt’s nicht, weshalb der Großvater sich immer weiter schindet. Ich kann’s ihm nicht erklären, obwohl ich sicher bin, es würde Fräulein Krain nicht gefallen.
Für Großvaters Arbeitslust wird es zu zeitig dunkel. Brummig tappt er sich bis zur Küche vor und steht der Großmutter, die Ziegenfutter kocht, andauernd im Wege. Endlich bequemt er sich aufs Sofa. Ich leg‘ mich gleich dazu. Und soll aufpassen, dass keiner schläft. Während ich den Zeitspiegel höre, fängt der Großvater an, das Holz zu sägen, das er bei Licht nicht geschafft hat. Ich rüttle ihn an der Schulter. Opa, wo liegt Narvik? Er erwacht röchelnd: Lass es liegen. Und schläft schon wieder.“
Weihnachten – Fest der Familie, strahlende Kinderaugen unter dem Weihnachtsbaum, Besinnlichkeit, für viele Menschen aber auch Symbol für Konsumterror, Völlerei und eine Zeit der Einsamkeit. Lutz Dettmann macht die Vielfalt der zahlreichen, oft widersprüchlichen Seiten der Weihnachtsfeiertage für den Leser erfahrbar. Die abwechslungsreichen Kurzgeschichten führen den Leser vom Mecklenburg der Gegenwart, in der ein erbarmungsloser Dekorationskrieg zweier Nachbarfamilien ein überraschendes Finale hat, bis in die Schützengräben von Flandern, wo er hautnah dabei ist, wie in der Heiligen Nacht des Jahres 1914 aus Feinden Freunde werden. Lutz Dettmanns Geschichten regen zum Nachdenken an und sind – genau wie die Vorweihnachtszeit – manchmal skurril oder auch trivial. Eines haben sie alle gemein: Sie vermitteln diese besondere Weihnachtsstimmung.
Fast alle Weihnachtsgeschichten, über Jahre für die Familie geschrieben, finden in diesem Buch übrigens erstmals ihren Weg in die Öffentlichkeit. Die dem Buch beiliegende DVD präsentiert enthält den Kurzfilm „Fröhliche Weihnachten“ (Regie: Till Endemann), der nach der in diesem Band enthaltenen Erzählung „Alle Jahre wieder“ gedreht und 2010 im MDR erstausgestrahlt wurde. Es spielen unter anderen Mit Ramona Kunze-Libnow, Uwe Karpa und Edi Jäger. Für die Produktion von filoufilm Dani Barsch in der Regie von Till Endemann hatte Dettmann auch das Drehbuch geschrieben. Die Filmmusik komponierte Frieder Zimmermann. Und so liest sich der Anfang der ersten Weihnachtsgeschichte von Lutz Dettmann:
„Ein Polizist als Weihnachtsengel
Mein Großvater ist nun schon über 30 Jahre tot. Doch noch immer sehe ich seine stämmige Gestalt, das schmale Gesicht mit dem, auch noch im hohen Alter vollen, schlohweißen Haar. Sein Wesen, seine Art, die von Altersweisheit und Zufriedenheit gezeichnet waren, habe ich nicht vergessen. Und manchmal, besonders in der Vorweihnachtszeit, höre ich seine Stimme, die uns Kindern damals so schöne Geschichten erzählen konnte.
Wenn die Weihnachtszeit kam, begann auch die schönste Zeit für unseren Großvater. Er begab sich mit uns in die Gedankenwelt seiner Kindheit zurück, erzählte von mecklenburgischen Wintern voller Schnee und klirrender Kälte, von Schlittenfahrten über tief verschneite Wege, die er mit seinem Vater, der Arzt war, gemacht hatte. Und Märchen konnte er erzählen! Selbst noch als 12-Jähriger nahm er mich mit seinen Märchen gefangen. Ich höre seine Stimme, die im mecklenburgischen Mischplatt für uns Enkelkinder Wunderwelten erschuf, mit Trollen, Elfen, Weihnachtsmännern und Hexen. Und natürlich siegte immer das Gute in seinen Märchen. Es konnte ja nicht anders sein – erst recht nicht zur Weihnachtszeit.
Besonders erinnere ich mich an das letzte Weihnachtsfest mit meinem Großvater. Als wäre es erst im letzten Jahr gewesen, sehe ich ihn vor mir sitzen, in seinem alten Ohrensessel, meine Schwester und ich vor ihm. Und er erzählt von damals, von früher – als die Winter noch voller Schnee und ohne grelle Weihnachtsreklame waren, als sich Kinder noch über Äpfel und Rosinen freuten, als es den Maronenmann noch gab und richtige Wachslichter und Haaspoppen am Baum hingen …
„So, so, eine Weihnachtsgeschichte soll ich euch erzählen?“ Der Großvater drehte sich zu uns um, und ein spitzbübisches Grinsen flog über sein Gesicht. „Meint ihr nicht, ihr seid langsam zu alt dafür?“
Wir wussten, dass diese Frage kommen würde. Sie kam an jedem Heiligen Abend, wenn die Eltern und die Großmutter uns aus der guten Stube der Großeltern treiben mussten. Wie aus einem Mund verneinten wir dies natürlich. Ist man mit zehn oder zwölf Jahren zu alt für die Vorfreude auf das Weihnachtsfest? Nein, in diesem Moment wollten wir wieder klein sein. Und wie immer ließ sich der Großvater natürlich erweichen. Auch das gehörte zum alljährlichen Ritual. „Na gut, dann ab!“
Der Großvater öffnete die Tür zum Herrenzimmer, wie es noch immer hieß, obwohl es so gut wie nie benutzt wurde, denn die Herren, mit denen sich der Großvater früher immer zum Skat oder Schach getroffen hatte, spielten mittlerweile weiter oben ihre Spiele. Ohne den Großvater, was er manchmal bedauerte, denn zum Skatspiel hatten wir Jungen nun wirklich keine Lust, wenn wir auch sonst fast alles für ihn getan hätten.
Der Geruch von Winteräpfeln, die Großmutter auf dem großen Bücherschrank lagerte, schlug uns entgegen und wohlige Wärme, die besonders auffiel, da dieses Zimmer sonst nur spärlich geheizt wurde. Das Dämmerlicht des beginnenden Weihnachtsabends tauchte den großen Esstisch, den Bücherschrank und den Schreibsekretär, an dem schon Generationen von Großvätern gesessen hatten, in ein besonderes Licht. Meine Schwester zog die Vorhänge zu. Ich entzündete die große Adventskerze auf dem Rauchtisch; wir rückten zwei Stühle um den großen Ohrensessel, auf dem sich unser Großvater niederließ.
Heute frage ich mich manchmal, wie es möglich war, dass unser Großvater in diesen Minuten aus halbwüchsigen Enkelkindern solche erwachsenen, artigen Zuhörer schaffen konnte. Und dann saßen wir um seinen Sessel geschart, knabberten von den Weihnachtsplätzchen, die auf dem kleinen Rauchtisch standen und warteten, was nun kommen würde.
Der liebe alte Mann saß auf seinem Sessel, hatte seine Anzugjacke aufgeknöpft (Weihnachten trug er immer einen Anzug), die goldene Uhrkette glänzte auf der dunklen Weste. In diesem Moment hätte er den personifizierten Großvater für alle Enkelkinder abgeben können. Er strich sich über das Kinn, musterte uns kurz. Dann lächelte er sein Großvaterlächeln.
„Ihr seid wohl ganz schön aufgeregt, wann es nun mit der Bescherung losgeht. Na, lasst mal eure Eltern machen.“
Wir fingen an zu drängeln – wie in jedem Jahr – und der Großvater begann zu erzählen – wie in jedem Jahr. Doch vorher räusperte er sich. „Wisst ihr, dass mir langsam die Märchen und Geschichten ausgehen? Schließlich musste ich euch ja auch schon jedes Jahr eine Geschichte erzählen. Mein Kopf ist alt geworden. Da fällt es einem schwer, immer wieder neue Geschichten zu erfinden.“
Dann machte er eine Pause und griff sich ein Plätzchen. „Heute will ich euch etwas Wahres erzählen. Ob es überhaupt eine Geschichte wird, weiß ich noch gar nicht. Wollen wir abwarten, was es wird.“
Der Großvater hielt kurz inne. „Wisst ihr“, und er legte sein Plätzchen gedankenversunken wieder auf den Teller zurück, „zu Hause bei meinen Eltern lief unser Weihnachtsfest immer sehr harmonisch ab. Alles war vorgeplant. Die Weihnachtsgans hatte meine Mutter mit unserem Hausmädchen schon im September ausgesucht. Den Weihnachtsbaum kaufte mein Vater und ließ ihn vier Tage vor Weihnachten nach Hause liefern. Aufgestellt und geschmückt hat er ihn immer alleine. Das ließ er sich nicht nehmen, auch wenn er Medizinalrat war, und damals, vor dem ersten großen Krieg, war das schon eine Stellung. Also, alles lief geplant ab – bis auf ein Weihnachtsfest. Das war so um 1910. Ich war gerade acht oder neun geworden. Jedenfalls weiß ich, dass die Elektrische gerade fuhr.“
Wieder griff der Großvater nach einem Plätzchen, biss diesmal ab, schnippte die Krümel von seiner Weste, lächelte und ermahnte uns, diesen Lapsus nicht der Großmutter zu petzen und fuhr fort: „Klapperkalt war es in diesem Dezember gewesen. Die Leute rannten bis über beide Ohren vermummt durch die Gegend. Bei meinem Vater in der Praxis war die Hölle los. Die Mutter rannte, Vater hatte eine zweite Hilfe eingestellt. Die Arbeit war kaum zu schaffen. Aber das war genau das Richtige für ihn. Er brauchte Druck. Pfeifend rannte er durch die Praxisräume.“
Der Großvater schaute kurz auf. „Wisst ihr, er liebte Operetten – er pfiff also den ganzen Tag Operettenmelodien, wuschelte Kinderköpfe im Vorbeigehen durch, erwischte auch manchmal schon einen älteren Kopf. Wie gesagt, er lief zur Hochform auf. Einziges Problem: Er konnte sich nicht um den Baum kümmern. Und das betrübte ihn immer mehr, denn der Weihnachtsbaum war sein Heiligtum. Hoch musste er sein, eine Tanne musste es sein und frisch geschlagen musste sie sein. Denn er liebte den harzigen Duft.
Wenn der Baum fünf Reichsmark kostete! Es war egal. Vater vergaß in diesem Moment seine Sparsamkeit. Aber er konnte keinen Baum aussuchen. Die Kranken fielen wie die Heuschrecken in seine Praxis ein. Mein Bruder und ich genossen das Winterwetter. Wir liefen mit den anderen Fridericianern (Schüler des Fridericianums Schwerin, altsprachliches Gymnasium in Schwerin, 1553 gegründet) Schlittschuh auf dem Pfaffenteich, lieferten uns Schneeballschlachten mit den Jungen von der Hospitalstraßenschule und rodelten den Arsenalberg herunter, dabei immer auf der Flucht vor Schutzmann Stüdemann. Mich hatte dieser besonders ins Herz geschlossen, da ich ihm einmal durch die Beine gerodelt war.“
Der Großvater lächelte.“
Und mit einem Lächeln wollen wir uns jetzt auch in die beginnende Vorweihnachtszeit verabschieden und Ihnen wünschen, dass Sie wenig Stress und viel Zeit zum Lesen haben werden. Viel Spaß beim Ausprobieren der insgesamt sechs Angebote dieser Woche und bis demnächst.
EDITION digital wurde 1994 gegründet und gibt neben E-Books (vorwiegend von ehemaligen DDR-Autoren) Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, derzeit mehr als 900 Titel (Stand November 2018).
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de