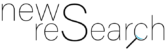Erstmals 1989 veröffentlichte Klaus Möckel im Verlag Neues Leben Berlin seine „Geschichte eines knorrigen Lebens“: Man hat es nicht leicht mit ihm. Max ist eigenwillig, ein Mensch mit allerhand Schrullen. Ein Wühler, der jäh alles hinschmeißen kann, ein Querkopf, der sich nicht gern in eine Sache hineinreden lässt. Geboren 1907 in der Familie eines ehemaligen Bergarbeiters, der das Wohnzimmer seines Hauses zum Schankraum macht, ist er nach eigenen Worten zu ungeschickt, um anderswo als im „Schacht“ zu schuften. So rackert er jahrzehntelang untertage. Er überlebt einen Unfall, bei dem er zwischen zwei Kohlenzüge gerät, und beide Weltkriege, beim Zweiten bewahrt ihn das „schwarze Gold“ vor der Front. Der Hunger ist lange Zeit sein Begleiter. Was Wunder, wenn ihn der Gedanke ans Essen fasziniert. Viel muss es sein, zehn Klöße zum Mittag und zwanzig Pfund Brot die Woche, um die bei der Arbeit verbrauchten Kalorien auszugleichen. Doch Max, der seiner Frau das Rechnen überlässt, gern Bücher über ferne Länder liest, ohne großen Erfolg Englisch oder Russisch zu lernen versucht, ist viel mehr als ein starker Esser … Mit viel Humor und einem Gespür für das Besondere hat Klaus Möckel die Geschichte seines Vaters aufgeschrieben, eines Arbeiters, wie man ihn in der heutigen Literatur kaum noch findet.
1. Kapitel
„Kennst du das Gebet Australiens?“
Er sitzt auf der Bank, das schmerzende Bein von sich gestreckt, leicht nach vorn gebeugt und auf den Stock gestützt, der noch aus den Zeiten langer Fußmärsche stammt. Jetzt geht’s mit Mühe bis zu den Hügeln hinterm Haus hoch, durch die Schrebergärten zur nächsten waldgesäumten Kuppe. Es ist heiß, er hat das Hemd durchgeschwitzt, der Jackenkragen ist feucht, aber ohne Jackett verlässt er die Wohnung nie. Aus Eitelkeit, um den Bauch zu verdecken. Auch schleppt er allerhand Zeug in den Taschen mit, auf das er nicht verzichten will: Bonbons, Kolapastillen, Schlüssel, eine billige Taschenuhr, Eisenstücke, aus Hufeisen herausgebrochen, so genannte Glücksbringer, an die er eigentlich nicht mehr glaubt. Wenn man die Jacke anhebt, spürt man das Gewicht.
Außerdem trägt er stets eine Mütze, so eine flache mit Dach, selbst bei der größten Hitze. Sie schützt die Augen und den Kopf vor der Sonne. Er sitzt da und schaut mich mit gespielter Erwartung an. Lauernd fast, in den hellbraunen Kugelaugen glitzern Funken. Was weiß ich schon von Australien. Sydney, Melbourne, wo vor Jahren eine Olympiade stattfand, dann die weitgedehnten Steppen und Buschgebiete im Innern mit den Aborigenes, den ums Überleben ringenden Ureinwohnern. Schafherden. Kängurus und die putzigen, nach Eukalyptus duftenden Koalas – Vorbild für unsere Teddybären. Irgendwo in den tropischen Regenwäldern soll es das sagenumwobene Schnabeltier geben, eine Art Otter mit breitem Entenschnabel. Kleinster Erdteil, von Ozeanen umspült. Mitglied im Commonwealth und zurzeit von einer Labourregierung geführt. Aber da bin ich mir schon nicht mal mehr sicher. Nicht gerade viel, was ich von Australien weiß, ein paar Brocken aus Büchern, Zeitschriften und dem Fernsehen. Genaueres müsste ich dem Lexikon entnehmen. Ich tröste mich damit, dass sie dort von uns bestimmt gleich gar keine Ahnung haben. Vielleicht kennen Eingeweihte die Namen einiger Sportler.
Er schaut mich erwartungsvoll an, der Alte, und nimmt nun die Mütze ab. Mit einem großen blaukarierten Taschentuch wischt er sich die Stirn und die Halbglatze trocken. Der Wind fächelt, bewegt die Baumkronen. Uns zu Füßen liegt die Stadt, von leichtem Dunst überzogen. „Wasser!“, sagt er mit nicht zu überhörendem Triumph in der Stimme.
„Was?“
„Wasser“, wiederholt er, „das Gebet Australiens heißt Wasser, verstehst du!“
„Nicht ganz.“
„Ist doch klar. Ringsum das Meer, zum Teil auch die Berge, im Landesinnern aber, in den riesigen Wüsten, die Glut. Die unerbittlich brennende Sonne. Und die Tiere, die Menschen mit ihrem gewaltigen Durst.“ Er hebt die Hand, deutet mit ausholender Geste die Weiten australischer Ödnis an. Er war nie dort, wahrscheinlich nicht einmal im Traum, hat es aus Reisebüchern, die im Schrank in der Wohnstube stehn. In beträchtlicher Anzahl, jährlich kommen ein paar neue hinzu. Der Mensch, ferne Länder, die erbarmungslose Natur. Er liebt solche dramatischen Effekte.
Wir erheben uns, gehn ein Stück durch den Wald. An den Eichen und Buchen vorbei, die in vollem Grün leuchten, um die Hagebuttensträucher herum. In kleinem Bogen und langsam – er schafft’s nicht mehr anders. Das Rheuma im Knie und im Hüftgelenk zwingt ihn zum Humpeln, zu häufigen Pausen. Ein wenig ist’s auch schon die mangelnde Luft, nur will er das nicht wahrhaben. Innerlich hält er sich für gesund. Dagegen schimpft und knurrt er in ohnmächtiger Wut wegen der Laufbeschwerden. „Das Reißen, das Reißen, die elenden Knochen machen nicht mehr mit.“
Den Ärzten, zu denen man ihn fast mit Gewalt treiben muss, wirft er vor, ihre Medizin tauge nichts. Ein Heilmittel muss bei ihm sofort anschlagen, sonst fliegt es in den Ofen. Geduld war noch nie seine Sache. Dabei unterlaufen ihm Dinge, über die alle, auch er selber, lachen. Wie kürzlich, als er die mühsam ergatterten Tabletten wegschmiss. Da hatte er sich wegen der unerträglichen Schmerzen im Bein doch einmal zum Arzt aufgerafft. Wäscht sich von Kopf bis Fuß, zieht neue Sachen an, greift zum Stock und humpelt den Berg hinunter zur Poliklinik. Entschlossen, die Hilfe dort in Anspruch zu nehmen. Aber die große Anzahl der Wartenden, das Gewirr auf den Gängen jagen ihn zunächst wieder auf die Straße zurück. Ich stell mir vor, wie er vor dem Eingang steht und überlegt. Die Hüfte jault, also meldet er sich letztlich an.
Die Untersuchung ist gründlich, erstreckt sich keineswegs nur auf das Bein. Als der Arzt ausgiebig Brust und Rücken abhorcht, beschwert sich der Patient: „Was suchen Sie da? Die Hüfte und das Knie tun weh, sonst fehlt mir nichts.“
"Na, ganz so ist es nicht, ich werd Sie besser mal zum Röntgen schicken."
„Röntgen brauch ich nicht, ich brauch was fürs Bein.“
„Und was ist mit dem Atem, wenn Sie die Treppe hochgehn?“
„Luft hab ich genug.“
Das stimmt nicht ganz, und der Arzt, der das Pfeifen in der Lunge durchaus zu deuten weiß, erwidert: „Das sollte mich wundern, auf jeden Fall schreibe ich Ihnen ein Rezept aus. Das nehmen Sie mit und gehn noch ins Haus 11 zum Durchleuchten. Ich ruf dort an.“
Der Patient zieht sich etwas irritiert in die Kabine zurück, steigt in die Hosen, lässt dabei aber die Tür offen. Nicht mit Absicht und nicht weit, gerade mal einen Spalt. Und obwohl er schlecht hört, versteht er einiges von dem laut geführten Telefongespräch des Arztes mit der Röntgenabteilung: „Ich schick euch da einen alten Schachter, er hat bestimmt Staublunge, schaut ihn mal genau an. Einen dicken Bauch schleppt er auch mit sich rum.“
Einen dicken Bauch – was bildet der sich ein, Max protestiert insgeheim. Natürlich wird er nicht zum Röntgen gehn. Sein Rezept hat er, und das ist die Hauptsache. Ist auch alles zu anstrengend, das Bein feuert wie verrückt. Zur Apotheke noch, die liegt am Weg, und dann schnell nach Hause. Die Frau wartet mit dem Essen. Im Topf auf dem Gasherd kocht ein fettes Stück Schweinefleisch, dazu gibt’s Salzkartoffeln und Sauerkraut.
„Na, was hat der Doktor gesagt?“, fragt seine Frau, als er zu Hause anlangt. „Können sie was machen?“
„Ach, von denen erfährt man doch nichts, er behauptet, mein Bauch sei zu dick.“
Das stimmt zwar, wir kritisieren ihn deswegen auch, beschwören die beiden Alten, nicht so fett zu essen, aber gegen seine Frau ist Max noch schlank. Sie ist fast eine Kugel, klein und rund. Bei einer Größe von einssechzig wiegt sie im Hemd fünfundneunzig Kilo. Er hat neun Zentimeter mehr und bringt dreißig Pfund weniger auf die Waage. Deshalb enthält sie sich eines Kommentars zu diesem Punkt, fragt nur: „Hat er dir nichts verschrieben?“
„Doch, Einreibung und Tabletten.“
Eingerieben hat er das Bein bisher auch schon, mit allen möglichen selbstgebrauten Mixturen oder mit Salben, die es ohne Rezept gab. Tabletten, gleichfalls rezeptfrei, hat er gegen die Schmerzen eingenommen.
„Rheunavol, Aminophyllin“, buchstabiert seine Frau.“
Erstmals 1975 brachte der VEB Deutsche Verlag für Musik Leipzig das ungewöhnliche Musikbuch „Andi, gib den Ton uns an!“ von Steffen Mohr heraus: Der achtjährige Andi ist ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Doch heute nehmen ihn seine Eltern das erste Mal mit ins Konzert. Er ist ziemlich neugierig, ob so ein Konzert etwas anderes ist als die Fiedelei im Radio. Danach lauscht er bei der Probe des Schulorchesters und verkündet selbstbewusst, dass er Oboe spielen will. Er übt fleißig und sein Musiklehrer lobt sein Talent. Doch Andi ist auch ein guter Fußballspieler und Torschütze, auch dafür muss er regelmäßig trainieren. Bei seinem ersten Auftritt mit der Oboe bekommt er vor Aufregung nur einige Piepser heraus. Muss er nun zwischen Fußball und Oboe wählen? Und so beginnt sie – die Auseinandersetzung zwischen zwei Leidenschaften:
„1. Kapitel
Mutter reißt die Tür auf und schaut herein. Andi sieht Mutter auf dem Kopf stehen: Die Augen hat sie unter der Nase, ihr Hals befindet sich über dem Kinn, und die Beine sind ganz oben. Das kommt davon, weil Andi wieder einmal ausprobiert, wie lange er auf dem Kopf stehen kann. Er schielt auf die Taschenuhr, die neben ihm auf dem Boden liegt. Fast fünf Minuten hält er diesen Kopfstand schon aus! Zehn Minuten muss ich schaffen, denkt er mit zusammengebissenen Zähnen.
„Ach je, Junge“, jammert die Mutter. Sie hat ihr schönes, dunkles Kleid an. Überhaupt ist sie irgendwie anders als sonst.
„Bist du noch nicht umgezogen? Was machst du bloß?“
„Ich trainiere“, antwortet Andi ruhig. Das stimmt. Aber Mutter hat dafür kein Verständnis. Fein säuberlich hängt Andis guter Anzug über der Stuhllehne, ein weißes Hemd und sogar eine dunkelrote Fliege. Mutter geht mit zwei energischen Schritten auf den Jungen zu. Sie packt ihn einfach an den Beinen – schwupp! Da sitzt er auf dem Teppich. „In fünf Minuten bist du fertig“, bestimmt sie und wirft Andi so schnell das frische Hemd zu, dass er es gerade noch auffangen kann. Dann geht sie hinaus. Rums! klappt die Tür zu.
Warum Mutti nur so aufgeregt ist? überlegt Andi. Schon als Vater von der Versammlung kam, war sie ganz aus dem Häuschen. Richtig laut wurde sie, was bei Mutter sehr selten vorkommt. „Da haben wir nun mal alle Zeit fürs Konzert, und du kommst später“, schimpfte sie mit Vater. Sie sagte noch, was fast wie eine Entschuldigung klang: „Du weißt doch, es ist das erste Konzert, das unser Andi erlebt.“
„So viel Wind um ein bissel Musik“, brummt Andi, während er seine Turnsachen auszieht. Wenn es zum Spiel zwischen Dynamo und Motor ginge, könnte er Mutters Aufregung gut begreifen. Aber was versteht Mutter schon vom Fußball? Da ist Vater ganz anders. Der hat bestimmt keine Lust zum Konzert, sonst wäre er zeitiger heimgekommen.
Dass Andi kein Interesse hat, mit seinen Eltern fortzugehen, ist nicht ganz richtig. Er ist sogar ziemlich neugierig, ob so ein Konzert etwas anderes ist als die Fiedelei im Radio. Mutter behauptet es jedenfalls. Aber warum muss ein achtjähriger Junge dazu eine Fliege umbinden, die einem den Hals zuschnürt, dass man kaum noch Luft bekommt? Zwar hat Vater ihm erklärt, wie man sich den Hals mit diesem Ding fesselt. Und gestern hat Andi den Knoten auch richtig gekonnt, sogar zweimal nacheinander. Aber heute, vor dem kleinen Spiegel im Kinderzimmer, kommt er ins Schwitzen. Aus der Fliege wird meist ein Pionierknoten, manchmal auch etwas, das aussieht wie ein verdrehter Regenwurm mit Korkenzieherantrieb.
„Vati!“, ruft Andi mit kläglicher Stimme, als er Vaters Schritte eilig durch den Korridor schlappen hört. Vater sieht völlig durcheinandergebracht aus. Um den Hals hängt ihm ein Frotteehandtuch. Nasse Haare kleben auf seiner Stirn. Zum Unterhemd trägt er die feine, schwarze Hose. Aber aus den Beinröhren guckt links eine Socke ohne Schuh und rechts ein Fuß ohne Socke heraus. „Na, komm mal her, Herr Schröter“, sagt Vater und bindet ihm das verzwickte Ding um. Er zwinkert Andi kurz zu und rennt gleich wieder hinaus, als ob ein Rudel Wölfe hinter ihm her wäre.
„Herr Schröter!“ hat Vater gesagt. Andi dreht sich vor dem Spiegel einmal langsam um. Tatsächlich! In so einem Anzug sieht man richtig erwachsen aus. Natürlich sind Trainingsjacke und Turnhosen viel besser. Man fühlt sich darin nicht wie in eine Ritterrüstung gezwängt. Aber wenn man es genau nimmt, hat so ein Anzug auch seine Vorteile. Gleich kriegt man einen anderen Gang, würdiger und stolzer. Mit steifem Hals schreitet Andi ins Wohnzimmer hinüber. Alle sind jetzt fertig.
„Hast du auch die Karten?“, fragt Mutter an der Tür. Nun ist sie schon ein bisschen ruhiger. Vater nickt nur. Andi sieht Vater und Mutter an. Was ist mit ihnen nur los heute? Mutters Augen haben einen fröhlichen Glanz. Augenbrauen und Lippen hat sie leicht mit Schminke nachgezogen. Auch Vater sieht anders aus als sonst. Anders als wenn er mit der Aktentasche von der Arbeit kommt und noch einmal einen Schlosseranzug überzieht, um zu Hause einen Stuhl zu reparieren oder die Fenster zu streichen. Er hat heute ständig so etwas wie ein kleines Schmunzeln im Gesicht.
Als er die Tür zuschließt, sieht er schnell zu Mutter, die bereits die Treppe hinuntergeht. Dann flüstert er Andi mit diesem Schmunzeln zu: „Weißt du, was wir machen, wenn uns die Musik zu langweilig wird? Wir brennen in der Pause einfach durch, Herr Schröter.“ Aber Andi spürt, dass es Vater damit nicht ernst ist. Nun ist er wirklich gespannt, was heute Abend passieren wird.“
„Quintessenzen“ – die Druckausgabe der Gedichte von Ingrid Möller erschien erstmals 2006 in der edition NORDWINDPRESS Hof Grabow: Viele Dinge sind anders, als sie scheinen. Viele Menschen sind anders, als sie sich geben. Es ist schwer zu erklären, wie Gedichte entstehen. Manche Probleme fressen sich so tief ins Innere und scheinen unlösbar. Bis sie schließlich – auf den Kern reduziert – in knapp gefassten Worten auf einen Zettel gekritzelt werden müssen und somit ihre Schwere verlieren, erledigt sind, irgendwo abgelegt werden. Oder es gibt Beobachtungen, plötzlich wahrgenommene Besonderheiten, die sich gewissermaßen von selbst formulieren, auch in knappster Form. So fügen sich im Laufe eines langen Lebens aus unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Situationen Quintessenzen zusammen, die mitunter schon vergessen waren, dann aber im Zusammenhang einen überraschenden Sinn ergeben: eine Bilanz dessen, was im Leben als wichtig befunden wurde. Aber lesen Sie selbst:
„Mythen
Wozu erdachte man Mythen?
Um den Glauben zu stärken
an die Allmacht des Menschen
und an die Wunder,
die er vollbringt.
Doch der nur vermag
sie zu vollbringen,
dem die Flügel,
die er sich baute,
nicht abgesägt werden,
dem der Mut,
den er fasste,
nicht genommen wird,
kurz: dem ein menschlicher Mensch zu sein
nicht verwehrt wird.
Kausalität
Alles, was ich erlebte,
lebt in mir weiter.
Alles, was ich erlebte,
überzeugt mehr
als alle Theorien.
Alles, was ich erlebte,
hat mich geprägt.
Lyrik
Es reicht nicht aus zu preisen
des Mondes Silberglanz,
die Leuchtkraft der Sonne,
das Funkeln der Sterne.
Es reicht nicht aus
zu besingen
die Höhe der Wolken,
die Flugbahn des Vogels.
Das alles ist schön
und uns unentbehrlich
als der Stoff,
aus dem Träume man webt.
Doch die Erde,
die formbare,
die uns formt,
ist es nicht.
Dem dritten Buch seines großen Romanzyklus „Der Friede im Osten“ hatte Erik Neutsch den Titel „Wenn Feuer verlöschen“ gegeben. Es erschien erstmals 1985 im Mitteldeutschen Verlag Halle (Saale). Auf Wunsch des Autors wurde nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt: Was bleibt nur Symbol und worin besteht der tatsächliche geschichtliche Sinn, wenn in den Niederschachtöfen von Eisenstadt „die Feuer verlöschen“? Ein Werk, mit seiner Produktion einst lebensnotwendig für den jungen Arbeiter- und Bauern-Staat, wird „umprofiliert“, verschrottet. Dieser Prozess greift tief in die Schicksale, bis in die intimsten Beziehungen jener Figuren ein, die dem Leser bereits aus Erik Neutschs vorangegangenen Büchern seines großangelegten Romanwerkes „Der Friede im Osten“ bekannt sind: Achim Steinhauer und seine Frau Ulrike, Erich Höllsfahrt und Frank Lutter. Und andere treten neu in die Handlung, so der Parteisekretär Kühnau und der Werkleiter Diepold, die, jeder auf seine Art, von den Konflikten bis an die Grenze ihrer physischen Existenz getrieben werden. Überzeugend wird sichtbar, unter welcher Anspannung die Menschen am Ende der fünfziger und zu Beginn der sechziger Jahre um den Aufbau der neuen Gesellschaft kämpfen, wie sie die Macht der Arbeiter und Bauern verteidigen. Dabei erweist sich Erik Neutsch wiederum als ein Erzähler mit großem Atem, Sachkenntnis und geistig-moralischem Anspruch, dem es stets auch auf die „Profilierung“ seiner Helden in erregenden Bewährungssituationen ankommt. Und schon geht es los:
„Prolog: Zu zweit
Es geht in der Menschengeschichte wie in der Paläontologie. Sachen, die vor der Nase liegen, werden prinzipiell, durch a certain judicial blindness, selbst von den bedeutendsten Köpfen nicht gesehn. Später, wenn die Zeit angebrochen, wundert man sich, daß das Nichtgesehne allüberall noch seine Spuren zeigt.
Karl Marx (1868 in einem Brief an Friedrich Engels)
Es brauchte noch lange, fast das gesamte Jahr über, bis Achim auch im Letzten begriff, was mit Ulrike geschehen war. Dann endlich, so glaubte er jedenfalls, gab sie ihm keine Rätsel mehr auf, und es gelang ihm, sich in sie hineinzuversetzen und ihre Welt während ihrer Trennung voneinander so weit für sich zu erschließen, daß sie auch ihm gehörte.
Noch und noch hatte er seine Fragen gestellt. Es war ein Drängen und Bohren, Trachten und Quälen. Was ist gewesen… Warum hast du mir nicht geschrieben… Gab es andere nach mir? Ulrike fügte sich drein mit großer Geduld. Sie antwortete ihm, so gut sie vermochte, spürte jedoch bei jedem Mal, daß er sie morgen wiederum fragen und aushorchen und sie ihm wiederum würde antworten müssen wie am Tage zuvor. Ihr fiel es leichter, ihn zu verstehen. Studentenzeit! Was war daran denn schon Besonderes, Außergewöhnliches. Jeder besaß seine Chancen, sie selber inzwischen ihre eigenen Erfahrungen.
Oft aber verließen sie tagelang nicht ihre Wohnung, die beiden Mansarden, das Nest unterm Dach, und suchten erstaunt nach Stunde und Datum, wenn sie erwachten und sich wieder berührten, irgendwann in der Nacht und im Sonnenlicht, und schon alles Gefühl für Maße und Grenzen, erst recht für etwas wie Anfang und Ende verloren hatten. Zwei verzauberte Seelen! Sie lasen gemeinsam Romain Rolland. Die Uhren waren längst stehengeblieben, und Liebende sind ohnehin egoistisch (höchstenfalls füreinander empfänglich). Sie stürzten sich tief ineinander, umschlangen, verkrallten sich, mit Seufzern und Küssen und den unzähligen Erfindungen ihrer Leiber. Wie Bäume waren sie dann im Sturm, deren Äste und Zweige sich gegenseitig peitschten. Danach aber, nach der gestillten Gier, lagen sie Mund an Mund, hörten ihr Blut pulsen, zählten ihre Atemzüge und die Schläge ihrer Herzen. Dann war es, als würden sie weit von hier fortgetragen, im Halbtraum vielleicht, im Dämmer, als dehnte sich vor ihnen der unendliche Raum. Sie genossen dieses Gelöstsein, die Schwebe zwischen Ermattung und erneutem Verlangen. Bis die Glut wieder aufbrach und sie entfachte, der leiseste Windhauch bereits genügte, ein zärtliches Tasten, die kleinste Bewegung von ihm zu ihr…
Manchmal half die Nachbarin ihnen mit Einkäufen, hängte ein Netz mit Brötchen an die Tür und stellte zwei Flaschen mit frischer Milch vor die Schwelle. Kehrte sie abends jedoch aus der Schokoladenfabrik zurück, fand sie nicht selten beides noch unberührt. Vorsichtig klopfte sie an. Es mußte sie doch der Hunger plagen! Die Klinke gab nach. Die Nachbarin trat in den Korridor. Auch die Zimmer waren nicht abgeschlossen. Aber nur Ulrike vernahm die Geräusche. Sie erhob sich über ihm auf der Couch. Ihr Blick schien jedoch weit entrückt. Ihre Augen spiegelten Erschrecken und Wollust, Empörung und Triumph. Schließlich lächelte sie, wandte sich ihm wieder zu und schämte sich offenbar nicht einmal ihrer Nacktheit. Später entschuldigte sie sich.
„Ach, laß man sein, Kindchen“, entgegnete die Nachbarin. „Tobt euch nur aus. Bei uns war es nicht anders.“
„Vier Jahre, jeden Tag, jede Nacht hab ich auf ihn gewartet.“
„Ja. Aber ihr müßt auch wieder vernünftig werden. Fahrt euer Heu nicht schon ein, wenn es noch naß ist.“
Hin und wieder (und wirklich nur hin und wieder) fragte Achim Ulrike, wie alles geschehen sei, damals, nach seinem letzten Besuch in der Klinik, als er gekommen war, um sie abzuholen, statt ihrer jedoch in dem Krankenbett nur ein altes Mütterlein angetroffen habe. Sie küßte ihn. Und was wäre ihr sonst für eine Entgegnung geblieben? Die Mutter hatte ihr bereits einen Koffer mit Kleidung gebracht und fuhr tags darauf in Begleitung Ingeborgs mit einem Auto vor, an dessen Steuer ein Chauffeur saß. Ulrike glaubte zunächst, es sei ein Taxi, und zweifelte keinen Augenblick, daß sie nun wieder in Bad Solau, in der Villa der Frau von Pfuel wohnen würde. Alle Schmerzen, alle Bitternis ließ ich hinter mir, und nicht einmal mein kurzes und dünn gewordenes Haar störte mich noch.
Neben der Schwester im Fond, schloß sie die Lider und lehnte sich glücklich mit den Gedanken an ihn, Achim, zurück ins Polster. Ein wenig erschöpft aber war ich wohl ebenfalls. Doch dann, nach halbstündiger Fahrt, als sie zum ersten Mal am Straßenrand Schilder mit fremden Ortsnamen auftauchen sah, wurde sie mißtrauisch.
Die Mutter entschloß sich zu einer Erklärung. Bereits nach Weihnachten hätten sie, Ingeborg und der Vater den Wohnsitz gewechselt. Die Luft im Erzgebirge sei Medizin für sein Asthma… Eine fadenscheinige Begründung, wie sich später herausstellte. Es war allein die Angst vor dem Gerede der Leute, die sie von Graubrücken forttrieb, die Furcht vor der Schande, in die Ulrike, wie sie meinten, die Familie gestürzt habe. Sie aber dachte: Und wenn sie mich bis ans Ende der Welt verschleppen, er wird mich finden. Ich schreibe ihm meine Briefe, und alles wird gut.
Das Dorf bestand im wesentlichen (womit es der Regel für seinesgleichen in dieser Landschaft folgte) aus einer langgestreckten, sich dem Tal und den Hängen in sanften Windungen anpassenden Hauptstraße, von der nur ein paar steinige, jedoch ungepflasterte, sich bald in Wiesen und Felder verlierende Nebenwege abzweigten. Hier wurden die Häuser immer kleiner und hutzliger, die Bewohner darin von Tür zu Tür ärmer. An der Straße hingegen, besonders im oberen Teil, der hügelan führte, befanden sich die Grundstücke der wenigen Reichen, und als deren wuchtigstes, gleich mehrere Gebäude umfassend und nur noch überragt von der Kirche, beherrschte der Besitz des Bürstenfabrikanten Kilian den Ort.
Als Ulrike dort einzog, war sie knapp neunzehnjährig und, was viel schwerer wog, von der reinsten Naivität. Sie ahnte nicht im entferntesten, was auf sie zukommen würde. Sie wunderte sich nicht einmal darüber, daß bereits am Tage ihrer Ankunft die neuen Verwandten sich mit Christus und seinen Jüngern, besonders dem Johannes, so angeregt unterhielten, als säßen sie mit ihnen bei Tische, und den Propheten Elias sogar zum Abendbrot einluden. Ähnliches, wenngleich nicht mit solch okkultistischem Aufwand, war sie ja von Hause gewöhnt.“
Den vierten Teil seines großen Romanzyklusses „Der Friede im Osten“ hatte Erik Neutsch „Nahe der Grenze“ getauft. Die Druckausgabe erschien erstmals 1987 beim Mitteldeutschen Verlag Halle (Saale). Auf Wunsch des Autors wurde nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt: Nahe der Grenze zur CSSR, in den Wäldern des Erzgebirges, begegnen wir Achim Steinhauer wieder, dessen Lebensweg eine überraschende Wende genommen hat: Vom Drang nach Selbstbehauptung erfüllte Jahre als Gleisbauer, Fernfahrer und Mitarbeiter einer Vogelwarte liegen hinter ihm seit jenem Abschied aus Eisenstadt. In dieser Zeit hat er zu schreiben begonnen, eine Erzählung wird publiziert, die er mit Soldaten und Offizieren in einem Feldlager der NVA nach den Ereignissen vom August 1968 diskutiert. Doch in diesen Tagen erfuhren er und Ulrike auch von Ilse Lutters plötzlichem Tod. Was ist geschehen? Ins Zentrum dieses Romans von Erik Neutsch rückt die Geschichte um Frank Lutters Ehe. Er hat promoviert und befindet sich im Aufstieg. Bohrend sind die Fragen, wieweit ihm dabei seine Frau und Lina Bonk, die Journalistin, zu helfen vermögen, und hat die Freundschaft zwischen ihm und Achim Steinhauer noch eine Chance? Nahe der Grenze – der Titel des Buches wird zum Bild für die inneren und äußeren Vorgänge, die der Leser miterlebt. Steigen wir ohne viele Umstände hinein in die packende Handlung friedlich-unfriedlicher Zeiten:
„ERSTES KAPITEL: Das Lager im Gebirge
Welch ein Unruheherd ist die menschliche Seele, die zu befrieden wir kein Mittel scheuen, aber welche Mittel wir auch immer anwenden und uns gegenseitig vorschreiben: diese Unruhe ist nicht zu bändigen, und erneut bricht der Aufstand im Menschen los.
Johannes R. Becher
(1950, 14. April, in seinem Tagebuch)
Wir schrieben das Jahr 1968. Im Sommer hatten zwei Divisionen der Nationalen Volksarmee, in Übereinstimmung mit den vereinigten Streitkräften des Warschauer Paktes, den Auftrag erhalten, die Grenzen der Republik zur Tschechoslowakei zu sichern. Am Abend des 20. August wurden sie schließlich in erhöhte Gefechtsbereitschaft versetzt. Über Nacht verließen sie ihre Konzentrierungsräume, die sie angesichts der Ereignisse in unserem Nachbarland bereits Wochen zuvor bezogen hatten, und rückten in Richtung Süden vor, den Gebirgen entgegen. Wie alle alarmierten Einheiten, so erreichte auch das aus der Garnison Halle stammende 27. Mot.-Schützen-Regiment in nur wenigen Tagen den ihm neu zugewiesenen Standort. Mit seiner Spitze drang es bis an die obere Bockau am Fuße des Auersberges vor, ehe ihm hier, schon die Kämme vor Augen, die die Grenze nach Böhmen bilden, der Befehl zum Halt erteilt wurde. Seitdem hatte es in einem Terrain von Höhen und Tälern mit unübersehbaren Wäldern, auf der Karte etwa in dem Oval zwischen den Städten Auerbach, Schwarzenberg, Johanngeorgenstadt und Klingenthal zu erkennen, sein Lager aufgeschlagen.
Als Achim Steinhauer dort eintraf, spät im September und im Dauerregen, schien jedoch die größte Gefahr, die wieder einmal den Frieden bedroht hatte, gebannt zu sein. Dennoch blieb die Lage kritisch, und so mußten sich unsere Soldaten noch auf längere Zeit im Erzgebirge wie in einem Warteraum einrichten. Sie lebten unter Gefechtsbedingungen. Auch Achim nahm davon Kenntnis, bemerkte es schon bei seiner Ankunft an den unterschiedlichsten Zeichen. Wie mit Bernd Höllsfahrt brieflich vereinbart, war er von ihm am Bahnhof von Aue abgeholt worden, und zwar im Auto des Regimentskommandeurs, einem Wartburg mit der soeben erst neukreierten Karosserie und von graugrüner Farbe. Obwohl der Wagen und erst recht seine Nummer jedem Angehörigen der Einheit vertraut sein mußten, wurde er trotzdem, lange bevor sie das Lager erreichten, mitten in der Kurve einer steil aufsteigenden Straße von einer Feldwache mit anschlagbereiten Maschinenpistolen gestoppt. Man forderte sie auf, das Fahrzeug zu verlassen. Da es schon dämmerte, blitzte eine Stablampe auf und leuchtete das Wageninnere ab. Höllsfahrt nannte zwar die Parole und fügte ein paar erklärende Worte hinzu, aber der Postenführer verlangte trotzdem Achims Ausweis, um ihn gründlich zu kontrollieren.
Bernd Höllsfahrt also, im Range eines Oberleutnants inzwischen, hatte ihn hierher eingeladen. „Deine Erzählung“, hieß es in einem seiner Briefe, „hat auch bei uns die Gemüter erregt. Es wäre deshalb schön, wenn Du einmal kommen würdest, um mit uns darüber zu diskutieren. Ich bitte Dich darum (wenn ich’s so nennen darf) im Namen unserer alten Freundschaft. Wir ersaufen hier fast im Regen, und unsere Genossen könnten eine Ermunterung dringend gebrauchen …“
Da hatte er Professor Beesendahl unterrichtet, daß sich seine Ankunft im Institut noch verzögern würde, und war gefahren. Natürlich fiel ihm sofort auch ein, daß es dieselbe Strecke war, auf der Ulrike gelegentlich reiste, um ihre kränkliche Mutter und (doch die wohl weniger) ihre Schwester zu besuchen. Hundshübel befand sich in der Nähe. Später erfuhr er, ein Stück des Dorfes würde bald der mächtigen Talsperre weichen müssen, die zwischen ihm und Eibenstock erbaut werden sollte. Hoffentlich, dachte er, fällt den Fluten dann auch dieses gottverdammte Haus zum Opfer, das für Ulrike zum Gefängnis geworden war. Und hatte er nicht in dieser Gegend einmal am schon von Goethe bewunderten Filzteich die goldgelb blühenden Trollblumen entdeckt?
Es regnete unaufhörlich. Immer dichter wurden die Wälder, verschlammter und immer schwieriger zu passieren die Wege. Der Fahrer hatte trotz aufgeblendeten Scheinwerferlichts alle Mühe, für die Räder, die mehrmals durchzudrehen drohten, griffigen Untergrund zu finden. Auch die Dämmerung sank immer tiefer. Doch so dunkel war es noch nicht, als daß nicht Achim in einer Schneise zwischen den Fichten, obwohl hinter aufgeschütteten Wäldern halb verborgen und mit Tarnnetzen überspannt, die Panzer erspäht hätte. Er machte sogar ihren Typ noch aus und erkundigte sich bei Höllsfahrt, ob er sich nicht geirrt hatte. Der schüttelte den Kopf. Stimmt. T 54.
Nach einer erneuten, jetzt jedoch eher routinemäßigen Kontrolle gelangten sie endlich auf eine Wiese, die, soweit es das diffuse Licht der an Kabeln aufgehängten und im Wind schaukelnden Lampen zu erkennen gab, von mehreren großräumigen Zelten umstellt war. Vor einem davon hielt der Wagen. Sie stiegen aus, schienen bereits erwartet worden zu sein. Denn kaum verstummte der Motor, kam ihnen, was Bernd ihm noch hastig im Flüsterton zusteckte, der Regimentskommandeur bis unter die Plane entgegen, die den Zelteingang überdachte. Der Mann, schätzte Achim, ein Oberst, war in seinem Alter. Er fühlte sich von ihm mit seltsam taxierenden Blicken empfangen.
Bernd Höllsfahrt nahm militärische Haltung an, führte die rechte Hand an seine Feldmütze und erstattete Meldung. Der Oberst dankte, winkte dann aber ab. „Lassen Sie es gut sein, Genosse Oberleutnant. Ich denke, wir wollen es weniger formell angehen. Wir sind – wie ich unlängst sogar in der Zeitung lesen konnte – in derselben Partei, und so heiße ich Sie fürs erste herzlich willkommen, Genosse Schriftsteller.“
„Nein, ich bin keiner.“ Achim glaubte sofort, er habe zu schnell geantwortet, hätte wohl erst den Gruß erwidern sollen, was er nun nachholte. Dennoch, er empfand sich wirklich nicht als Literat. Zu viele Bedenken verbanden sich für ihn mit diesem Wort. „Ich habe etwas geschrieben, was vielleicht nicht ganz unnütz ist. Doch von Beruf bin ich Biologe.“ Ja, sein Weg hatte ihn wieder dorthin geführt, wozu ihn sein Studium einst befähigt hatte.
„Bitte, treten Sie ein.“
Es war das Stabszelt, ausgelegt mit einem Fußboden aus roh zusammengezimmerten Brettern, unter denen das Gras wucherte. Durch die Ritzen ragten hier und dort vergilbte Halme. In seiner Mitte war aus mehreren Tischen eine Tafel in Hufeisenform aufgebaut worden, an der etwa zwei Dutzend Gäste bequem Platz finden konnten. Soeben waren Soldaten vom Küchendienst dabei, sie mit weißen Tischtüchern und Geschirr einzudecken.
Anschließend trugen sie das Abendbrot auf, Platten mit Aufschnitt und diverse Getränke. Oberst Dehmols, wie der Kommandeur hieß, ließ sie gewähren. Achim wußte aus den Briefen Bernds, daß zunächst ein Gespräch zwischen ihm und den Führungsoffizieren des Regiments vorgesehen war, ehe er in den kommenden Tagen verschiedene Einheiten besuchen sollte. Auch Dehmols, nun schon längst nicht mehr mit dem seltsamen Blick in seinen braunen Augen, erinnerte ihn jetzt daran, als sie sich in einer Ecke des Zeltes auf ein paar, freilich schon leicht lädierten Sesseln gegenübersaßen. Auf die Planen über ihren Köpfen trommelte der Regen. „Wir haben noch Zeit, bis meine Genossen hier eintreffen. Neunzehn Uhr dreißig war befohlen. Möchten Sie unterdessen einen Erfrischungstrunk? Kaffee? Oder doch lieber einen Kastell?“
Achim nickte zu beidem, und während der Kommandeur, der inzwischen Höllsfahrt und die Soldaten verabschiedet hatte, an die Tafel ging, um selbst die Getränke zu holen, überließ er sich seinem Schweigen. Er fühlte sich ungewohnt in seiner Rolle. Gewiß, sie schmeichelte ihm, doch ein solcher Empfang machte ihn noch immer verlegen. Was eigentlich war denn anders geworden seit damals, seit seiner Parteistrafe vor sechs Jahren, seiner Demission von Eisenstadt? Er wußte nur, es war ihm wiederum nichts geschenkt worden, im Gegensatz zu allem, was einst Lutter von ihm behauptet hatte. Er hatte sich durchgebissen, ja, durchgebissen – das war es. Stück um Stück auch mit dieser Erzählung, die nach ihrem Erscheinen dann mit einem Preis ausgezeichnet worden war und derentwegen er nun ebenfalls eine Einladung hierher zur Armee erhalten hatte. Doch geschrieben hatte er sie von ihren wohl mehr als einem Dutzend Anfängen bis ans bittere, wenn auch erlösende Ende nur für sich. Er hatte sich freigeschrieben mit ihr, und am allerwenigsten war ihm in den Sinn gekommen, sie drucken zu lassen und mit ihr seinen Namen ausgestellt zu sehen. Was allerdings danach mit ihr (und ihm) geschehen war, würde selbst für ihn ein Geheimnis bleiben. Nein, sprechen konnte er darüber nicht. Weder anderswo noch vor den Offizieren, die in diesem Moment in nur kurzen Abständen das Zelt betraten, unter ihnen auch wieder Höllsfahrt. Er war ja schon auf die Frage von Dehmols soeben, wie man Schriftsteller wird, in ein ziemlich hilfloses Gestammel verfallen.“
Schon bei diesen beiden kurzen Ausschnitten ist gut zu erkennen, wie kraftvoll und konfliktreich Erik Neutsch auch in den Bänden 3 und 4 wieder zu erzählen versteht. Wie schon anfangs gesagt: Beide Bücher sind nicht zuletzt eine Herausforderung an ihre Leserinnen und Leser – eine Herausforderung an die Lust am Streit über historische Einschätzungen, an die Lust an mitunter derben Formulierungen und an das Durchhaltevermögen der Leserinnen und Leser gegenüber dicken Büchern. Aber es lohnt sich. Versprochen.
Viel Spaß beim Lesen, ein Lob den Konflikten und bis demnächst.
EDITION digital wurde 1994 gegründet und gibt neben E-Books (vorwiegend von ehemaligen DDR-Autoren) Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern.
Insgesamt umfasst das Verlagsangebot derzeit rund 900 Titel (Stand Mai 2018)
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de