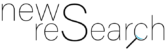Außerdem ist in dieser Woche ein E-Book von Ulrich Hinse für eine Woche zum Superpreis von nur 99 Cents zu haben. Mehr dazu am Ende dieser Ausgabe. Und nun zurück zum Thema Ausgrenzung wegen einer anderen Hautfarbe:
Erstmals 2002 erschien im damaligen Projekte Verlag Halle „Peggy Vollmilchschokolade“ von Siegfried Maaß: Ihr seltsames und fremdes Aussehen hatte Peggy natürlich schon bemerkt, ehe sie ein Schulkind geworden war und wenn es ihr damals nicht selbst aufgefallen wäre, hätten die Bemerkungen der anderen Kinder sie darauf aufmerksam gemacht. Sie erinnert sich, dass einmal ein Junge, der nur etwas größer war als sie selbst, zu ihr herantrat, vorsichtig seinen Finger ausstreckte und damit ihre Wange berührte. „Du bist ja ganz braun“, sagte er erstaunt und betrachtete dann aufmerksam seinen Finger und schien sich zu wundern, dass der nicht ebenfalls braun geworden war. Das war, als sie sich nach einem Spaziergang im Stadtpark von der Hand der Mutter losgerissen hatte, um den Spielplatz zu erobern, der verlassen und scheinbar völlig vergessen vor ihr in der Sonne lag. Aber lernen wir das kleine Mädchen „Vollmilchschokolade“ überhaupt erst mal kennen – und zwar an einem Morgen, der für sie wie fast jeder Morgen nicht immer freundlich beginnt:
Jeden Morgen, wenn Peggy im Bad vor dem großen Spiegel steht, fällt ihr erneut auf, dass sie so ganz anders aussieht als Stefan und die übrigen Kinder in ihrer Klasse. Oder als ihr großer Bruder Mike und auch ihre Mutter. Dann wischt sie manchmal wütend über die Spiegelscheibe, als könnte sie damit das Bild, das sich ihr bietet, auslöschen oder zumindest nach ihren Wünschen verändern. Aber alles bleibt so, wie es schon seit sieben Jahren ist: Die kurze dicke Nase, die ihre Mutter als ‚Stupsnase‘ bezeichnet, und das schwarze krause Haar, das buschig vom Kopf absteht und das sie mit keinem normalen Kamm bezwingen kann. Ihre Augen sind so dunkel, dass sie manchmal selbst erschrickt, wenn sie sich ansieht und ihre Haut hat die Farbe von Vollmilchschokolade.
„Richtig zum Anbeißen“, hat dann auch mal jemand zu ihr gesagt und nachdem die Frau, die eine Bekannte ihrer Mutter war, sie sogar auf die Wange geküsst hatte, prüfte Peggy erst einmal vorsichtig, ob die Frau nicht tatsächlich ein Stück von ihr abgebissen hatte. Aber zum Glück fehlte nichts von ihrem Gesicht und es gab auch kein Loch in ihrer Wange. Trotzdem war sie seitdem sehr vorsichtig, wenn sie die Frau zufällig trafen, die ihr Hündchen ausführte, das so aussah, als hätte sie es selbst gestrickt. Meistens hielt sich Peggy dann an der Hand der Mutter fest und versteckte sich sogar hinter der Mutter, sobald sich die Frau zu ihr hinab beugte. Von ihr wollte sich Peggy weder berühren oder auch nur übers Haar streichen lassen.
„Was hat sie denn nur?“, fragte die Frau Peggys Mutter darauf. Dann sah sie auf Peggy hinunter und schüttelte verständnislos den Kopf, wobei ihre langen blonden Haare wie ein Tuch im Wind flatterten. „Ich tu dir doch gar nichts.“ „Komm vor“, sagte die Mutter dann lachend und zog Peggy sanft nach vorn, sodass sie nun der Frau wieder gegenüber stand. Doch die rührte keine Hand mehr, um Peggy zu streicheln und die Lust zu einem Kuss auf Peggys Wange schien ihr dieses Mal auch vergangen zu sein. Sie bückte sich stattdessen zu ihrem Hündchen hinunter und strich beruhigend über dessen struppiges Fell, nachdem es böse zu knurren begonnen hatte, weil es wohl nicht begreifen konnte, dass jemand sein Frauchen nicht leiden mochte.
Ihr seltsames und fremdes Aussehen hatte Peggy natürlich schon bemerkt, ehe sie ein Schulkind geworden war und wenn es ihr damals nicht selbst aufgefallen wäre, hätten die Bemerkungen der anderen Kinder sie darauf aufmerksam gemacht. Sie erinnert sich, dass einmal ein Junge, der nur etwas größer war als sie selbst, zu ihr herantrat, vorsichtig seinen Finger ausstreckte und damit ihre Wange berührte. „Du bist ja ganz braun“, sagte er erstaunt und betrachtete dann aufmerksam seinen Finger und schien sich zu wundern, dass der nicht ebenfalls braun geworden war. Das war, als sie sich nach einem Spaziergang im Stadtpark von der Hand der Mutter losgerissen hatte, um den Spielplatz zu erobern, der verlassen und scheinbar völlig vergessen vor ihr in der Sonne lag.
„Peggy!“, rief die Mutter, aber Peggy achtete nicht darauf. Endlich würde ihr der schöne große Spielplatz einmal ganz allein gehören! Zuerst kletterte sie auf das Eisengerüst und kreischte erschreckt auf, weil die einzelnen Stäbe in der Sonne heiß geworden waren. Indem sie ihre in den Knien eingeknickten Beine wie ein Paar Haken benutzte, ließ sie mutig den Kopf herabhängen, der plötzlich von ihrem Rock wie von einem Vorhang verdeckt wurde. Als sie davon genug hatte, nahm sie einen weiten Anlauf und schwang sich auf das kleine Karussell, wo sie so lange ausharrte, bis es wieder stillstand. Anschließend lief sie zur Wippe, wo es ihr aber allein kein Vergnügen bereitete, sodass sie zu guter Letzt in den Sandkasten sprang, wo der Sand aufspritzte wie das Wasser in der Wanne, wenn sie mit der flachen Hand darauf schlug. Der Sand war sehr warm, was Peggy gut gefiel, genau wie heißes Badewasser und am liebsten hätte sie jetzt ‚Engel‘ gespielt und sich im Sand auf den Rücken gelegt und Arme und Beine weit von sich gestreckt.
Aber sie wusste, dass die Mutter es nicht leiden konnte, wenn sie sich schmutzig machte und unterließ es darum. Die Mutter hatte sich inzwischen auf eine der Bänke gesetzt, die im Schatten großer Kastanienbäume standen und Peggy sah, dass sie sich eine Zigarette anzündete und sie hoffte deshalb, dass sie selbst nun genug Zeit zum Spielen haben würde. Bald darauf setzte sich eine fremde Frau auf eine der anderen Bänke und der Junge, der zu ihr gehörte, kam langsam auf den Sandkasten zu und blieb dann bewegungslos davor stehen. Er sah Peggy neugierig an, ehe er schließlich zu ihr trat und mit seinem Finger ihre Wange berührte. „Das ist von der Sonne in Afrika und färbt nicht ab“, sagte Peggy, als sie bemerkte, wie der Junge erstaunt seinen Finger betrachtete. Dann versteckte er ihn unter den anderen und ballte eine Faust.“
Erstmals 1982 brachte der Kinderbuchverlag Berlin für Leser ab 10 Jahren das spannende Buch „Allein über den Fluss“ von Martin Meißner heraus: Mut muss man haben. Das allein zählt. Soweit ist sich Heino sicher. Aber weiter weiß er nicht. Dabei ist er wirklich kein Feigling. Und doch: als es drauf ankam, hat er versagt. Da war die Angst größer als er, hat ihn besiegt. Heino ist wütend. Auf sich. Aber auch auf den Fluss, der des einen Freund, des anderen Feind ist. Genauso, wie es die alten Sagen der Schiffer berichten. Kapitän Stüber, Heinos Vater, sieht das ganz anders. Er meint, man müsse die Gefahren des Stromes nur gut kennen, dann gäbe es keine unüberwindbaren Hindernisse. Heino möchte stark und furchtlos sein wie der Vater. Das gelingt ihm nicht. Aber tapfer ist er doch, als er sich allein aufmacht, um den Fluss zu überqueren. Allerdings treffen wir zu Beginn des Buches und seines 1. Kapitels zunächst weder Heino noch seinen Vater, Kapitän Stüber, sondern Charlotte, die von den meisten aber „Scharli“ genannt wird:
„Als Scharli im Herbst wieder nach Buttstein kam, wurde sie traurig und froh. Ihre beiden Freunde waren fort. Den Feuerräuber traf sie nicht mehr. Das war schlimm. Verschwunden war auch die Käte, ein alter Motorkahn, der lange im Buttsteiner Hafen lag. Das freute sie.
Das Mädchen stellte die Reisetasche bei ihrer Tante Helga ab, richtete die Grüße der Eltern aus und wollte gleich in die Stadt verschwinden. Vorher musste sie noch einen Happen essen, wie die Tante es nannte. Diese hatte keine Kinder, war aber fest davon überzeugt, ein junger Mensch müsste unwahrscheinlich viel verzehren, um einmal ein großer schwerer Erwachsener zu werden. Nun lehnte sie mit verschränkten Armen am Kühlschrank und schaute glücklich zu, wie Scharli den Berg der leckeren Speisen abzutragen versuchte. „Zier dich nicht, Charlotte“, spornte sie ihre Nichte an. Sie und Onkel Siegfried waren außer den Lehrern wohl die einzigen Menschen in Buttstein, die wussten, dass das Mädchen Charlotte hieß und nicht Scharli, wie alle sie nannten.
„Iss mal schön!“
Es war zwecklos, sich zu wehren. Das ganze Frühjahr über, als ihre Mutter den Lehrgang besuchte, hatte Scharli bei ihrer Tante Helga alle Freuden und Qualen einer üppigen Verpflegung genossen. Endlich aber war diese zufrieden, und das Mädchen bekam den Rest des Nachmittags frei. Ihr erster Weg führte sie zum Buttsteiner Hafen hinunter, um Herrn Nobitz, den Kapitän der Käte, zu begrüßen.
Der Buttsteiner Hafen aber war kein Hafen mit bunten Schiffen und hohen Drehkränen. Er hieß nur so. Die Binnenschiffe, die auf dem Strom flussauf, flussab vorüberkamen, hielten hier kaum. Meist gingen sie auf dem offenen Wasser vor Anker. Sie hatten es aufgegeben, gegen den Schilfwald im Hafen anzukämpfen, der vom Rand her seinen siegreichen Eroberungszug angetreten hatte. Nur die Käte ergab sich bislang nicht. Sie hielt ihren Liegeplatz und eine schmale Fahrrinne zum Strom von den Pflanzen frei.
Als Scharli ankam, wollte sie ihren Augen nicht trauen. Wo sonst der stolze Motorkahn lag, zeigten sich nun lediglich kleine Wellen, die wie fliehend flink zwischen die Schilfhalme huschten. „Hier lag doch mal ein Schiff“, wandte sich das Mädchen an einen Mann, der in der Nähe Eisenstangen auf einen Anhänger lud.
„Wo?“
„Na hier. Wo kein Schilf gewachsen ist.“ Der Mann zuckte mit den Schultern. „Du, Walter!“, rief er dann in eine unbestimmte Richtung. „Hier soll ein Schiff gelegen haben. Weißt du was?“
„Na klar“, kam es von irgendwo. „Die Käte. Sie liegt doch noch da.“
„Hier ist kein Schiff!“
Nun war die Stimme verstummt. Nach einer Weile erst knackte und knirschte es, und ein Mann mit einem Hut auf dem Kopf bahnte sich zwischen Distel- und Brennnesselstauden einen Weg. „Tatsächlich“, sagte er und ging über die bröcklige Mole an den Rand des Hafenbeckens. „Wenn ich es nicht sehen würde, meine Ehre, ich täte behaupten, das Schiff liegt noch hier.“
„Ich wollte den Schiffer besuchen“, erklärte Scharli. „Er war mein Freund.“
„Der Nobitz? Ja der“, sagte der Mann mit dem Hut. „Der war ein wunderlicher Kerl. Er strich sein Schiff immerzu an, ölte alles ein und probierte dauernd seinen Motor aus. ,Ahoi, Kapitän“, sagten die Leute, wenn sie sonntags hier auf der Mole spazieren gingen, „wann stecht ihr in See?‘ Ihnen antwortete er nicht. Doch den Kindern winkte er zu, als hätte er bereits die Leinen losgemacht.“
„Aber nun ist er weg“, stellte der Mann mit den Eisenstangen fest.
„Ja“, sagte der andere. „Haha, das hätten die Leute am Sonntag wohl nicht gedacht. Wo er nur hin sein mag?“
„Nach Samarkand“, sagte Scharli. „Er ist nach Samarkand.“
„Mag sein“, sagte der mit dem Hut.
Scharli freute sich über ihre Entdeckung sehr. Hatte sich der Traum des alten Schiffers erfüllt? Diese Neuigkeit musste sie sofort Heino erzählen. Scharli lief zum Schifferinternat. Aber der Junge wohnte nicht mehr dort.
„Es kann nicht stimmen“, sagte Scharli zu einem blonden Mädchen, das aus dem Fenster des großen Backsteinhauses sah. „Vielleicht kennst du ihn gar nicht. Ich meine Heino Stüber, Klasse 5.“ So konnte sie noch nicht fortgehen. Sie heftete ihren Blick auf den Gehsteig, der von Kastanien übersät war. Nach einer Weile öffnete sich das Tor. Ein Junge schob sein Fahrrad heraus.
„Frag doch Ralfi da“, meldet sich das Mädchen im Fenster noch einmal. „Stimmt doch, Ralfi, der Heino ist weg?“
„Klar!“
„Ich wollte ihm was sagen“, erklärte Scharli. Sie trat an den Vorgartenzaun und stützte sich mit den Unterarmen auf.
„Ist es denn so wichtig?“, fragte das Mädchen im Haus.
„Ja.“
„Vielleicht kann Fräulein Müller es ihm schreiben. Sie kennt die Adressen von allen Ehemaligen. Was ist es denn?“
„Ich weiß nicht mehr“, antwortete Scharli. „Wie ist er denn weg?“
„Ganz sonderbar“, erinnerte sich das Mädchen. „Ein Mann war gekommen, der war so groß, dass er gar nicht zu Heino passte. Sie haben alle Sachen in einen Sack getan. Und der Mann trug den großen Sack auf dem Rücken fort. Er nahm Heino an die Hand. In Richtung Hafen sind sie davongegangen. Wie sie weggingen, das kann man gar nicht vergessen. Eine Möwe war dabei. Sie flog neben den beiden her. Ein ganzes Stück voraus, dann wieder zurück oder auch im Kreis herum. Sie kreischte schrecklich, und ab und zu stand sie in der Luft und schlug ganz wild mit den Flügeln. Und dann das Verrückteste: Sie ließ sich an die Erde gleiten, ergriff mit dem Schnabel ein Hosenbein des Mannes und ließ sich über den Boden mitschleifen. Ruckweise. Immer wenn der Mann das rechte Bein vorhob, kam auch die Möwe den Schritt voran. Ich habe noch die anderen gerufen. Diese verrückte Möwe musste man gesehen haben.“
„Ignaz war das“, sagte Scharli.
„Wer war Ignaz?“
„Die Möwe.“
Scharli bedankte sich, zögerte aber noch etwas. Sie wollte nicht glauben, dass der Feuerräuber fortgezogen war.“
EDITION digital brachte 2012 als E-Book den zweiten Teil der „Abenteuer-Zauberlöwe“-Reihe „Der Löwe und die Inselbande“ von Klaus Möckel heraus: Dieser zweite Band der Reihe mit dem Zauberlöwen enthält neue aufregende Abenteuer. Am Ufer eines Sees beobachten Florian und Mareike einen höchst verdächtigen Mann, der in einem Kahn von der gegenüberliegenden Insel heranrudernd, sein Boot im Schilf versteckt. Sie vermuten ein Geheimnis und setzen selbst über. Den Löwen nehmen sie natürlich mit. Doch mit dieser Tat begeben sie sich in große Gefahr. Auf dem Eiland halten Banditen einen Jungen gefangen, um Lösegeld zu erpressen. Sie entdecken die Kinder und machen Jagd auf sie. Als Florian dann noch das Zauberei verliert, mit dem ihr vierbeiniger Freund zu Hilfe gerufen werden kann, sieht es düster aus. Mareike und Florian brauchen all ihren Mut und ihre Schlauheit, um dagegenhalten zu können. Zunächst aber scheint es noch nicht so gefährlich zu sein. Anfangs handelt es sich nur um einen „Schreck am Nachmittag“:
„Oma Klatt ging um das Brombeergebüsch herum und trat auf die Wiese hinaus. Vom vielen Bücken tat ihr der Rücken weh und sie wollte sich gerade kräftig recken, als sie jäh erstarrte. Ein spitzer Schrei entrang sich ihrer Brust. Der Korb, den sie am Henkel gefasst hielt, entglitt ihrer Hand und fiel zu Boden. Nach allen Seiten hin rollten die Pilze durchs Gras. „Hilfe!“, rief Oma Klatt, drehte sich um und stürzte in den Wald zurück.
Ihr Mann, der wenige Schritte entfernt gerade eine prächtige Braunkappe abgeschnitten hatte, sah erstaunt auf. „Was ist denn los? Wo hast du deinen Korb?“
„Mein Korb? Er liegt … dort.“ Sie blieb stehen und deutete ängstlich nach hinten.
Opa Klatt schüttelte verständnislos den Kopf. „Nun beruhige dich mal. Warum schreist du um Hilfe? Man könnte meinen, du hast ein Krokodil oder wenigstens eine Giftschlange gesehen.“
Die Frau fasste sich etwas. „Kein Krokodil und auch keine Giftschlange“, flüsterte sie. „Ich kann’s selber nicht glauben, aber es war … ein Löwe!“
„Ein Löwe?!“
„Ja. Mit gelbem Fell und einer dicken Mähne. Er stand vor mir, keine fünf Meter entfernt, ich schwör’s!“
„Also, weißt du", murmelte Opa Klatt vorwurfsvoll, „manchmal könnte man an deinem Verstand zweifeln. Ein Löwe auf Möllers Wiese! Was denn noch alles? Und deshalb schmeißt du nun deine herrlichen Pilze weg.“ Er wollte an ihr vorbei, um den Korb zu holen, doch sie hielt ihn am Ärmel fest. „Geh nicht hin, bitte!“ „Das hält man doch nicht für möglich“, sagte Opa Klatt und machte sich energisch los. „Hörst du etwa irgendein Raubtier brüllen? Nein, nicht einmal ein Hund bellt. Wir sind seit zwei Stunden im Wald unterwegs. Sollen wir wegen diesem Quatsch unser Abendbrot im Dreck liegen lassen?“
Oma Klatt murmelte: „Aber wenn ich ihn doch gesehen habe. Vielleicht ist er weggelaufen. Aus einem Zoo.“
Ihr Mann freilich war schon bei dem Strauch und stand gleich darauf an der Stelle mit dem Korb. Der lag auch noch da, genau wie die Pilze. Ein Tier dagegen war nirgends zu erblicken. „Ich hab’s doch gewusst“, brummte der Alte und hockte sich ächzend hin, um die Pilze aufzusammeln. „Ein Löwe, so ein Blödsinn!“ Er rief nach seiner Frau, die nun all ihren Mut zusammennahm und sich wieder zu ihm gesellte. Trotzdem suchte sie ängstlich mit ihren Blicken die Wiese ab. Statt eines Löwen sah sie allerdings nur weiter rechts am Waldrand zwei Kinder mit Fahrrädern. Oma Klatt hätte die beiden am liebsten nach der Raubkatze gefragt, aber mittlerweile zweifelte sie an sich selbst. Außerdem waren die Kinder zu weit weg. Immer noch verstört, half sie ihrem Mann, den Korb wieder zu füllen.
Der Junge und das Mädchen dagegen sahen zu, dass sie Land gewannen. „Du hättest Rex-kun nicht rauslassen sollen“, sagte Mareike, während sie einen Feldweg entlangstrampelten. „Hier sind zu viele Leute.“ „Ich konnte doch nicht wissen, dass die beiden Alten plötzlich aus dem Wald kommen“, erwiderte Florian. „Sonst war ja weit und breit niemand.“ „Pilzsammler gibt’s um diese Jahreszeit überall“, wandte Mareike ein, um dann altklug hinzuzufügen: „Na ja, es wird immer wieder mal passieren, dass er jemanden erschreckt, das lässt sich nie ganz verhindern.“
Die beiden besaßen tatsächlich einen Löwen, aber das ist eine Geschichte, die sich nicht so einfach erklären lässt. Etwa vor einem Jahr war nämlich etwas höchst Ungewöhnliches geschehen. Florian hatte von seiner Tante Anja ein Tamagotchi geschenkt bekommen, das sich als total irre erweisen sollte. Er hatte sich nie so ein Ding gewünscht – was sollte er schon mit solch einem Plastik-Ei anfangen. Das Spielzeugtier auf dem Display war etwas für kleine Mädchen und zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr der letzte Schrei. Mehr aus technischem Interesse hatte Florian später das Tamagotchi in Gang gesetzt, die verschiedenen Knöpfe bedient und die Funktionen aufgerufen. Als das Außerordentliche dann passierte und der Löwe unvermittelt vor ihm stand, hatte er einen ähnlichen Schreck gekriegt wie Oma Klatt jetzt. Und er hatte nicht das Geringste begriffen. Auch heute noch, da Florian sich längst an das Tier mit dem sonderbaren Namen Rex-kun gewöhnt hatte, fragte er sich manchmal, wie die Konstrukteure dieses Kunststück geschafft hatten: einen Löwen zum Anfassen, der auf eine bestimmte Tastenkombination hin aus dem Tamagotchi sprang oder wieder darin verschwand. Der rennen, brüllen und sogar sprechen konnte. Seine Schulfreundin Mareike, die einen Sinn für alles Ungewöhnliche hatte, sagte einfach: „Das ist ein Wunder und Wunder kann man nicht erklären. Ich bin froh, dass Rex da ist. Ich liebe ihn sehr.“´
Erstmals 2104 veröffentlichte die edition NORDWINDPRESS Straußberg „Blumengärten und Bomberstaffeln. Szenen einer Kindheit“ von Ingrid Möller: Es ist das letzte der belletristischen Bücher der Autorin: ein Rückblick auf die ersten zehn Jahre ihres Lebens. Dabei zeigt sich, wie vieles von dem, was später für sie wichtig und entscheidend wurde, sehr früh in Ansätzen vorhanden war. (Eine Einsicht übrigens, die am Beispiel der Kindheit der Sibylla Merian vor zwanzig Jahren mit dem Peter-Härtling-Preis gewürdigt wurde.) Hier allerdings geht es um eine jüngere Vergangenheit, die achtzig bis siebzig Jahre zurückliegt. Eine Zeit also, die historisch in Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit gegliedert wird. Dementsprechend dramatisch stellen sich viele Geschehnisse dar – immer aus Sicht und Empfinden dieses Kindes. Schauplatz ist eine Kleinstadt, das mecklenburgische Grabow, wo alles nahe beieinander liegt und die meisten Menschen miteinander bekannt sind. Die persönlichen Erlebnisse sind andere als die heutiger Kinder, die vielfach von ihren Müttern von einem „Event“ zum anderen im Auto gefahren werden, und wo es Erwachsene sind, die (oft teure) Spielangebote organisieren. Damals aber waren es die Kinder selbst, die die Möglichkeiten ihrer Umgebung zu nutzen wussten, wenn auch mitunter nicht ohne Gefahr. Spielplätze kannten sie nicht einmal dem Wort nach. Und den Erwachsenen nach Kräften zu helfen, galt als selbstverständlich, da sie doch Maximen aufschnappten wie „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.“ Nicht umsonst sagt das Sprichwort: Lachen und Weinen stecken bei Kindern in einem Sack. Und so ist auch dieses Buch geschrieben, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Manches mag überraschend, aber doch bedenkenswert sein. Hier ein paar dieser Kindheitsszenen:
Bei meiner Geburt
Bei meiner Geburt standen an meinem Bett zwei Feen, eine böse und eine gute. Die böse ließ meine Mutter sterben – fast drei Wochen später, die gute aber gab mir eine liebe neue Mutter. Die böse quälte mich mit Krankheiten, Unfällen, Ohnmachten, die gute hob mich immer wieder auf.
Ein Mäuschen huscht durchs Zimmer.
Ein Mäuschen huscht durchs Zimmer. Die Mutter mit ihrer Mäusephobie springt kreischend auf Stuhl und Tisch. Das Baby in seinem Körbchen lacht sich kaputt. Schnell wie gewohnt will die Mutter aufstehn, fällt aber vor Schmerz schreiend ins Bett zurück …
Das Baby mit seinem Lachkoller steckt beide an: erst Papa, dann auch die Mutter – und weg ist der Hexenschuss. Nun schlaf schön, sagt die Mutter. Das Kind weint, zeigt auf das Gespenst in der schummrigen Zimmerecke. Ach so, sagt die Mutter und nimmt den weißen Kittel weg vom Haken am schwarzen Ofen.
Gemütlich ist es in der Badewanne
Gemütlich ist es in der Badewanne mit dem Goldfisch aus Zelluloid und den Wassergeschichten im Ohr vom Schwamm, der mal ein Tier war im großen weiten Meer. Das Kind will nicht aus dem Wasser …
Bis die Drohung kommt: dann zieh ich den Stöpsel raus und du rutschst durch den Abfluss! Das zieht. In der Ostsee dann quetscht das Kind die Quallen aus im Glauben, es seien Schwämme.
Zur Silberhochzeit der Eltern
Zur Silberhochzeit der Eltern bekommt das Kind ein Festgewand. Das Kind prahlt: Es ist ein blaues Sanftkleid mit einer sülbernen Sleife und die sieht danz lot aus. Das Fest wird gefeiert, eine Rede gehalten über die 25 gemeinsamen Jahre, die nicht immer leicht waren. Das Kind horcht erst auf, als es heißt: aber trotzdem habt ihr es verstanden, euch immer die Rosinen aus dem Kuchen zu puhlen.
Da meldet sich Protest: Sowas darf man aber nicht!
Wieder mal bin ich krank.
Wieder mal bin ich krank. Hohes Fieber: Mitfühlend fragt der Arzt: Wo tut es dir denn weh? Ich seufze tief und klage: der ganze Mensch tut mir weh!
Zu meinem vierten Geburtstag
Zu meinem vierten Geburtstag waren drei Kinder geladen. Die Mutter reihte uns vor dem Sofa auf. Ein Erinnerungsfoto sollte es werden mit einem an eine Art Zündschnur angesteckten Blitz. Das war uns unheimlich. Darf man die Augen auch zumachen? fragte der Kleine.
Möglichst nicht!
Als meine Mutter die Negative im Labor besah, traute sie ihren Augen nicht: Links stand stocksteif mit verbissenen Zügen das große Mädchen, daneben etwas Verschwommenes wie ein Kreisel in Drehbewegung, dann der kleine Junge mit zugepressten Augen und ganz rechts der große Junge mit aufgerissenem Maul. Die Mutter grübelte: wer war der Wirbelwind? Ich natürlich.
Die Mutter schüttelte den Kopf und murmelte: Es ist wohl leichter, einen Sack Flöhe zu hüten als so malle Kinder. Zum Glück gab es noch eine zweite Aufnahme. Auch nicht viel besser.
Sonntags gingen wir immer spazieren
Sonntags gingen wir immer spazieren, kilometerweit. Einmal, kurz vor Hechtfortschleuse, fand ich einen Stein, rund, glatt, mit glitzernden Sprenkeln. Darf ich den mitnehmen? fragte ich. Doch nicht im Sonntagskleid! Ich versteckte den Stein unter einem Strauch und merkte mir den Platz. Am nächsten Tag schlich ich aus dem Haus, rannte den Weg an der Elde entlang, der immer länger wurde, und holte den Stein. Nicht ohne Zittern und Zagen. Aber als Siegerin.
Jedes Jahr erlebten wir das gleiche Drama am Starenkasten an der Wand gegenüber dem Balkon: Das Starenpaar kam von seiner Reise, der Starenmann pflückte ein Stiefmütterchen und umburrte damit seine Liebste. Sie erhörte ihn und begann bald zu brüten. Kaum aber schlüpften die Kleinen, kamen kreischend mit spitzen Flügeln die viel größeren Mauersegler. Unter großem Geschrei töteten sie die noch nackten Jungen und warfen sie auf das geteerte Dach darunter. Dann bewohnten sie selbst den Kasten und zogen ihre böse Brut auf.“
Zum Superpreis von nur 99 Cents ist außerdem ein Titel aus der Reihe der Tempelritter-Bücher „Das Gold der Templer“ von einem der Experten für dieses Thema, Ulrich Hinse, im Angebot – der erst im vergangenen Jahr bei der EDITION digital sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book erschienene historische Roman über den Aufenthalt der Templer bei dem Volk der Chachapoya in den Anden „Das Gold der Andentempler“: Pablo de Alvares war ein Ritter des Templerordens, er war in Asturien geboren und seinem Vater ins Heilige Land gefolgt. Dort konnte er sich aus der Festung Akkon retten und war mit dem Großmeister Jaques de Molay nach Paris gekommen. Von dort zieht er mit Joao Lourenco nach Portugal, um das Gold der Templer vor König Philipp dem Schönen in Sicherheit zu bringen. Einem Eid zufolge, den er seinem alten Vater geleistet hatte, folgte er Joao Lourenco mit dem Gold der Templer über das atlantische Meer. Dort jedoch zerstritt er sich mit seinem Ordensbruder und lockte den größten Teil der Schiffsbesatzung hinein in den Urwald – wo er das Paradies vermutete. Mit den Händlern der Chachapoya gelangten sie nach langer Fahrt auf dem Amazonas zu den Anden, wo die Eingeborenen wohnten und sie herzlich aufnahmen. Dann aber wurden sie von den Inka überfallen, die ihnen das gesamte Gold raubten. Pablo macht sich auf die Suche und wundert sich, wie wenig Interesse seine Ordensbrüder daran haben, den Schatz wiederzufinden. Selbst sein treuer Gefolgsmann Ragnar, ein hünenhafter Normanne, fällt ihm in den Rücken und verlässt ihn. So muss sich Pablo de Alvares allein auf die Suche nach dem Gold machen. Während dieser Suche lernt er die Steinstraßen der Inka, den Goctafall, den größten Wasserfall der Erde, und die Goldschmiede der Anden, die Tairona, kennen, aber auch Kuelap, die Festung der Chachapoya. Als diese von den Inka angegriffen wird, um die Chachapoya zu unterwerfen, trifft Pablo de Alvares wieder auf den Normannen Ragnar. Es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod. Und so beginnt dieser Roman über die Templer in den Anden:
Es war erst wenige Wochen her, als die kleine Truppe der Tempelritter aus der Alten Welt, genauer aus dem Norden Portugals, mit ihrem umgebauten Wikingerschiff Le Buscard über das Atlantische Meer gesegelt war. Die Templer waren in einer neuen, für sie völlig fremden Welt angekommen. Freundliche Menschen hatten sie in ihrem Dorf am Rande eines fast undurchdringlichen Waldes empfangen. Und sie lernten das Leben am großen Strom kennen, das so ganz anders war, als sie es aus Europa kannten. Für sie schien es das Paradies zu sein. Obst, Fleisch, Fisch in Hülle und Fülle. Es konnte ohne Verbote gejagt und gefischt werden und der Wald lieferte die Früchte. Trotzdem wollte ihr Führer, der Tempelritter Joao Lourenco, der sie mit seinen nautischen Kenntnissen bis hierhin in die Neue Welt geführt hatte, wieder zurück.
Das ergab für Pablo de Alvares, Joaos Stellvertreter, keinen Sinn. Er hatte einen anderen Plan. Er wollte einen Teil der Templer überreden, mit ihm in der Neuen Welt zu bleiben. Sollte Joao doch zurückfahren, mit wem er wollte. Er und seine Gefolgsleute würden hier bleiben. Hier, wo sie das Paradies vermuteten. Aber so einfach war es nicht, diesen Plan umzusetzen. Bei Anwesenheit von Joao würde ihm wahrscheinlich nur Ragnar, der normannische Riese und persönliche Gefolgsmann, folgen. Die Zeit, seinen Plan zu realisieren, war für Pablo gekommen, als sich Joao mit seinem Vertrauten Kasim und einem weiteren Templer auf einem Jagdausflug befand. Dass dieser Ausflug länger dauerte als geplant, dafür hatte Pablo gesorgt. Über den Dolmetscher, dem Kaplan der Templer, hatte er bei den Gastgebern ein Gerücht gestreut, was vermutlich zum Tod der Jäger führte. Ihm konnte das nur recht sein.
Kaum war Joao mit dem muslimischen Arzt Kasim, seinem vertrauten Freund, zur Jagd mit einem Einbaum abgefahren, setzte Pablo seinen Plan um. Für einige der Templer war das im Stich lassen ihres Anführers schon eine schlimme Aktion. Sie empfanden es als Bruch ihres Eides, den sie dem Orden geschworen hatten. Ewige Treue und Gehorsam. Sich in Abwesenheit von Joao Lourenco von Bord ihres Schiffes in der Flussmündung zu stehlen und auch noch das anvertraute Gold mitzunehmen, war eindeutig ein Treuebruch. Aber warum hatte der Sturkopf Joao sich auch mit Pablo de Alvares gestritten. Ihr neuer Führer, Pablo de Alvares, hatte Recht. Sie waren hier im Paradies angekommen und genau das hatte Joao Lourenco bestritten. Pablo des Alvares hatte die Zeit eines Jagdausfluges von Joao genutzt und an Bord abstimmen lassen. Nur gut zehn Templer wollten am Le Buscard bleiben, um auf die Rückkehr von Joao zu warten. Die anderen wollten mit Pablo de Alvares und seinem Adlatus, dem riesigen, blonden Normannen, auf den Booten der Eingeborenen, die sich Chachapoya nannten, weiter ins Paradies fahren.
Fra Domenico, der Kaplan der Templer, hatte sich als Sprachgenie erwiesen und bei ihrem Aufenthalt bei den Eingeborenen innerhalb kürzester Zeit deren Sprache gelernt. So hatte er für Pablo bei den Urwaldhändlern gefragt, ob sie ihn und seine Templerbrüder in ihre Heimat mitnehmen würden. Die freundlichen Eingeborenen hatten nichts dagegen. So waren die Templer mit ihren Goldkisten und ihren persönlichen Gegenständen, auf die sie nicht hatten verzichten können oder wollten, von Pablo auf die Einbäume der Chachapoya verteilt worden. Alle, die in den Booten saßen, hatten sich freiwillig Pablo de Alvares angeschlossen und fuhren jetzt mit den Eingeborenen den Fluss hinauf ins Paradies, wie sie glaubten.
Die Flut schob die Einbäume recht zügig voran, obwohl die Boote, in denen die Kisten mit dem Gold waren, ziemlich tief im Wasser lagen. Trotzdem tauchten ihre Paddel nur gelegentlich ins Wasser, um die Boote in Richtung zu halten. Von den Abtrünnigen sah sich niemand mehr um. Sie saßen in den Booten und schauten nur nach vorn. So ist es richtig, dachte Pablo. Immer nach vorne blicken, nicht nach hinten. Vorne ist die Zukunft, hinten ist die Vergangenheit.
Es dauerte eine ganze Zeit, bis sich die Einbäume hinter einer schwimmenden Insel den Blicken der Zurückgelassenen entzogen. Die große, schwimmende Insel zog an ihnen vorbei und für einen Moment glaubte Pablo, er hätte zwischen dem Gewirr aus Pflanzen und Ästen die Gestalt von Joao gesehen. Dann schüttelte er den Gedanken ab und blickte wieder nach vorn. Joao mit seinem Schiff Le Buscard, die sie in diesen Teil der Welt gebracht hatten, waren Vergangenheit. Er wollte nicht mehr daran denken. Nicht zuletzt um seinen Verrat an Joao Lourenco, dem er ja noch vor seinem Vater Treue und Loyalität geschworen hatte, zu vergessen. Aber Joao war eben kein Edelmann, sondern ein einfacher Emporkömmling. Er war nur von einfachem Blut, ein Hidalgo. Wusste der Teufel, was den dreiundzwanzigsten Großmeister des Templerordens bewegt hatte, den jungen Mann aus der Nähe von Aachen im Rheinland mit Führungsaufgaben auszustatten. Eigentlich hätte es ihm, dem spanischen Edelmann, zugestanden, die Führung der Templer zu übernehmen. Da das nicht geschehen war, hatte er schon immer überlegt, wie er Joao seine Position streitig machen konnte. Er dachte an ein spanisches Sprichwort: „Wer seinen guten Ruf verloren hat, geht als Toter durchs Leben.“ Es ging also darum, dem Hidalgo seine Ehre zu nehmen. Das war für diesen schlimmer, als getötet zu werden. Genau darauf hatte er seinen Plan aufgebaut. Jetzt war er der Führer der fast dreißig Templer, die sich ihm angeschlossen hatten. Er war am Ziel seiner Träume, wenn auch anders, als er das im Heiligen Land und später in Frankreich und Spanien noch geglaubt hatte.“
Manchmal ändern sich eben auch die Vorstellungen vom Paradies. Eine solche Erfahrung dürfte wohl schon jeder Mensch (und Leser) schon selbst erlebt haben. Eines aber bleibt so oder so richtig: Für Bücher-Menschen gibt es eigentlich nur ein richtiges Paradies. Auf unübertreffliche Weise hat es der argentinische Schriftsteller, Bibliothekar und (übrigens völlig erblindeter) Direktor der Nationalbibliothek seines Landes sowie Mitbegründer des magischen Realsimus, Jorge Luis Borges (1899 bis 1986), einmal so formuliert: „Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca.“ – „Ich habe mir das Paradies immer als eine Art Bibliothek vorgestellt.“ Und diesem wunderbaren Satz ist nun wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Also, lassen wir ihn am Schluss dieses Newsletters auch einfach so stehen.
Viel Spaß beim Lesen, beim Gang ins (Bücher)Paradies und bis demnächst.
EDITION digital wurde 1994 gegründet und gibt neben E-Books (vorwiegend von ehemaligen DDR-Autoren) Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, derzeit fast 900 Titel (Stand März 2018). Jährlich erscheinen rund 100 E-Books und 15 gedruckte Bücher neu.
Titelbilder können Sie unter http://www.edition-digital.de/Presse herunterladen.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de